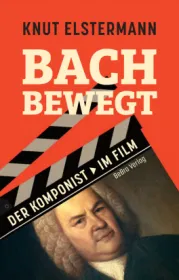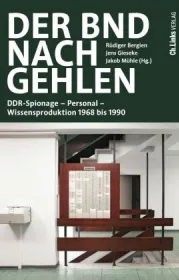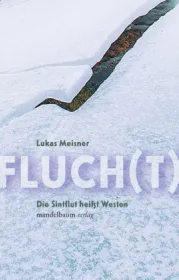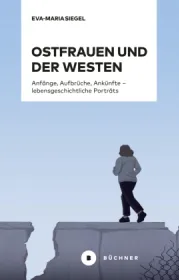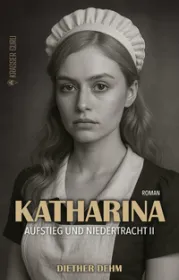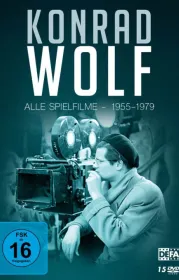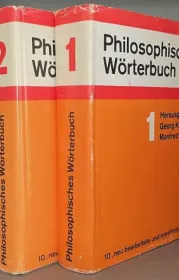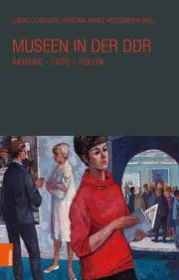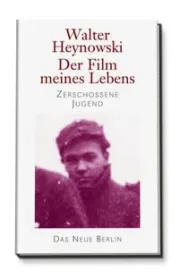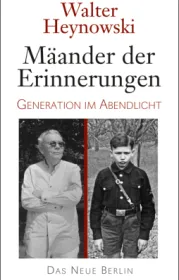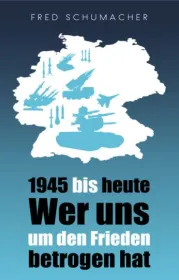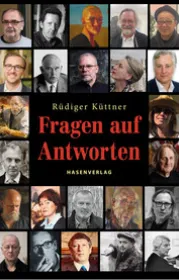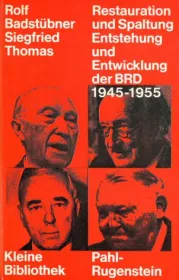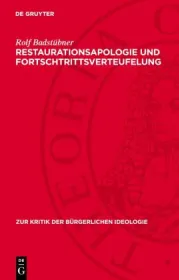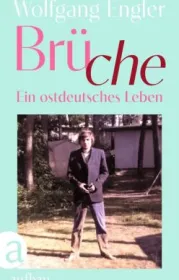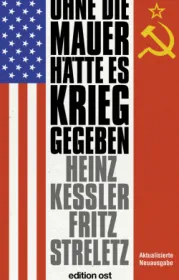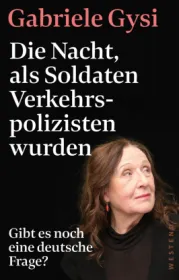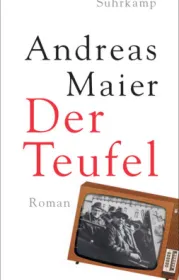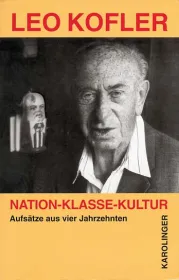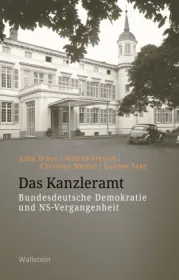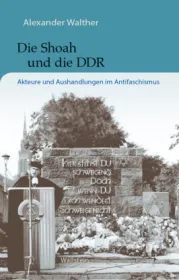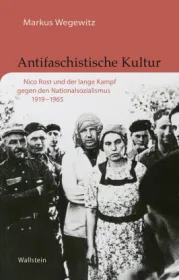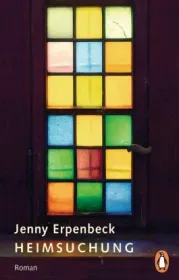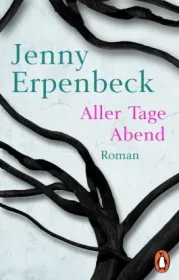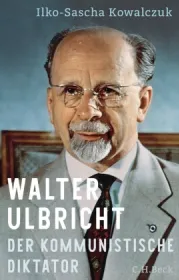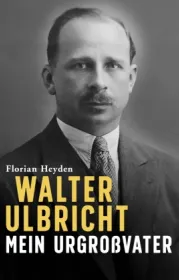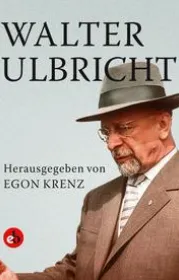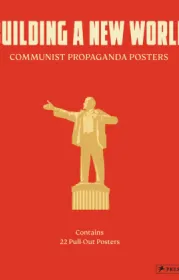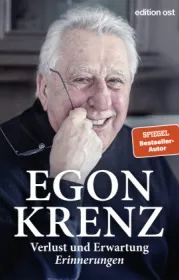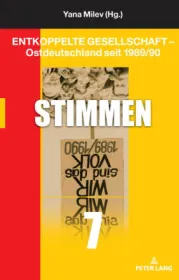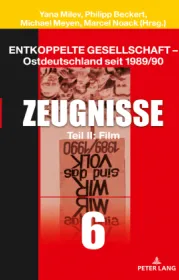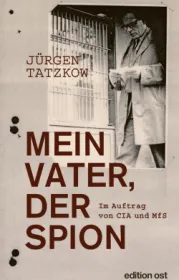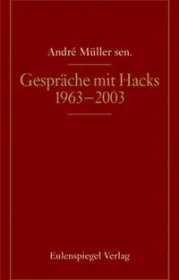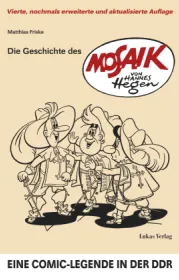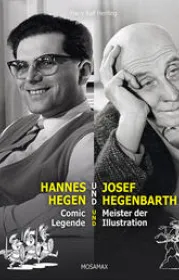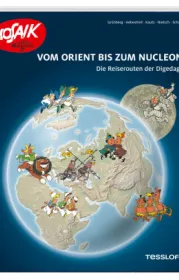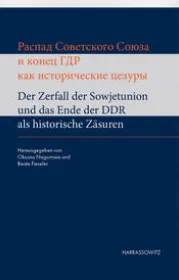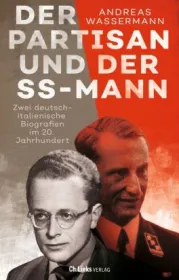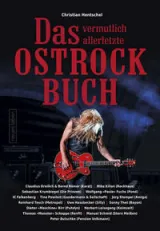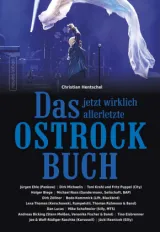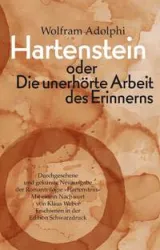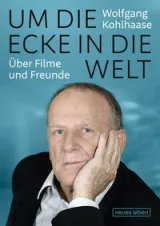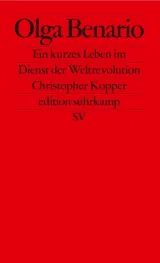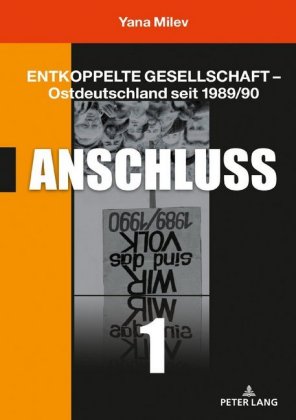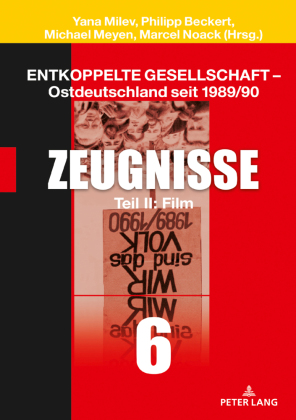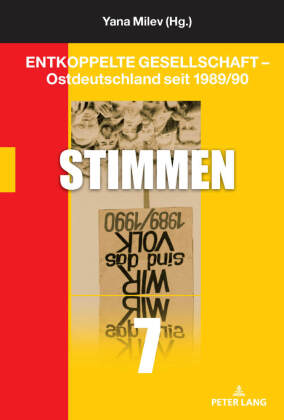The Secret War for Germany: CIA’s Covert Role in Cold War Berlin Explored through Recently Declassified Documents
Washington, DC, May 11, 2022— The Central Intelligence Agency aggressively pursued clandestine efforts to undermine East German morale at the height of the Cold War, recently declassified CIA records confirm. Exploring one of the core chapters of post-war European history, the materials posted today by the National Security Archive detail key facets of the intelligence agency’s still meagerly documented activities in East Germany.
Those activities included supporting and advising certain anti-communist activist groups, particularly in Berlin – a fact long denied in public – which were effective enough to prompt the Soviets to make them a subject of diplomacy with Washington, in addition to implementing their own propaganda and security measures.
This e-book consists of several documents culled from the recently published Digital National Security Archive collection CIA Covert Operations IV: The Eisenhower Years, 1953-1961 (ProQuest, 2021), available by subscription through many libraries. They provide a concise look into some of the intelligence agency’s previously classified ties to covert organizations in Cold War Germany. National Security Archive 11.05.2022