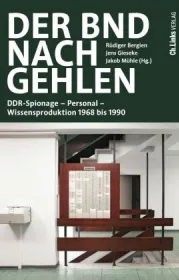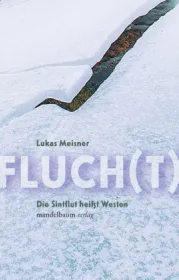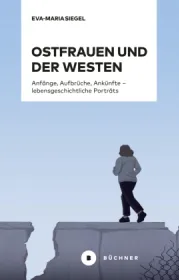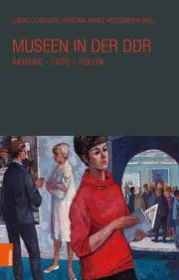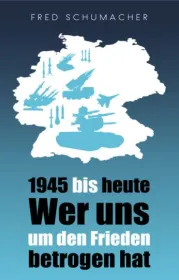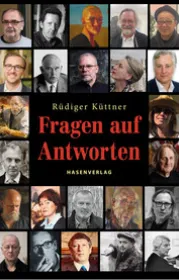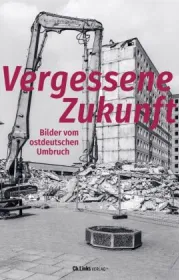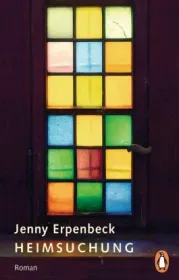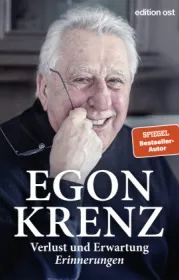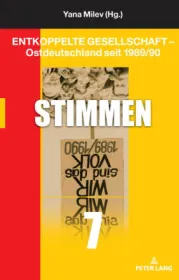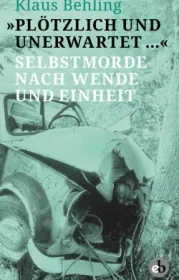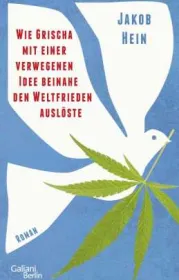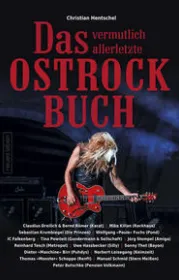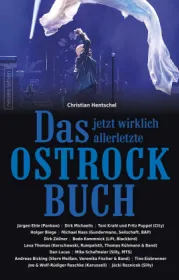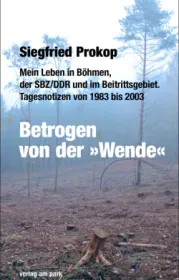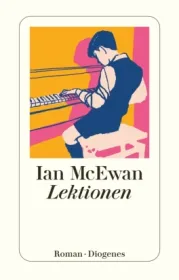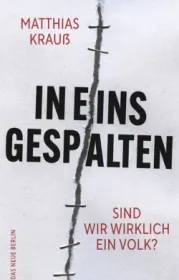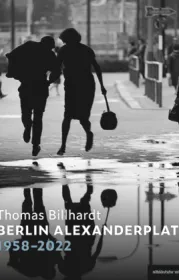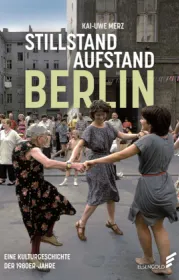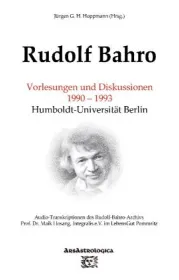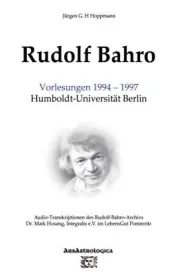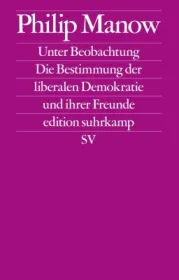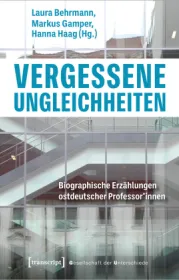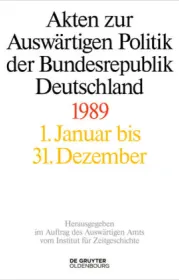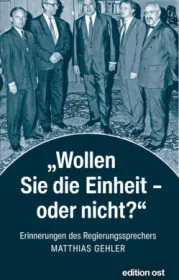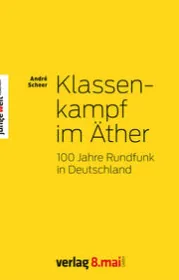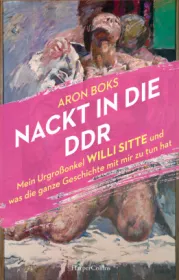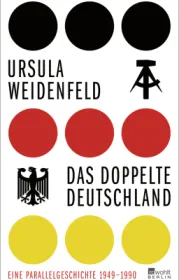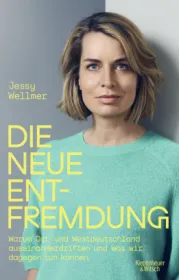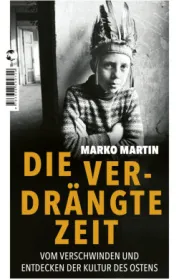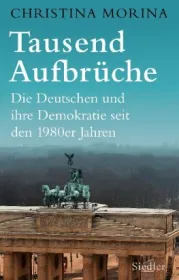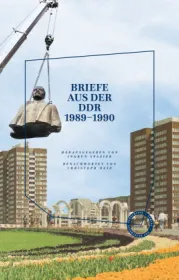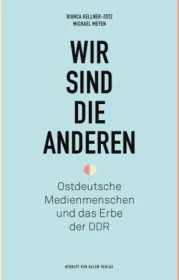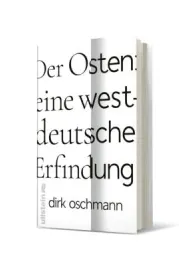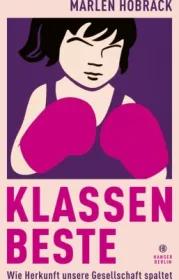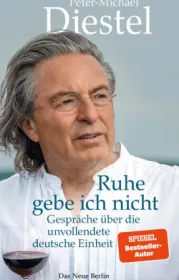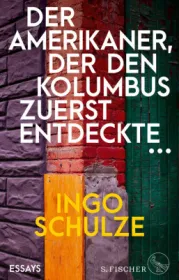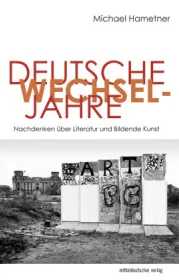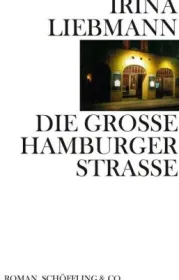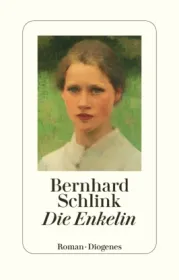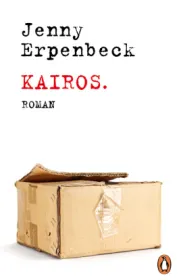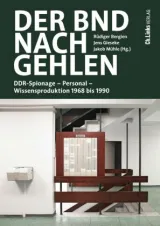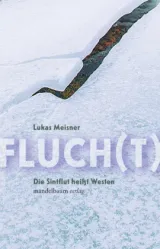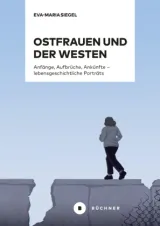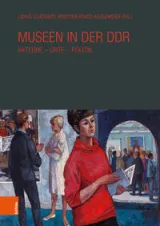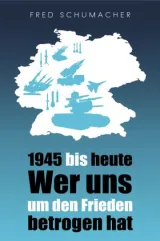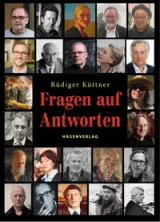In diesem Buch kommen elf Zeitzeugen zu Wort: Professoren und Dozenten, die an der Karl-Marx-Universität Leipzig die DDR-Journalistik erfunden und bis zum Ende getragen haben - von Franz Knipping, Heinz Halbach, Werner Michaelis und Fritz Beckert über Hans Poerschke, Karl-Heinz Röhr und Klaus Preisigke bis zu Wolfgang Tiedke, Wulf Skaun, Bernd Okun und Sigrid Hoyer.
Diese Liste deckt alle Zeiträume (von den frühen 1950er-Jahren bis weit nach dem Ende der DDR), alle Positionen (Student, Mittelbau, Professor, Dekan bzw. Direktor) und alle Wege an die Spitze der akademischen Pyramide ab.