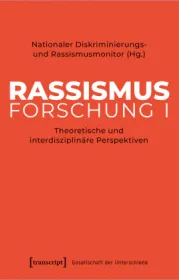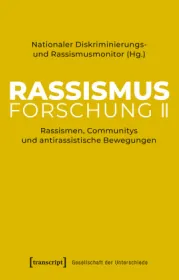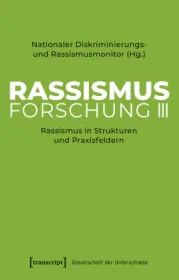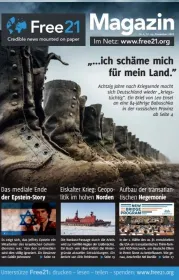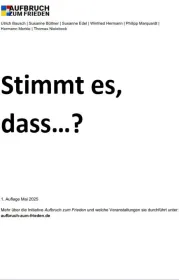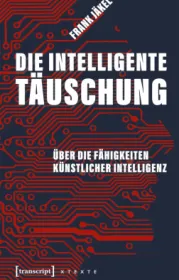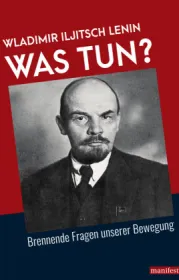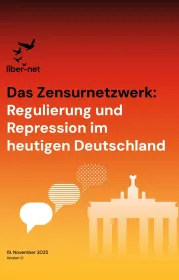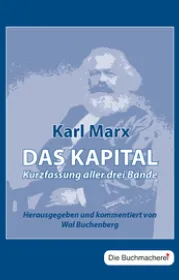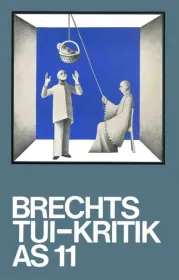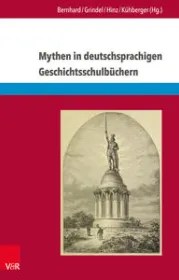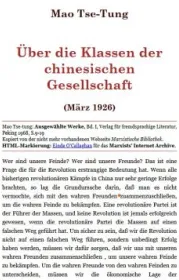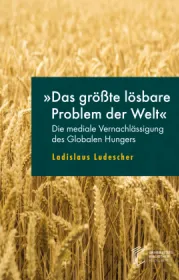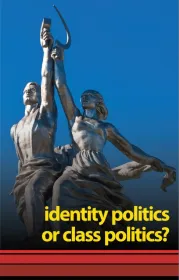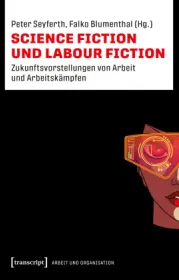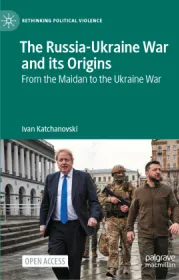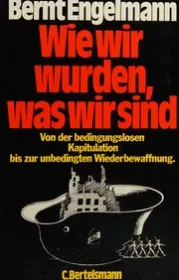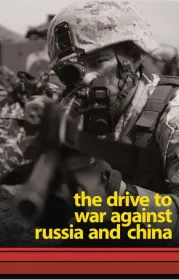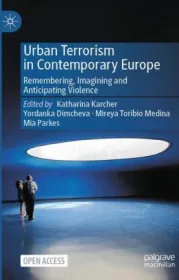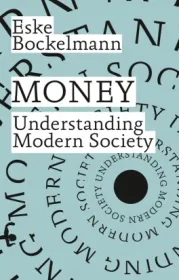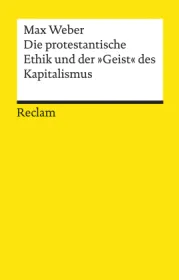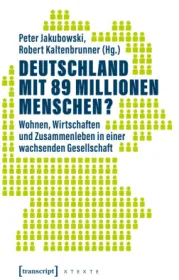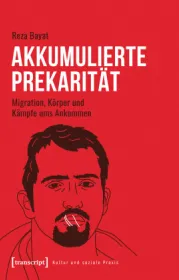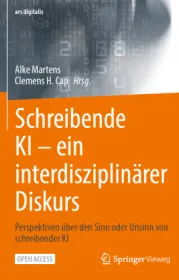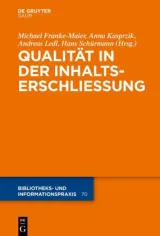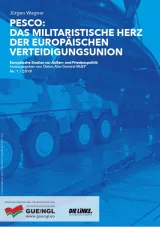Grundlage und Ausgangspunkt dieses Beitrags ist ein für den IMI-Kongress 2020 verfasster Vortrag, der sich um die Rolle und das geopolitische Auftreten der Volksrepublik China unter den Vorzeichen der sich ausbreitenden Pandemie beschäftigte.
Kostenlos (Thema)
Was heute als Ukraine-Krieg bezeichnet wird, sind die Folgen des klar völkerrechtswidrigen Einmarsches russischer Truppen ab dem 24. Februar 2022. In der Berichterstattung etablierter deutscher Medien erscheint er tendenziell als eher konventionellen Krieg mit massivem Einsatz klassischer Waffensysteme wie Panzer, Artillerie, Infanterie.
Der Plan der EU-Kommission ist es, einen Europäischen Verteidigungsfonds (EVF) zu schaffen, um zusammen mit anderen Maßnahmen „die Effizienz und die Synergie bei Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten zu steigern und so eine innovative Rüstungsindustrie zu fördern“. Dabei geht es um eine sogenannte „Öffnung der nationalen Rüstungsmärkte“ und eine industrie- und forschungspolitische Förderung von Kooperationsprojekten auf EU-Ebene, die sich auf militärische Forschung, Entwicklung und Beschaffung erstrecken. Der Europäische Verteidigungsfonds ist illegal, weil der EU-Vertrag eine Verwendung von EU-Haushaltsmitteln für militärische Zwecke ausschließt.
Datenjournalist/innen verwenden für ihre Berichterstattung digitale Daten, welche sie verarbeiten, visualisieren und journalistisch publizieren. Rahel Estermann erarbeitet auf Praxis- und Feldebene, welche Expertisen, Materialitäten, Kulturen und sozialen Prozesse sich im Datenjournalismus verschränken.
Der 70. Band der BIPRA-Reihe beschäftigt sich mit der Qualität in der Inhaltserschließung im Kontext etablierter Verfahren und technologischer Innovationen. Treffen heterogene Erzeugnisse unterschiedlicher Methoden und Systeme aufeinander, müssen minimale Anforderungen an die Qualität der Inhaltserschließung festgelegt werden. Die Qualitätsfrage wird zurzeit in verschiedenen Zusammenhängen intensiv diskutiert und im vorliegenden Band aufgegriffen.
»PESCO“, diese Abkürzung wird womöglich in wenigen Jahren ähnlich symbolhaft für eine schrecklich verfehlte Politik der Europäischen Union stehen wie aktuell die EU-Grenzschutzagentur »FRONTEX«. Frontex steht derzeit für brutale Abschottungspolitik. PESCO ist der Grundstein einer aktuell im Aufbau befindlichen »Europäischen Verteidigungsunion«.
Doch geht es wirklich um „Verteidigung“? Steckt hinter PESCO also ein notwendiger Schritt für eine effizientere und internatio- nalistischere Außen- und Militärpolitik im Sinne progressiver „europäischer Werte“, wie einige beschwören? Oder muss man nicht das Aussprechen, was wirklich geplant ist: Sicherung von Wirtschafts- und Handelsinteressen auch durch militärische Strukturen und Aufbau einer Großmachtstellung der EU in der Welt.
Das Buch dokumentiert den Prozess und die Beiträge des Ersten „Österreichischen Transformationsforums. Zivilgesellschaftliche Kooperation für den sozial-ökologischen Wandel“ (5.-6. März 2024, Universität für Weiterbildung Krems), an dem Delegierte von 75 zivilgesellschaftlichen Organisationen mitwirkten.
SCHWERPUNKT: AFGHANISTAN
— Editorial (Christoph Marischka)
— Der Afghanistankrieg und die Friedensbewegung (Christine Schweitzer)
— Perspektiven der afghanischen Frauenbewegungen (Mechthild Exo)
— Afghanistan und das Recht auf Bewegungsfreiheit (Jacqueline Andres)
— Alltag „Kampfeinsatz“: Afghanistan und die deutsche Außenpolitik (Martin Kirsch)
— Lehren aus Afghanistan: Lernen für künftige Kriege (Nabil Sourani)
SCHWERPUNKT: RÜSTUNG
— Editorial (Martin Kirsch und Andreas Seifert)
— Rüstungsindustrie im Kapitalismus (Christopher Schwitanski)
— Business as Usual. Korruption als ständiger Begleiter von Rüstungsdeals (Pablo Flock)
— Funktionen der EU-Waffenexporte (Jacqueline Andres)
— Rheinmetall. „Deutscher“ Konzern global vernetzt (Martin Kirsch)
SCHWERPUNKT: ATOMWAFFEN
— Editorial – Ben Müller
— Von der Kernspaltung zur Atomkriegsgefahr – Ben Müller
— Atomwaffen – Andreas Seifert
— Frieden durch US-Atomwaffen? Trumps Nuklearpolitik – Regina Hagen
— Atomkrieg durch konventionelle Waffen? – Jürgen Scheffran
— Ein neues europäisches Raketenzeitalter? – Claudia Haydt
— Nukleare Teilhabe – Xanthe Hall