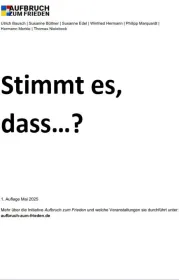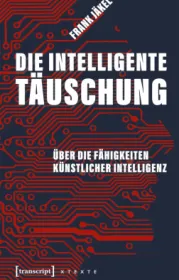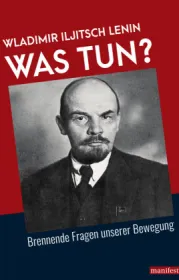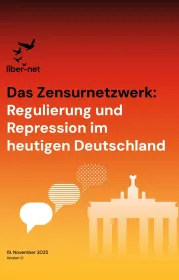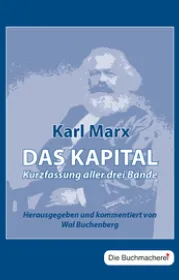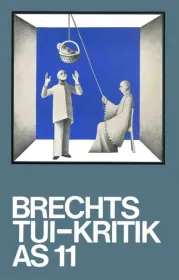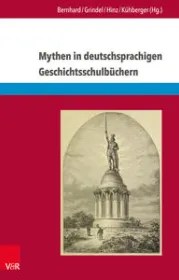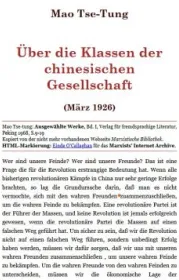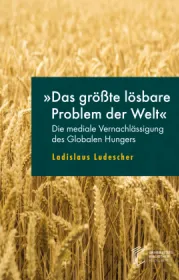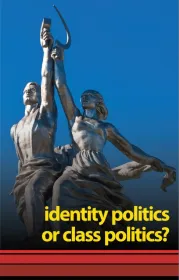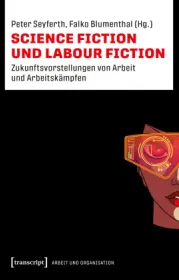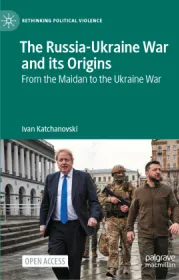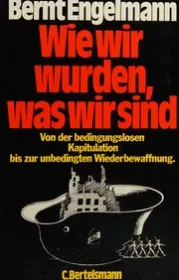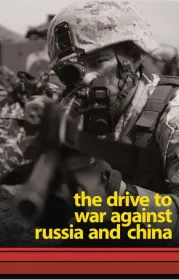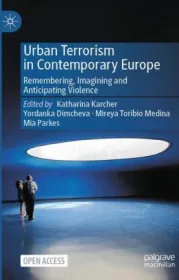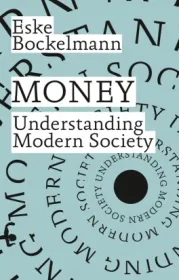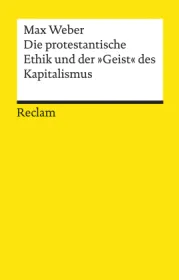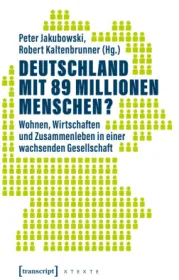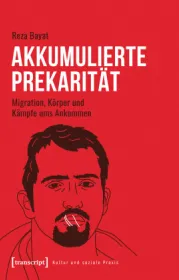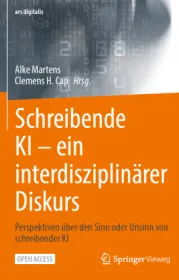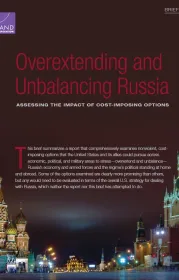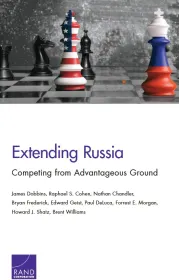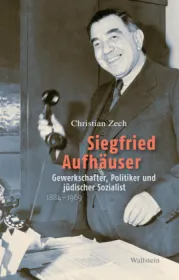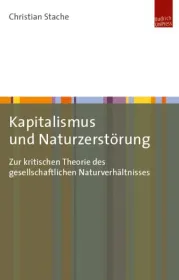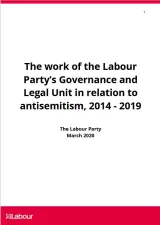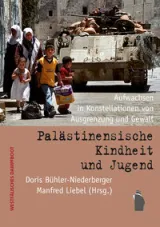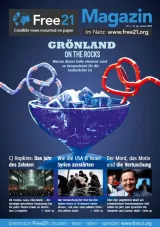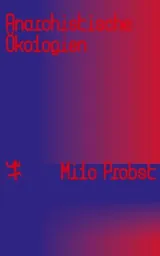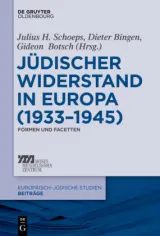Im Jahr 1953 stürzte die CIA Irans parlamentarisch legitimierten Premier Mossadegh. Erst 2017 veröffentlichte das US-Außenministerium Dokumente, die das gesamte Ausmaß der US-Verwicklungen in den Putsch zeigen.
Lange Zeit hat Washington seine Beteiligung an den damaligen Ereignissen verschwiegen, obwohl schon kurz danach zahlreiche Presseberichte eine Verwicklung der CIA vermuteten. Erst fast 65 Jahre später, veröffentlichte das US-Außenministerium einen von Historikern lang erwarteten detaillierten Bericht über die Beteiligung US-amerikanischer Geheimdienste am Putsch gegen Irans damaligen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mohammed Mossadegh.
Kostenlos (Thema)
Im April 2020wurde Sky News ein 860-seitiger parteiinterner Bericht zugespielt, der noch vo n Corbyns (seit 2018 amtierender) Generalsekretärin Jennifer Formby in Auftrag gegeben worden war. Er trägt den wenig attraktiven Titel „The work of the Labour Party’s Governance and Legal Unit in relation to antisemitism, 2014 – 2019“, befasst sich also primär mit der Frage, wie die Partei mit ihrem angeblichen und von den Medien grotesk aufgeblähten „Antisemitismus-Problem“ umgegangen ist.
Das Buch handelt von jungen Menschen palästinensischer Herkunft, die in Palästina und Israel leben oder deren Eltern und Großeltern dort gelebt haben. Sie haben Diskriminierung und Gewalt in vielen Varianten erfahren, von rassistischer Ausgrenzung und Benachteiligung, Flucht und Vertreibung, Aufwachsen in Flüchtlingslagern, militärischer Unterdrückung bis zur physischen Vernichtung. Das Buch macht die erlebte Geschichte dieser jungen Menschen sichtbar und zeigt, wie sie sich wehren und zu befreien versuchen.
EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser, Donald Trump beginnt seine Amtsperiode mit einem Feuerwerk präsidentieller Erlasse und Ankündigungen. Man kann seine Aktivitäten auch als unkontrolliertes Abbrennen von Knallfröschen im Wohnzimmer bezeichnen, die Beurteilung hängt von der Perspektive ab.
Mit Anarchistische Ökologien zeigt Milo Probst, wie Anarchistinnen und Anarchisten zwischen 1870 und 1920 immer wieder nach neuen Formen suchten, diese Erde zu bewohnen und von ihren Reichtümern zu leben. Dabei lässt der Historiker vielfältige Stimmen zu Wort kommen, von Berühmtheiten wie Pëtr Kropotkin oder den Brüdern Élie und Élisée Reclus über unbekanntere Autoren wie Jean Grave oder André Léo bis hin zu anonymen Verfassern von Zeitungsartikeln.
Demokratie ist eine sich immer wieder neu und aus sich selbst heraus entwickelnde Praxis. Was aber könnte handlungsorientierendes Wissen für eine solche demokratische Praxis bieten? Christian Leonhardt gibt hierauf eine radikaldemokratische Antwort: Er schlägt vor, radikale Demokratie nicht liberal, sondern anarchistisch zu denken.
Mit dem Mut der Verzweiflung begannen jüdische Kämpfer im April 1943 ihren Aufstand im Warschauer Ghetto. Es war die bekannteste, aber nur eine von vielen jüdischen Widerstandsaktivitäten gegen die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Der vorliegende Band widmet sich den unterschiedlichen Formen und Facetten des jüdischen Widerstandes, wie z.B. Partisanen-Kampf, Untergrundbewegung, Lageraufstände, Fluchthilfe und kultureller Widerstand.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion und das Verschwinden der DDR von der politischen Landkarte sind Ereignisse von welthistorischer Bedeutung. Sie veränderten nicht nur das System der internationalen Beziehungen und die nationalen politischen Ordnungen, sondern auch das Leben der „kleinen Leute“. Innerhalb kürzester Zeit war die Bevölkerung zweier Staaten radikalen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Umwälzungen ausgesetzt; etablierte Strukturen des Alltagslebens und Sicherheitsregime verloren rasch an Bedeutung. Der von Oksana Nagornaia und Beate Fieseler herausgegebene Sammelband widmet sich den politischen, kulturellen und erinnerungsgeschichtlichen Aspekten der komplexen Systemtransformationen in beiden Ländern, den daraus resultierenden Konflikten und den Bildern des jeweils Anderen.
Wie viele Bomben braucht es, bis eine Gesellschaft zusammenbricht? Sophia Dafinger untersucht eine Gruppe sozialwissenschaftlicher Experten in den USA, für die der Zweite Weltkrieg ein großes Forschungslaboratorium war. Der United States Strategic Bombing Survey bildet den Ausgangspunkt für die Frage, wie die Lehren des Luftkriegs nach 1945 von den Experten des Luftkriegs formuliert, verbreitet, aber dann auch wieder vergessen wurden. Dafingers Beitrag zu einer modernen Gewalt- und Konfliktgeschichte des 20. Jahrhunderts thematisiert die Rolle der Wissenschaften in demokratischen Staatswesen – eine Geschichte, deren Auswirkungen bis in unsere Gegenwart reichen.
Eine scharfsinnige Analyse darüber, wie Meinungen und Überzeugungen systematisch geformt werden, um Menschen zu lenken und zu kontrollieren. Rauter, ein österreichischer Schriftsteller und Sprachkritiker, war bekannt für seine kritische Auseinandersetzung mit Sprache und Machtstrukturen.