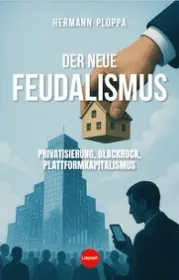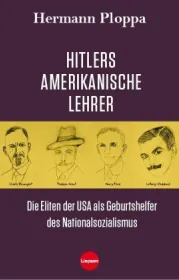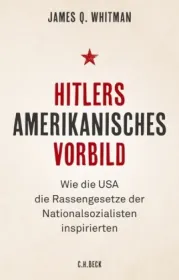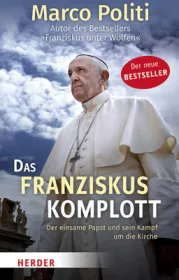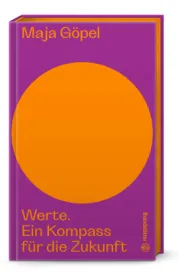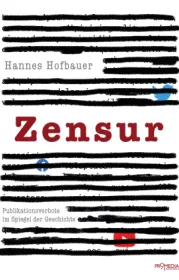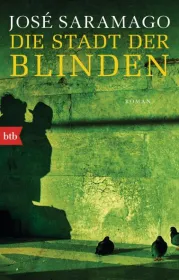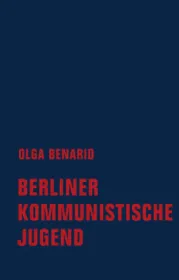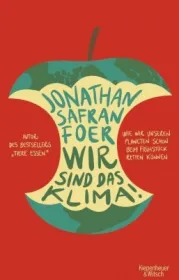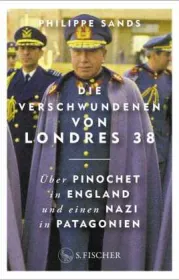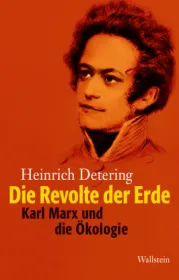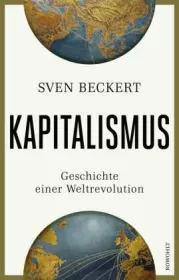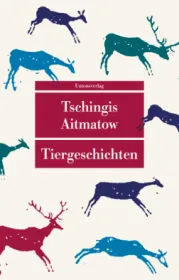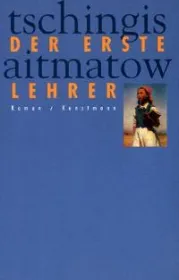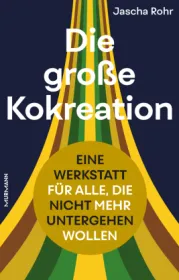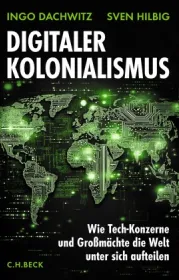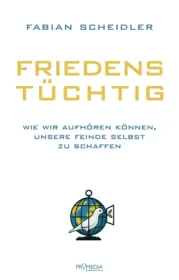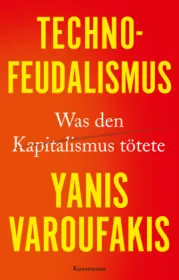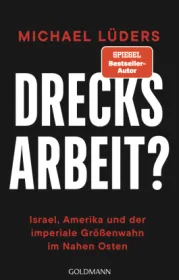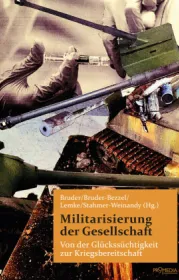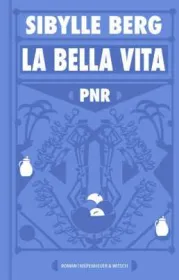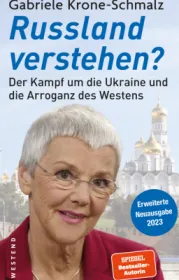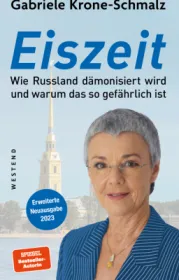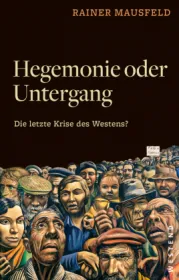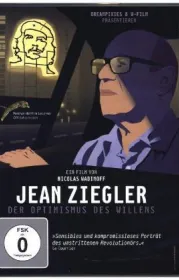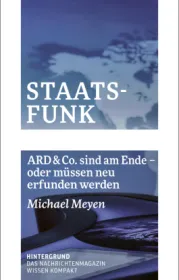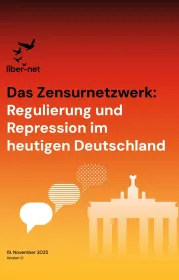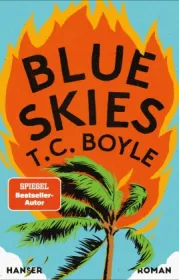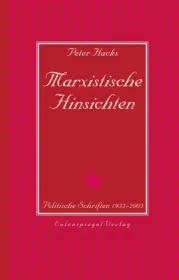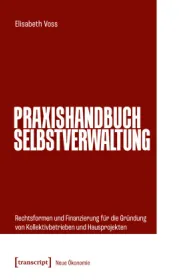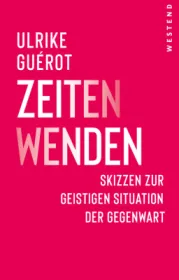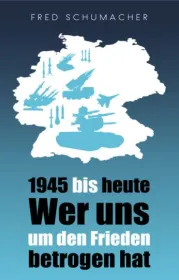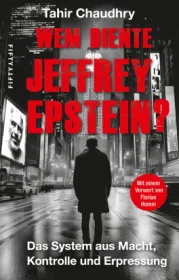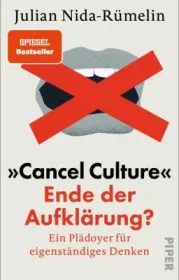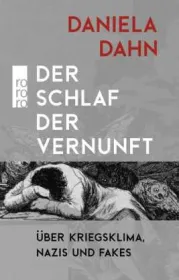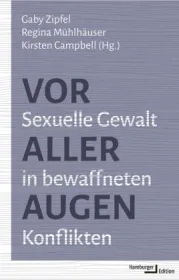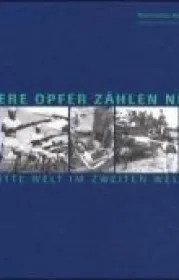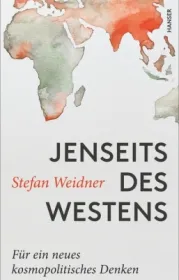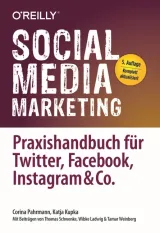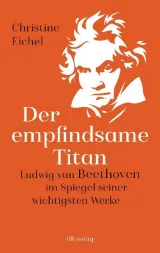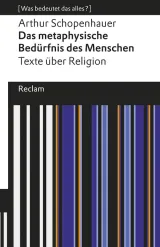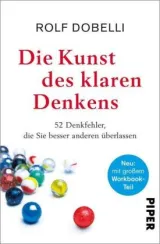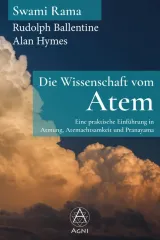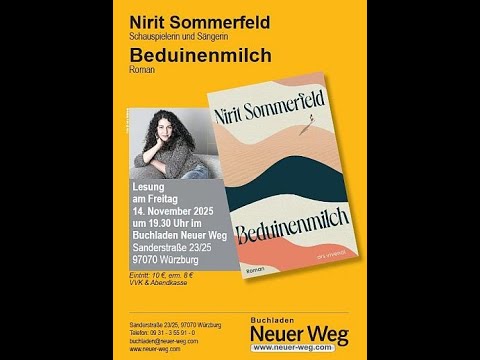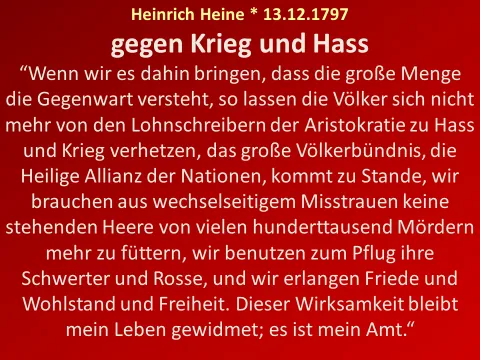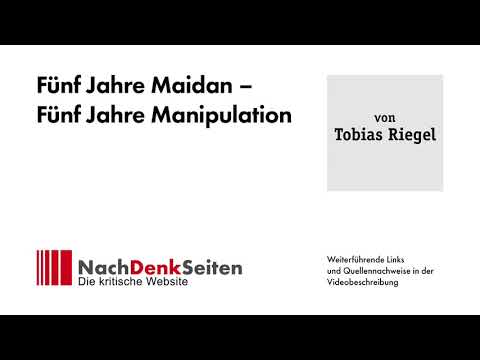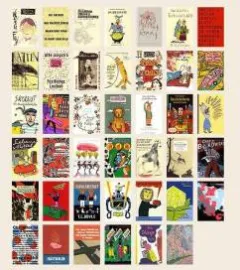"Der beste deutsche Roman, der mir jemals vor Augen gekommen." Christoph Martin Wieland (1780)
Johann Karl Wezel ist ein skandalös vergessener, vielseitig genialischer Autor des 18. Jahrhunderts.
"Im Jahre nach Erschaffung der Welt, als die Damen kurze Absätze und niedrige Toupets, die Herren große Hüte und kleine Haarbeutel, und Niemand leicht Gold auf dem Kleide trug, der nicht wenigstens Silber genug in der Tasche hatte, um es bezahlen zu können, wurde auf dem Schlosse des Grafen von Ohlau ein Knabe erzogen, der bey dem Publikum des dazu gehörigen Städtchens nicht weniger Aufmerksamkeit erregte und in den langen Winterabenden nicht weniger Stoff zur Unterhaltung gab, als Alexander, ehe er auf Abentheuer wider die Perser ausgieng. Graf und Gräfin, deren Liebling er einige Zeit war, nennten ihn Henri, seine Eltern Heinrich, und das ganze Städtchen den kleinen Herrmann, nach dem Geschlechtsnamen seines vorgeblichen Vaters - seines vorgeblichen, sage ich; denn so sehr die körperliche Aehnlichkeit mit ihm es wahrscheinlich machte, daß er sein wahres ächtes Produkt seyn möchte, und so wenig auch der erfahrenste Physiognomist auf den Einfall gekommen wäre, eine andere wirkende Ursache zu vermuthen, so hatte doch Jedermann die Unverschämtheit, trotz jenes wichtigen Grundes, ihn seinem Vater völlig abzuläugnen, und zwar aus der sonderbaren Ursache - weil der Sohn ein feiner, witziger, lebhafter Knabe wäre und gerade so viel Verstand, als sein Vater Tummheit, besäße."