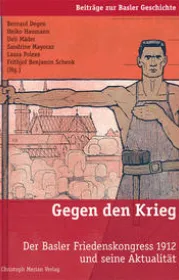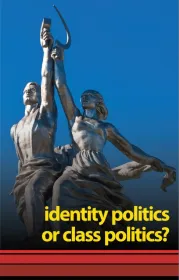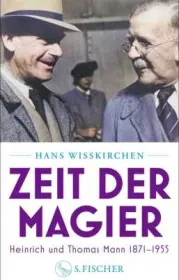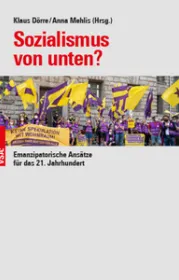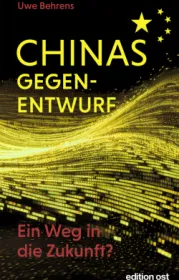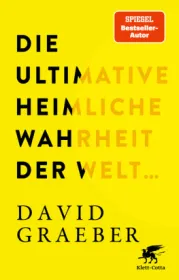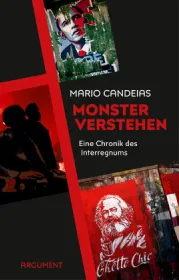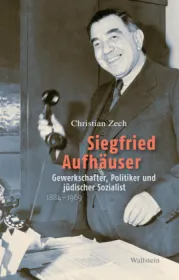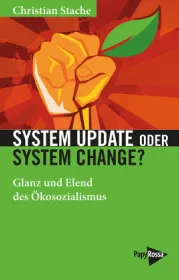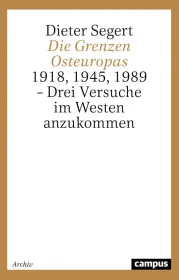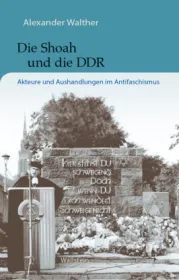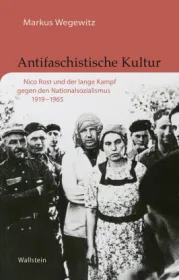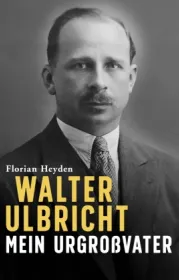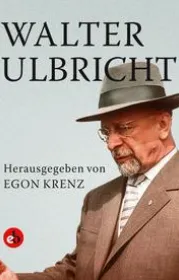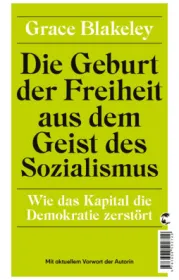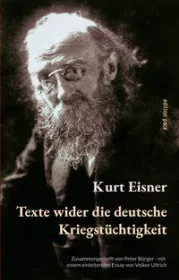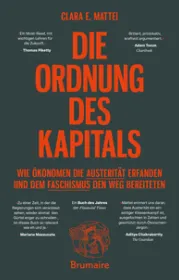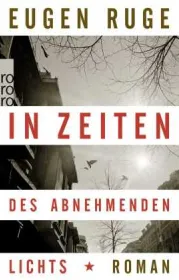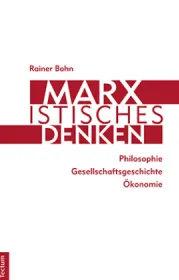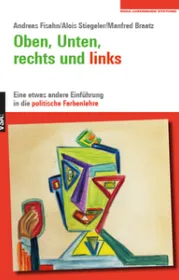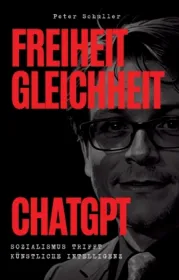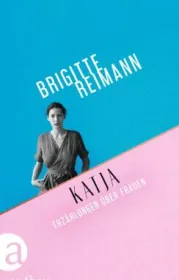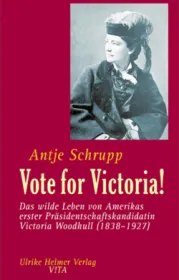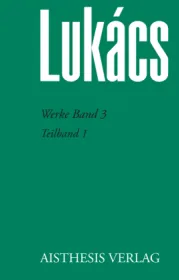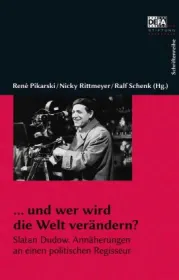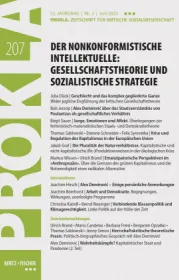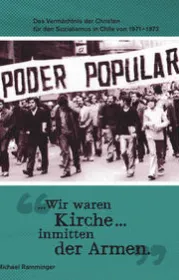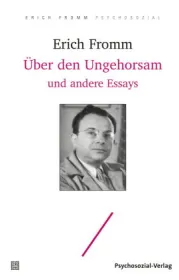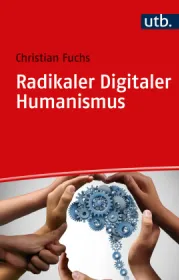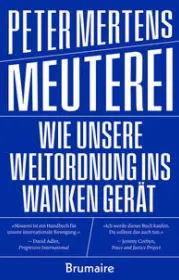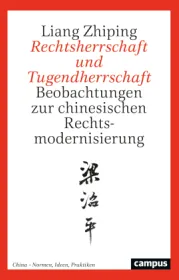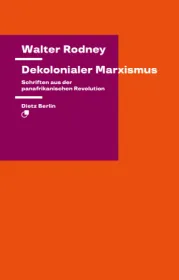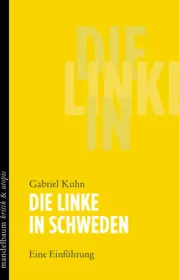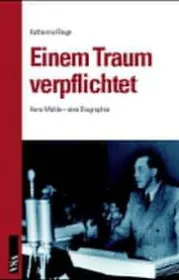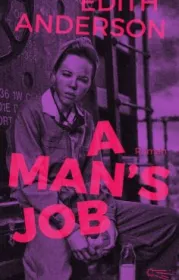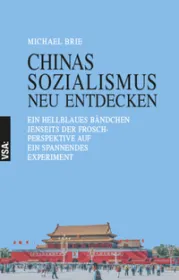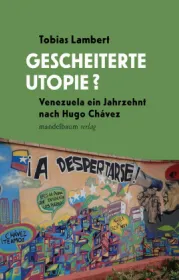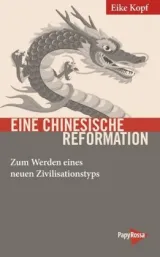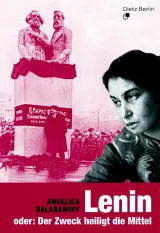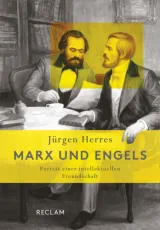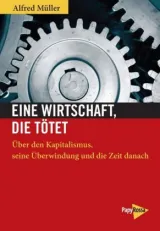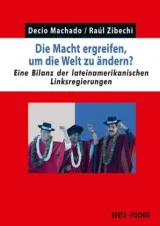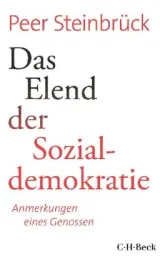Ein kurzer Rückblick auf die Einleitung der welthistorischen Rolle des städtischen Bürgertums in der Schweiz, den Niederlanden, England, den USA, Frankreich, Deutschland und Skandinavien seit Beginn der Reformation von 1517, auf die Schlussfolgerungen von Engels und Marx seit 1847 hinsichtlich einer Übergangsetappe zu einem höheren Zivilisationstyp sowie auf die Entwicklung der Volksrepublik China lässt die im Titel der vorliegenden Studie aufgeworfene Überlegung aufkommen: Bewirkt das in China bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts konzipierte und bisher gemeisterte Anfangsstadium des Sozialismus nicht eine ähnliche weltgeschichtliche Initialzündung - auf dem Niveau des 21. Jahrhunderts?
Sozialismus (Thema)
Den Emigranten Lenin lernte Angelica Balabanoff 1905 in Zürich kennen. Es war die Zeit, als der spätere Faschistenführer Benito Mussolini noch zum Freundeskreis der in Russland geborenen Führerin der italienischen Sozialisten gehörte. Angelica Balabanoff und Lenin verband ein spannungsvolles Verhältnis. Sie geriet mit ihm nicht zuletzt als Motor der sozialistischen Antikriegsbewegung Europas und als Organisatorin der Zimmerwalder Konferenzen gegen den Ersten Weltkrieg immer wieder aneinander: Sie wollte die Sozialistische Internationale, in deren Büro sie bis 1914 neben Rosa Luxemburg, August Bebel, Jean Jaures und Lenin mitgearbeitet hatte, erneuern, Lenin wollte die Internationale spalten. Die Niederschlagung der ungarischen Revolution im November 1956 veranlasste Angelica Balabanoff, das Schweigen zu brechen.
Hört man den Namen Engels, denkt man an Marx - umgekehrt ist das keineswegs so. Es wird also Zeit, den historischen Blick auf beide Denker gleichermaßen zu richten. Immerhin war Engels nicht nur Marx' wichtigster Gesprächspartner und Coautor, sondern schrieb sogar Artikel unter dessen Namen. Selbst das Kapital konnte nur erscheinen, weil Engels es aus den Manuskripten seines mitten in der Abfassung verstorbenen Freundes zusammenstellte.
Jürgen Herres erzählt anschaulich von den oftmals außergewöhnlichen Umständen dieser politischen wie wissenschaftlichen Zusammenarbeit und Freundschaft.
Der Kapitalismus bedroht zunehmend die Grundlagen unseres Lebens. Eine dauerhafte Problemlösung ist innerhalb dieses Systems nicht möglich. Die existenziellen Bedrohungen entstehen aus den Strukturelementen der kapitalistischen Produktionsweise und können erst mit dem Aufbau einer alternativen Wirtschaft beseitigt werden. Der bloße Ruf nach mehr Staat ist keine ausreichende Lösung. Woraus bestehen die einzelnen Bedrohungen? Welche Faktoren wirken auf ein Ende des Kapitalismus hin? Welche Rolle übernimmt dabei die Digitalisierung? Wie soll angesichts der enttäuschenden Erfahrungen mit dem Realsozialismus die bessere Gesellschaft aussehen?
"Sie wundert mein Optimismus? Ich schlage mich, ganz wie jeder andere Mensch auch, auf die Siegerseite. Der Kapitalismus hat doch nicht die geringste Überlebenshoffnung."
Mit seinen Theaterstücken und Gedichten verstand es Peter Hacks, sich ins gesellschaftliche Leben einzumischen. Aber auch mit Pamphleten, Briefen und Essays meldete sich der Dichter und entschiedene Optimist zu Wort: Er kritisierte Kollegen, polemisierte gegen politische Verzweiflung und trug die Aufklärung auf der Zunge.
Mit dem Erscheinen der Serie Babylon Berlin hat das Interesse nicht nur an Berlin selbst, sondern insgesamt am Jahr 1929 erheblich zugenommen. Die Serie spielt zur Zeit der Ereignisse des "Blutmai", der im Verlauf immer wieder eine Rolle spielt.
Die filmische Aufarbeitung gibt die Tage um den 1. Mai aus Sicht der Berliner Polizei wieder und deutet an, wie planmäßig das gewalttätige Vorgehen gegen die Arbeiter innen war. Das 1931 erschienene Buch Barrikaden am Wedding beschreibt die Ereignisse aus dem Herz des "Roten Wedding" und der Sicht der kämpfenden Arbeiter innen. Schonungslos wird in diesem Tatsachenroman der heroische Widerstand gegen die wütenden Polizeitruppen beschrieben.
Spätestens seit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus sind demokratietheoretische Fragestellungen zu einem zentralen Feld der intellektuellen Auseinandersetzung geworden. Hier gehen die Autoren eine, wenn nicht die entscheidende, Leerstelle linker, marxistischer Theoriebildung an. Über eine Dekonstruktion des Marxismus vornehmlich der II. und III. Internationalen versuchen sie, den Blick freizumachen für eine anti-essenzialistische Konzeption des Sozialen.
Die Dauerkrise der Maduro-Regierung in Venezuela und der Wahlsieg des Rechtsextremisten Bolsonaro in Brasilien sind die deutlichsten Hinweise darauf, dass der Zyklus der fortschrittlichen Regierungen in Lateinamerika an ein Ende gelangt ist. Decio Machado und Raúl Zibechi ziehen Bilanz und analysieren die Politik der Linksregierungen insbesondere in Bolivien, Ecuador und Venezuela. Sie zeigen die Grenzen, Schwächen und Widersprüche des "Progressismo" auf und erörtern, inwiefern sich neue Klassenverhältnisse herausgebildet haben. Zudem fragen sie, welche alternativen Wege zur emanzipatorischen Transformation es geben könnte, wobei sie von der Zentralität popularer Bewegungen ausgehen.
Aristokratin, Kommunistin, Katholikin, unbeugsame Nazigegnerin und Exilantin: Hermynia Zur Mühlen wurde 1883 in Wien als Gräfin Folliot de Crenneville geboren und starb 1951 im englischen Exil. Geschätzt von Joseph Roth und Karl Kraus, war sie eine Ausnahmeerscheinung der deutschsprachigen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit ihren proletarischen Märchen hat sie ein eigenes Genre erfunden, darüber hinaus war sie eine politische Erzählerin und Publizistin von Rang.
Die Sozialdemokratie steckt in einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. Bei den letzten Bundestagswahlen musste die SPD eine herbe Schlappe einstecken. Aber nicht nur sie, sondern fast alle sozialdemokratischen Parteien in Europa sacken in der Wählergunst immer weiter nach unten ab. Was läuft da schief? Peer Steinbrück, streitbarer Sozialdemokrat und Kanzlerkandidat der SPD 2013, sucht in seinen Anmerkungen eines Genossen nach Wegen zu einer erneuerten Sozialdemokratie und nennt mit klarer Kante seine Stichworte: Einhegung des digitalen Kapitalismus, Kampf gegen die wachsende Vermögensungleichheit, Mut zu einer neuen Debatte über Identitätspolitik, Vertiefung der Europäischen Union, mehr Engagement für junge Wähler.