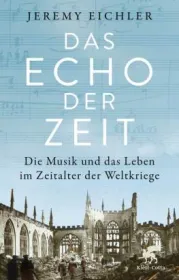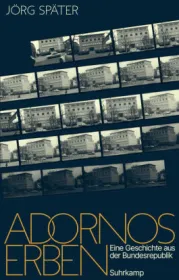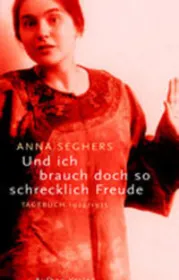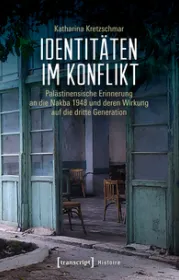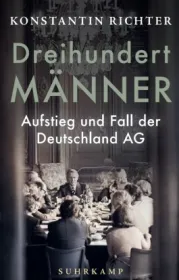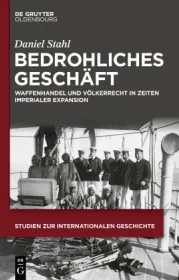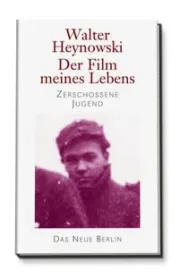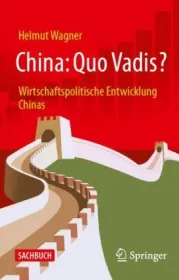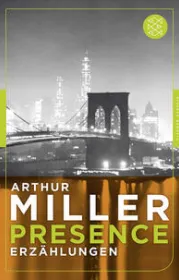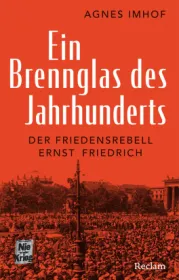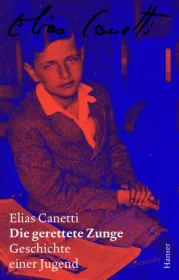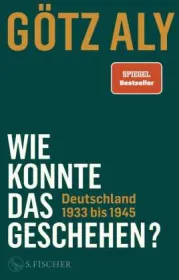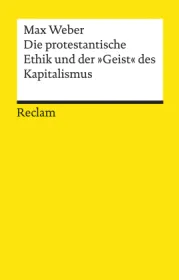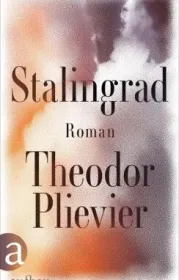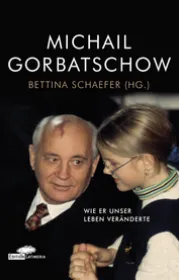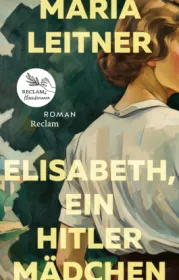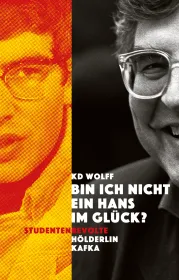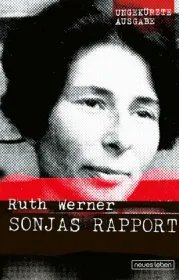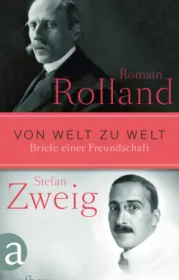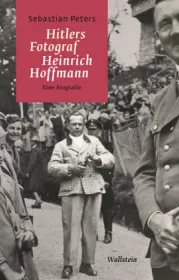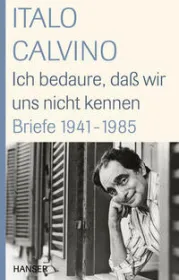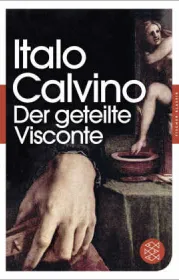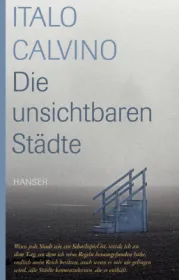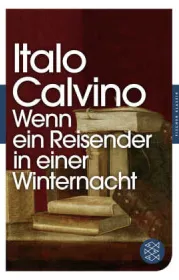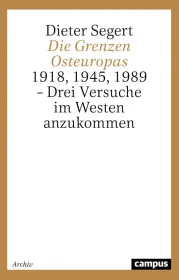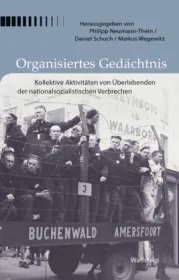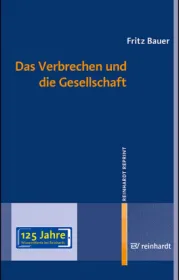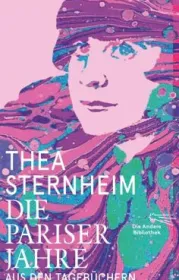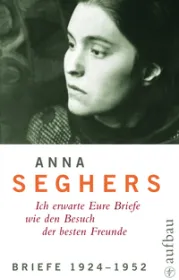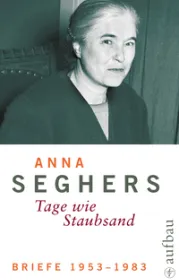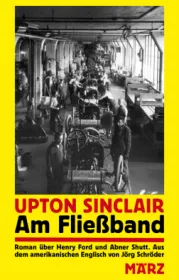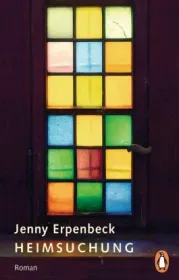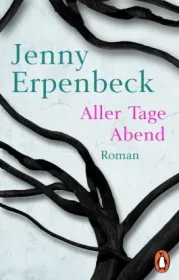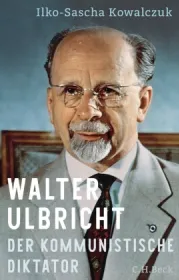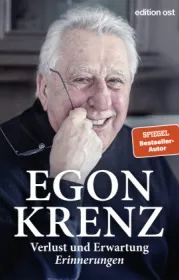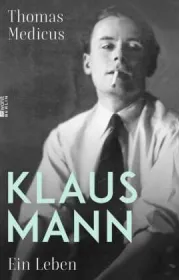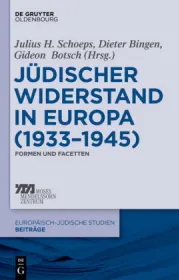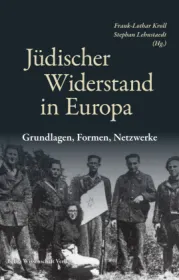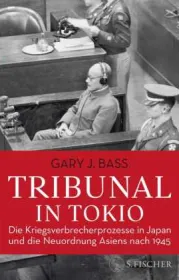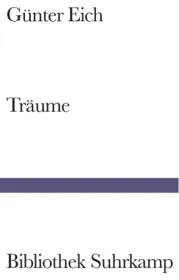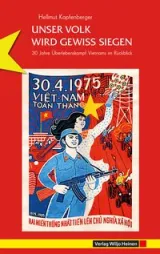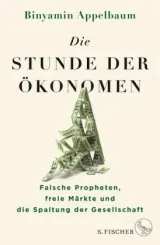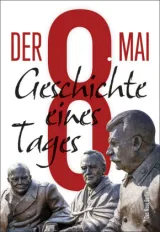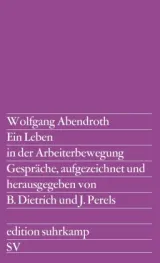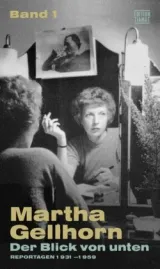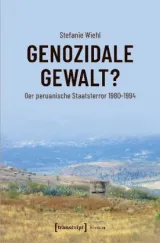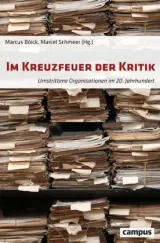Zehn Tage nachdem Siegfried Unseld am 1. April 1959 die Leitung des Suhrkamp Verlags übernommen hat, reist er nach Ost-Berlin, um Brechts Witwe Helene Weigel zu besuchen. Zurückgekehrt, diktiert er den ersten der von ihm selbst so genannten Reiseberichte.
In über 1500 Berichten hat er bis zu seinem Tod 2002 die für ihn und seine Mitarbeiter wesentlichen Resultate seiner Gespräche festgehalten. Die Weitergabe an Personen außer Haus war streng verpönt. Zum 70-jährigen Verlagsjubiläum wird das Betriebsgeheimnis nun gelüftet.
20. Jahrhundert (Thema)
"Ungeachtet der Schwierigkeiten und Entbehrungen wird unser Volk gewiss den Sieg davontragen", schrieb Ho Chi Minh in seinem Testament am 10. Mai 1969. Sechs Jahre später traf seine Vorhersage ein. "Saigon ist frei!" war der Jubelruf an jenem 30.April/1. Mai 1975, als Vietnams Kampf um Unabhängigkeit und Freiheit unter dem Beifall von Millionen Menschen auf allen Erdteilen mit einer weltweit Aufsehen erregenden Offensive seiner Volksarmee endete. Ein Krieg mit Millionen Toten, mit unfassbarer Grausamkeit von den imperialistischen Militärs geführt - und doch für sie ungewinnbar.
Was wäre aus Vietnam und seinen Nachbarn geworden, hätte es den Ho-Chi-Minh-Pfad zu Lande und, kaum bekannt, ab 1961 auch zu Wasser nicht gegeben? Am 19. Mai 1959, dem 69. Geburtstag Ho Chi Minhs, wurde das Projekt der Strategischen Militärtransporttrasse Truong Son geboren. Innerhalb von 16 Jahren entwickelte sich aus den allerersten Schritten einer der entscheidenden Faktoren für die Niederlage der USA. Hellmut Kapfenberger war zu Kriegszeiten und auch danach Korrespondent für DDR-Medien in Vietnam.
Als die Ökonomen die Weltbühne betraten. Binyamin Appelbaum legt eine originelle Ideengeschichte und ein unvergessliches Porträt der Wirtschafts-Wissenschaftler vor, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts zum weltweiten Aufstieg des Neo-Liberalismus beigetragen haben.
Sie waren die Vertreter des deregulierten Marktes: Milton Friedman mit seinen libertären Idealen, Arthur Laffer, dessen Kurve auf einer Cocktailserviette dazu beitrug, Steuersenkungen zu einem wesentlichen Bestandteil konservativer Wirtschaftspolitik zu machen, oder Thomas Schelling, der dem menschlichen Leben einen monetären Wert beimessen wollte.
Ihre Grundüberzeugung? Die Regierungen sollten aufhören zu versuchen, die Wirtschaft zu steuern.
Der 8. Mai 1945 - ein welthistorischer Augenblick. Dieses Buch lässt den Tag - seine Vorgeschichte, den Ablauf, die Stunde der Kapitulationserklärung - in einer vielstimmigen Erzählung lebendig werden. Es führt in das gleichzeitige Geschehen an verschiedenen Orten und versammelt und verarbeitet authentische Aussagen unterschiedlicher Akteure und lässt somit teilhaben am Erleben Betroffener und Beteiligter. Auf "höchster" Ebene - was machen Stalin, Churchill, Truman? Was Keitel, Schukow, Eisenhower? Die Erzählung führt aber auch zu vielen anderen, etwa zu der jungen Berlinerin, der ein sowjetischer Offizier einen Stoffballen auf den Tisch wirft und verlangt, dass sie über Nacht eine amerikanische Flagge zur Siegesfeier näht. Oder zu dem Deutschen, der als Leutnant der Roten Armee in seine zerstörte Heimatstadt Berlin einzieht.
"Inhalt: Leben ohne Poesie; Was soll ich dazu sagen?; Die offenen Geheimnisse der Technokratie; Die Reise nach La Défense; Blaues Gedicht; Die Geborgenheit unter der Schädeldecke; Jemand anderer: Hermann Lenz; Eine Zwischenbemerkung über die Angst; Die Sinnlosigkeit und das Glück."
In den Gesprächen mit Wolfgang Abendroth, einem aktiv und unmittelbar Beteiligten, wird die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung seit der Weimarer Republik über die Zeit des Faschismus bis in die Epoche der Bundesrepublik nachgezeichnet. Die Stationen der Lebensgeschichte Abendroths bilden den Leitfaden für die Darstellung und Erörterung objektiver politischer Entwicklungen, insbesondere innerhalb der Linken. Einer, der dabei gewesen ist, rekonstruiert die Etappen der deutschen Arbeiterbewegung, die sie prägenden Kontroversen, Hoffnungen und Niederlagen.
Martha Gellhorn ist eine Legende, denn sie berichtete über 60 Jahre hinweg aus Krisen- und Kriegsgebieten für alle möglichen Zeitungen und war ihr Leben lang unterwegs. Sie besuchte sie das republikanische Spanien und Deutschland in Trümmern. Ihre Kriegsreportagen machten sie berühmt. Hier nun versammelt "eine der klügsten und eloquentesten Zeuginnen des 20. Jahrhunderts", wie Bill Buford sie nannte, Reportagen, die in Friedenszeiten entstanden sind. Reportagen, in denen sie den Zustand und die Psychologie eines Landes zu entschlüsseln sucht.
Mehrere tausend Verschwundene, über einhundert Massaker sowie unzählige Fälle von Folter und Vergewaltigung zählen zur Bilanz des peruanischen Staates in seinem Krieg gegen den "Leuchtenden Pfad" (1980-1994). Die staatliche Intervention traf aber nicht nur die maoistischen Aufständischen, sondern mehrheitlich die indigene Bevölkerung - besonders im Anden-Departement Ayacucho. Stefanie Wiehl zeichnet nach, wie diese Region zu einem Gewaltraum wurde. Ausgehend von der Hypothese genozidaler Gewalt wendet sie sich den in diesem Kontext bisher vernachlässigten Aspekten staatlicher Gewalt zu.
Ob Gewerkschaften, Unternehmen oder Parteien: Organisationen prägten die Geschichte des 20. Jahrhunderts ganz maßgeblich. Daher ist die Beschäftigung mit diesen - oftmals umstrittenen - Gebilden und ihren Hervorbringungen einer der Schwerpunkte zeithistorischer Forschung. Gerade in Deutschland erlebte die Geschichtsschreibung zu Organisationen durch die Aufarbeitung möglicher NS-Kontinuitäten in Behörden oder Ministerien einen bemerkenswerten Boom, dem bisher allerdings eine übergreifende Selbstreflexion fehlt.