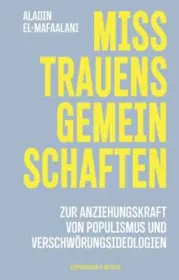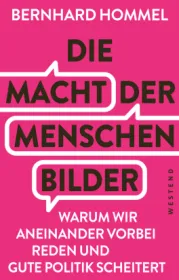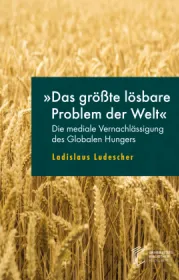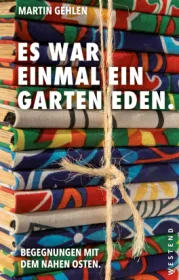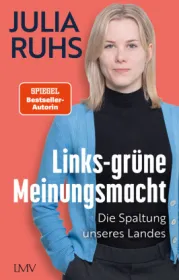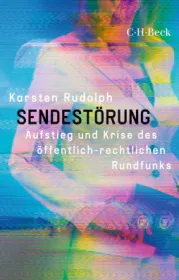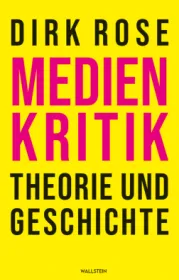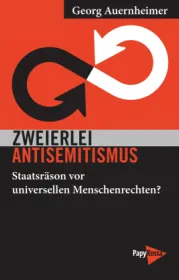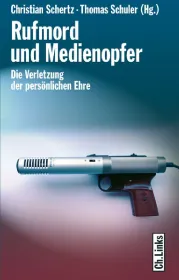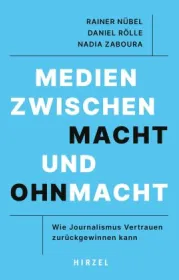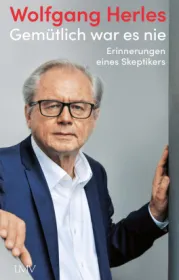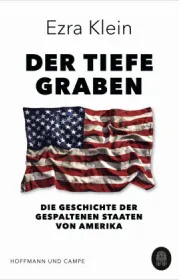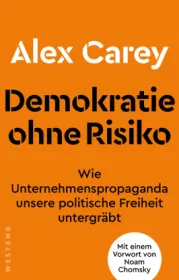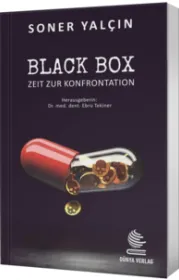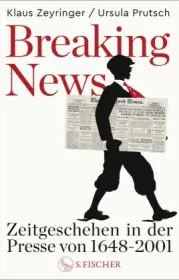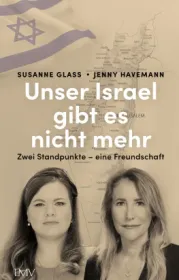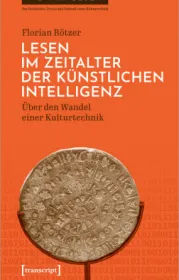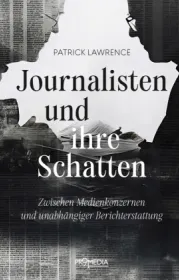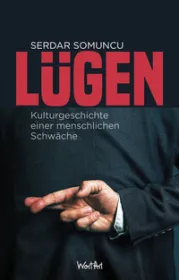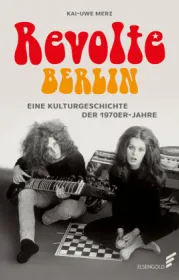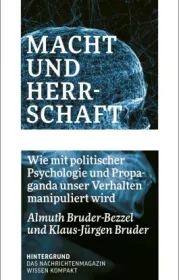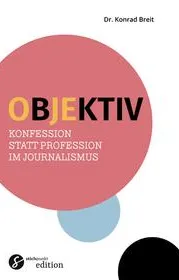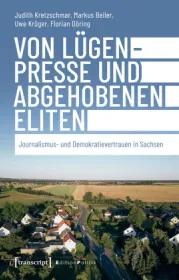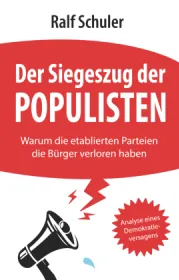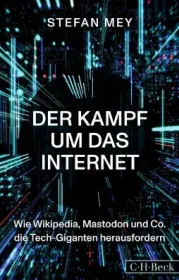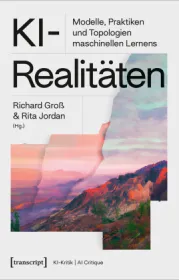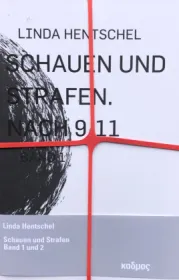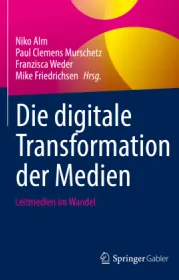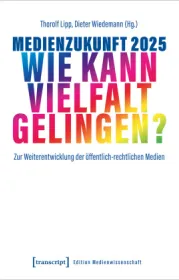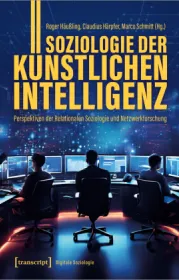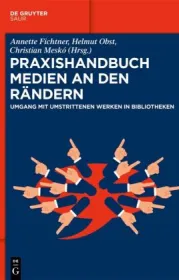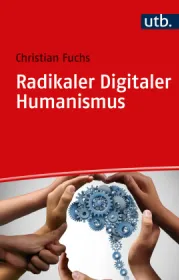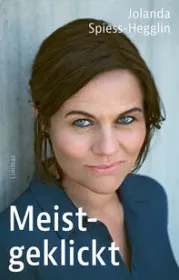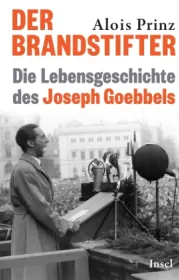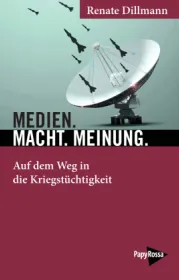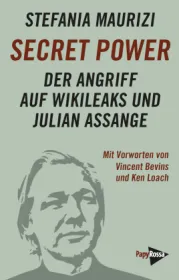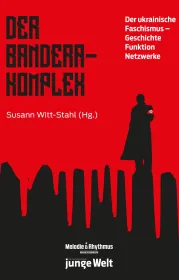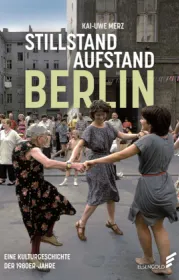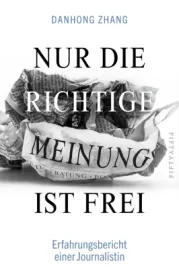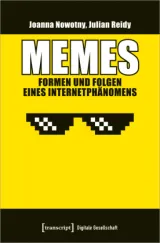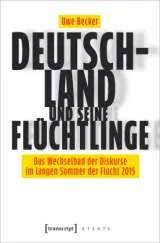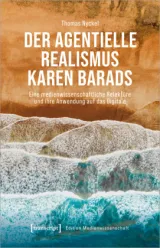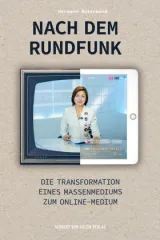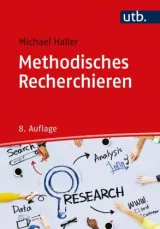Memes dienen nicht nur der popkulturellen Unterhaltung oder der Kunst, sie werden auch in der Politik, in lokalen und internationalen Wahlkämpfen oder auf Demonstrationen verwendet. In ihrer typischsten Form sind sie Text-Bild-Gefüge, die sich digital mit viraler Geschwindigkeit verbreiten und transformieren. Joanna Nowotny und Julian Reidy nehmen sich dieses Internetphänomens aus kulturwissenschaftlicher Perspektive an.
Medien (Thema)
Die Aufnahme Tausender »Fremder« im Sommer 2015 wurde medial euphorisiert als »deutsches Wunder« beschrieben. Die Geflüchteten selbst tauchten in dieser Perspektive kaum auf. Dem Narrativ der »Willkommenskultur« folgte ein Wechselbad der Diskurse hin zum drohenden Staatsversagen, der Belastungsgrenze oder sexueller Übergriffe. Dabei ging es primär um die Befindlichkeit der Nation und der »Flüchtling« wurde zum Verursacher nationaler Bedrängnisse. Uwe Becker analysiert diese Diskurse und zeichnet nach, welche Narrative sich im »langen Sommer der Flucht« aufgebaut haben. Dabei zeigt er auf, wie sie im kollektiven Gedächtnis ruhen, jederzeit aktivierbar sind und bis heute eine restriktive Flüchtlingspolitik legitimieren.
Die Folgen des Klimawandels sind nicht mehr zu übersehen - und in Europa hält sich hartnäckig die Angst, dass seine verheerenden Auswirkungen in naher Zukunft eine gigantische Flüchtlingswelle anstoßen werden. Aber was wissen wir wirklich über die Auswirkungen der Erderwärmung auf Flucht und Migration? Benjamin Schraven erläutert, warum europäische Befürchtungen vor Millionen von »Klimaflüchtlingen« aus Teilen Afrikas oder Asiens viel mehr einer verzerrten Wahrnehmung als einer tatsächlichen Problemanalyse entspringen. Er stellt jedoch klar: Die Klimamigration ist ein virulentes Thema, mit dem Politik, Gesellschaft und Medien einen anderen Umgang finden müssen.
Nicht erst seit dem Skandal beim RBB und den beim NDR sichtbaren Problemen ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen ins Gerede gekommen. Seit Jahren wird der Verlust an Glaubwürdigkeit sowohl der Sender und deren Repräsentanten als auch der dort tätigen Journalisten konstatiert. Die Autoren, einst selbst aktive Fernsehjournalisten, unternehmen eine kritische Bestandsaufnahme und spiegeln den Zustand und die Reflexion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Gesellschaft. Einige von ihnen sind der Überzeugung, dass die Art und Weise der Übernahme des Fernsehens und Rundfunks der DDR zu einer verhängnisvollen Entwicklung geführt habe. Mit dem Überstülpen der Weststrukturen zogen Prinzipien und Haltungen ein, an denen heute das Mediensystem erkennbar krankt.
Mit dem agentiellen Realismus hat Karen Barad eine der einflussreichsten Theorien des neuen Materialismus vorgelegt. In einer akribischen Relektüre entspinnt dieser Band Barads Programm behutsam und mit rigoroser Aufmerksamkeit für feine Details. Die Untersuchung bezieht - anders als bisherige Arbeiten - das baradsche Oeuvre in seiner Breite ein und eröffnet neue Zugänge für Auseinandersetzungen mit der agentiell-realistischen Theorie und der diffraktiven Methodologie. Damit werden nicht nur Kennerinnen des agentiellen Realismus angesprochen, sondern auch Interessierte ohne Vorkenntnisse an das Thema herangeführt.
Ist Deep Journalism die Antwort auf die Erosion der Qualitätsmedien? Sparrunden und Stellenabbau haben nahezu alle Medienhäuser erfasst, immer weniger Journalisten haben in kürzerer Zeit immer mehr Ausspielkanäle zu bestücken. Journalistische Generalisten kommen kaum unter die Oberfläche, und Algorithmen befeuern Zuspitzung und Emotionalität. Gibt es Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken? Deep Journalism ist der Gegenpol: Redaktionelle Experten-Teams gehen in die Tiefe, die Sach- und Domänenkompetenz der Redaktionen wird mit Vertikalisierung und neuen Produkten (Rebundling) gestärkt.
Medien haben ihre geschichtliche Zeit. Die Massenmedien, darunter der Rundfunk, also Radio und Fernsehen, haben den Zenit ihrer Bedeutung für die private und öffentliche Kommunikation überschritten. Die Praxis dieser linearen Medien genügt den Anforderungen einer Netzwerkgesellschaft nicht. Das Buch zielt darauf ab, Interventionsmöglichkeiten aufzudecken, die eine verspätete Transformation des Rundfunks dennoch möglich machen.
Recherchieren war noch nie so wichtig - und so kompliziert - wie im Zeitalter des Internets. Alles Wissen dieser Welt scheint verfügbar. Doch was ist tatsächlich neu, was zuverlässig? Der Schlüssel heißt "methodisches Recherchieren" und findet sich in diesem für Studierende komplett überarbeiteten Klassiker der Journalistenausbildung.Die grundlegenden Methoden und Theorien des Recherchierens in einem Band, unabhängig von Kanal oder Medium und zeitlos gültig.
In unserem Alltag müssen wir immer wieder Entscheidungen zu Themen treffen, bei denen wir keine Experten sind. Wir können schnell auf viele Informationen im Internet zu greifen, doch müssen wir auch lernen, mit diesen richtig umzugehen. Dieses Buch hilft uns zu verstehen, wie wir Informationen suchen, bewerten und integrieren können und welche Rolle die Persönlichkeit, Emotion und persönliche Einstellungen bei der Informationsverarbeitung spielen. Neben aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie liefert er praktische Beispiele und Tipps.
"Wissen Sie, was Ihr Kind auf seinem Smartphone sieht?" Diese Frage stellt Silke Müller ahnungslosen Eltern auf Infoveranstaltungen ihrer Schule. Die Fotos, Sticker und Videos, die sie dann zeigt, sind so verstörend, dass kaum jemand hinsehen kann.
Die meisten Eltern gehen davon aus, Medien-Erziehung bedeutet, die Bildschirmzeit zu begrenzen - und haben keine Ahnung, dass schon Kinder Bilder bestialischer Tierquälereien, Kriegsverbrechen und sexueller Gewalt sehen. Verschickt im Klassenchat. Mit dramatischen Auswirkungen auf ihre Psyche.