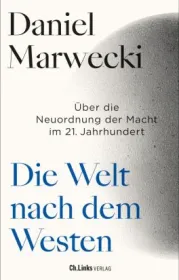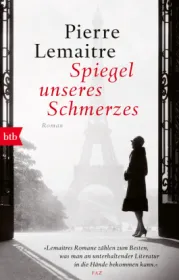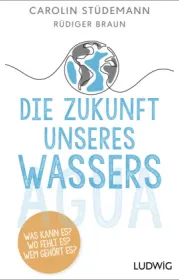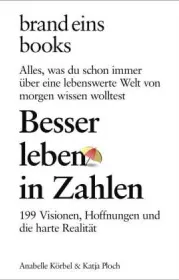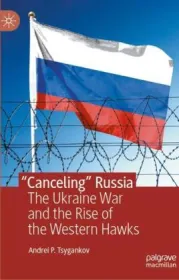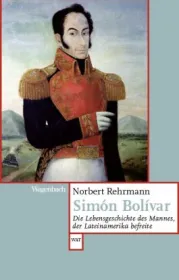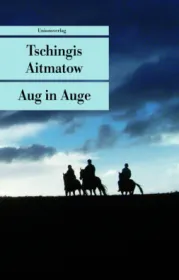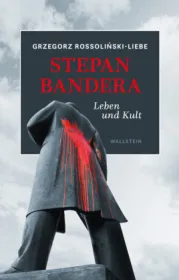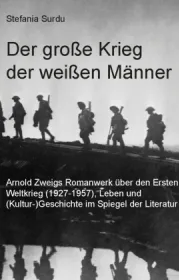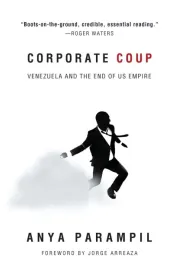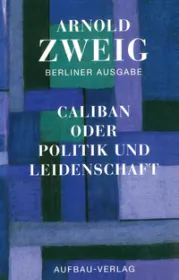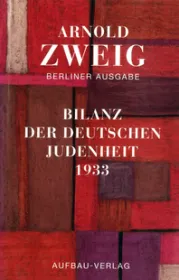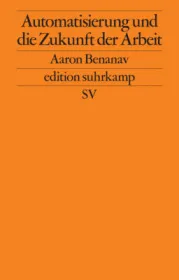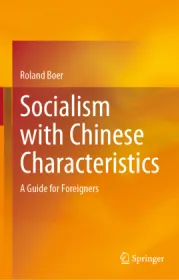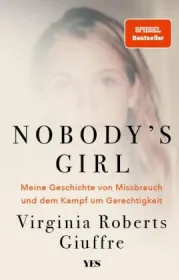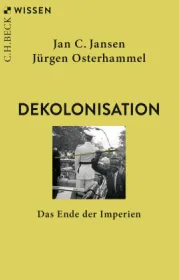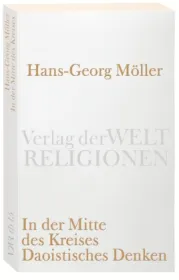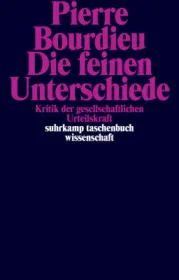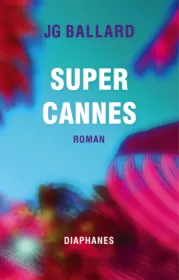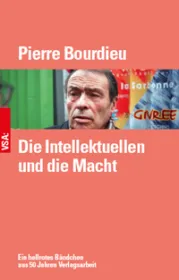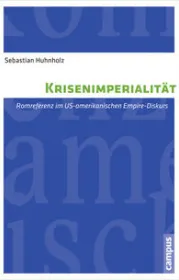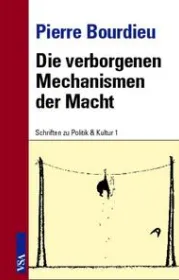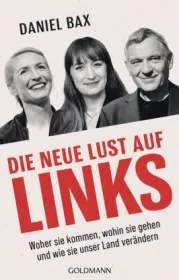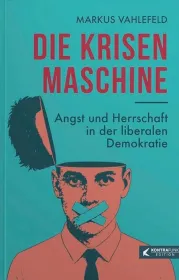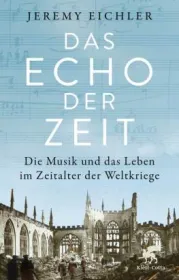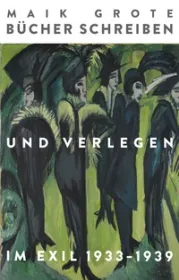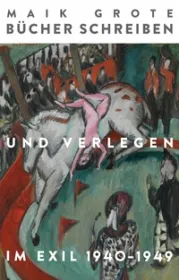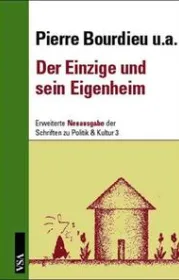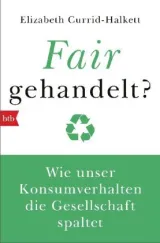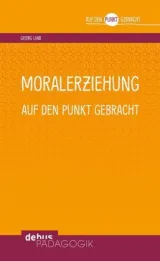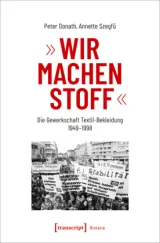Unter geändertem Titel wird hier die erstmals 1978 erschienene Studie des Theologen Heinrich Missalla über die "Kirchliche Kriegshilfe" des Deutschen Caritasverbandes im Zweiten Weltkrieg neu ediert. Im Zentrum der untersuchten Unternehmung stand die Bereitstellung von Schriftgut für die Militärseelsorge. In einem Dankschreiben vom 17.8.1940 erklärte Caritas-Präsident Benedikt Kreutz zu dieser Arbeit: "Es wird unser Bestreben sein, den Wehrwillen und den sieghaften Glauben unserer mutigen Truppe auch fernerhin zu stärken, indem wir gerade sie mit einem Lesestoff versorgen, der aus den unversiegbaren Quellen religiöser Tiefe, inniger Volksverbundenheit und letzter, nationaler Verpflichtung schöpft."
I:DES (Thema)
»Das klügste Buch des Jahres« - The Economist
In den letzten Jahren hat sich eine neue kulturelle Elite gebildet, die sich anders als die Spaß- und Erlebnisgesellschaft der 1990er- und 2000er-Jahre durch »bewussten Konsum« bzw. betonten Konsum-Verzicht vom Rest der Gesellschaft abzuheben versucht. Es geht der sogenannten »aspirational class« dabei um die richtige Entscheidung, nicht um die günstigste oder teuerste Entscheidung. Die promovierte Soziologin und Stadtplanerin Elizabeth Currid-Halkett zeichnet in ihrem vielbeachteten Buch ein eindrucksvolles Bild dieser neuen Elite und argumentiert, dass die ethisch und ökologisch wohlinformierten Lifestyle-Entscheidungen der vermeintlich moralisch Überlegenen die Spaltung der Gesellschaft jedoch nicht verringert oder gar überwinden hilft.
Kultur ist systemrelevant!
Ein Leben ohne Bühne war für den leidenschaftlichen Liedermacher Konstantin Wecker nicht vorstellbar. Was macht es mit so einem Menschen, wenn plötzlich alle Konzerte abgesagt werden müssen?
In diesem Buch berichtet er von mehr als von seinen persönlichen Erfahrungen in der Covid-19-Pandemie. Die Krisenzeit ist eine Zeit, das Wertefundament unserer Gesellschaft zu hinterfragen. Was wurde aus der neuen Solidarität, über die in den ersten Wochen der Pandemie so viel zu hören war? Und warum galten Kunst- und Kulturschaffende plötzlich als nicht systemrelevant, während die Industrie Steuergeschenke erhielt?
»Erstürmt die Höhen der Kultur!« Mit diesem Anspruch an die Bevölkerung erfuhr die gesamte Kulturwelt der DDR eine hohe staatliche Förderung. Ein engmaschiges System der Kulturvermittlung von den Kindergärten über Schulen und Jugendorganisationen bis zu den Betrieben wurde etabliert. Inwieweit gelang es, Ziele einer »Kultur für alle und von allen« umzusetzen? Verhinderte die ideologische Funktionalisierung kulturelle Selbstbildungsprozesse? Und wie viel Zwang und Freiraum boten Künste und kulturelle Arbeit?
Im Jahr 2021 sind Self-Tracking-Technologien ein fester Bestandteil gesellschaftlicher Alltagspraxen. In der Gegenwart von Corona-Tracing-Apps und Social Scoring erinnert kaum noch etwas an die frühen Prototypen der technologieenthusiastischen Self-Trackerinnen. Thorben Mämecke wirft einen Blick auf die intensiven Beziehungen, die diese Pionierprojekte untereinander gepflegt haben, und zeichnet dabei die sie bestimmenden Phänomene nach: angefangen bei der Ellenbogenmentalität der prekären Kreativökonomie bis zum progressiven Selbstbestimmtheitsstreben von Self-Trackerinnen mit chronischen Erkrankungen.
Am 9. Januar 1974 reiste Joseph Beuys zusammen mit Klaus Staeck und Gerhard Steidl zum ersten Mal nach Amerika. Diese Reise war eine bis ins Detail geplante Performance in Flugzeugen, Taxen, Hotels, Universitäten und Galerien, die umfassend mit der Kamera dokumentiert wurde. Erste Station war die New School in New York, wo Beuys in einem völlig überfüllten Saal eine Lecture hielt, die auch von Künstlern wie Claes Oldenburg, Lil Picard und Al Hansen besucht wurde. Stundenlang erklärte Beuys geduldig sein Modell der Sozialen Plastik und zeichnete drei große Schultafeln voll, um sie am Ende zum Erstaunen vieler wieder auszuwischen. In Chicago kommt es zu einer spontanen Aktion: Als er zufällig am Biograph-Kino vorbeikommt, erinnert sich Beuys an Leben und Sterben des amerikanischen Gangsters John Dillinger und spielt Flucht und Erschießung nach. Anschließend führt die Reise nach Minneapolis, wo Beuys weitere Lectures hielt, Pressekonferenzen gab und ausgedehnte Spaziergänge im Kaufhaus Dayton's unternahm.
Alle Menschen haben hohe moralische Ideale. Aber warum gibt es dann so viel Böses in der Welt, so viel Gewalt und Krieg, so viel Betrug und Korruption? Der Autor zeigt, dass es den Menschen nicht an Idealen, Werten oder Orientierung fehlt, sondern an Moralkompetenz. Das ist die Fähigkeit, Probleme und Konflikte friedlich, nur durch offenes Denken und freie Diskussion mit anderen zu lösen, statt durch Gewalt, Betrug und andere unmoralische Mittel. Anhand der Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion (KMDD) wird erläutert, wie man Moralkompetenz in der Schule und anderswo effektiv und verantwortungsvoll fördern kann.
Moral tut not! Aber welche Moral? Alle wollen das Gute, wie bereits Sokrates vor mehr als zwei tausend Jahren lehrte. Wir müssen sie nicht erst vermitteln. Aber oft mangelt es daran zu erkennen, was das Richtige ist, also an Moralkompetenz. Das bestätigt auch Linds Forschung. In diesem Buch zeigt er auf, was Moralkompetenz ist und wie wir sie effektiv und mit wenig Aufwand bei allen Menschen fördern können. "Reform-müde, aber dennoch engagierte Pädagogen sollten Linds Angebot annehmen und versuchen, damit moralisch-demokratische Kompetenz zu fördern." - Werner Henk, ehemaliger Leiter der Johann-Gutenberg-Realschule in Langenfeld. "Ich kenne nur wenige Wissenschaftler, die so lange und so fokussiert eine gesellschaftlich sozial so wichtige Frage verfolgt haben - eine große Lebensleistung." - Dr. Hans Brügelmann, Professor em. für Grundschulbildung Universität Siegen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bezeichnet »Klassismus« als »die vergessene Benachteiligung« und schlägt vor, dass »Klassismus ein eigenständiges Diskriminierungsmerkmal sein sollte«. Mit diesem Buch möchten die Autor*innen und Herausgeber einen Beitrag dazu leisten, die strukturelle Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft stärker sichtbar zu machen. Das geschieht vor der Kulisse wissenschaftlicher und hochschulischer Wirkungsstätten als Orten mit Bildungsauftrag bei gleichzeitig beschränktem Zugang. 16 Beiträge zeigen individuelle Erfahrungshorizonte, Bewältigungsstrategien und Lösungsansätze zum Umgang mit klassistischer Diskriminierung und Unterdrückung.
Die Textil- und Bekleidungsindustrie war nach Kriegsende die größte Konsumgüterbranche und die erste Industrie, die ihre Produktion in Länder mit niedrigen Lohn- und Sozialstandards verlagerte. Trotz dieser Herausforderungen organisierte die Gewerkschaft Textil-Bekleidung über 49 Jahre hinweg erfolgreich ihre mehrheitlich weiblichen Beschäftigten. Peter Donath und Annette Szegfü dokumentieren erstmals, wie es der Gewerkschaft unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen gelang, Tarifverträge mit eigenen Akzenten durchzusetzen und gleichzeitig zur anerkannten Sprecherin 'ihrer' Branchen zu werden.