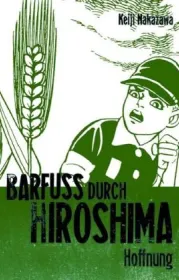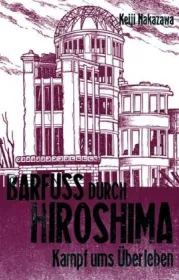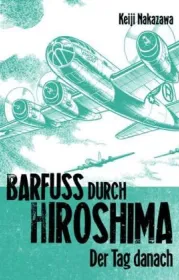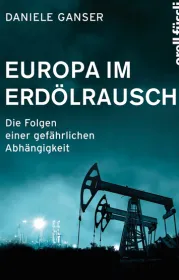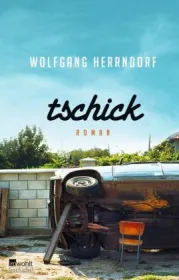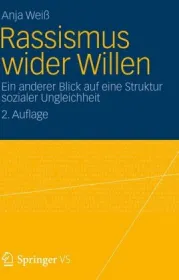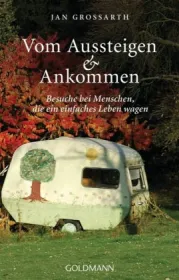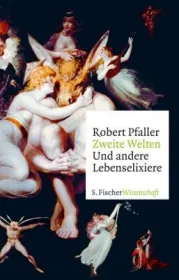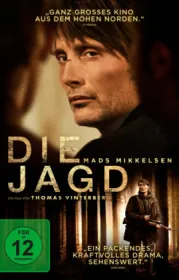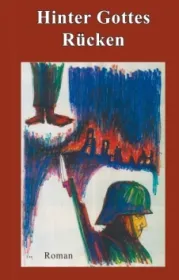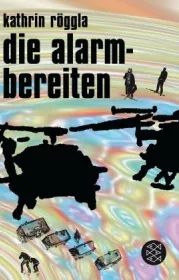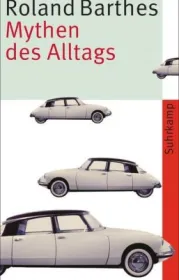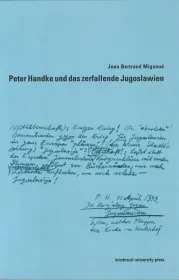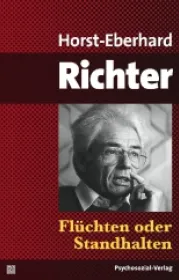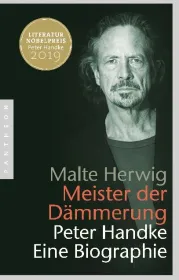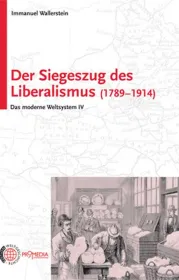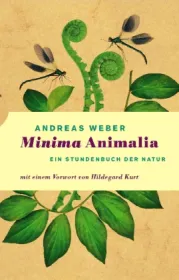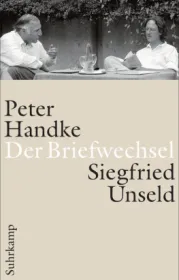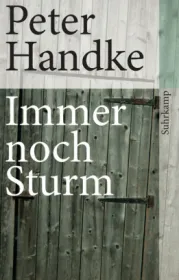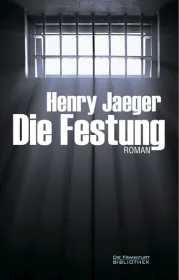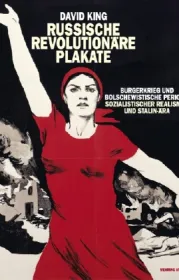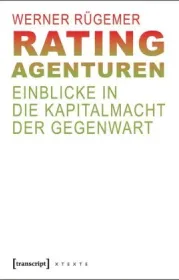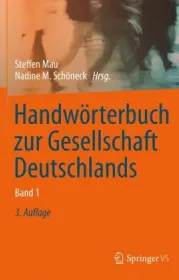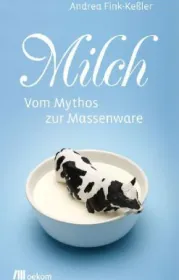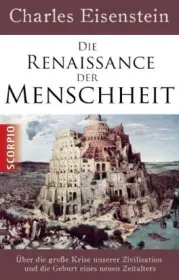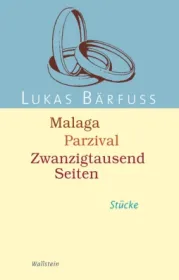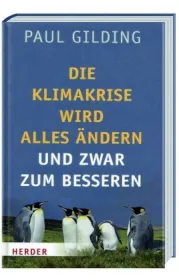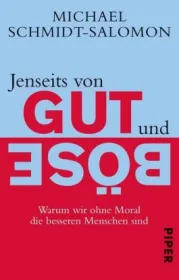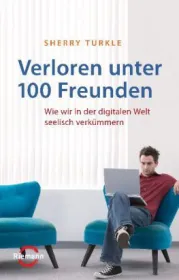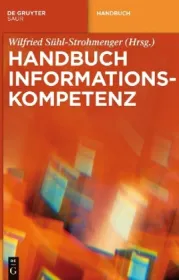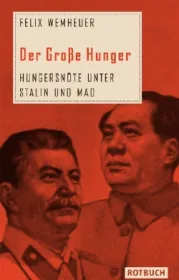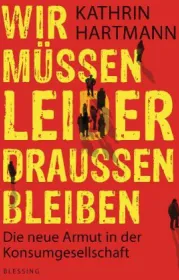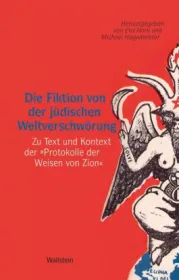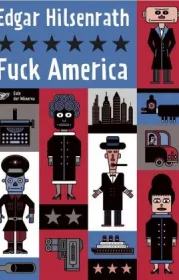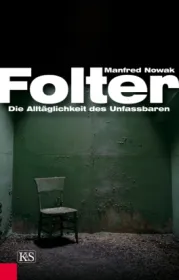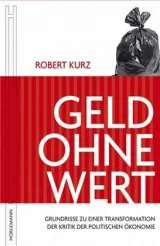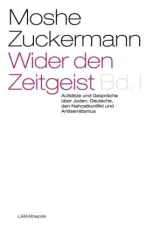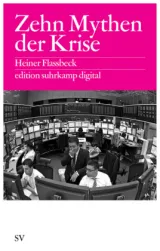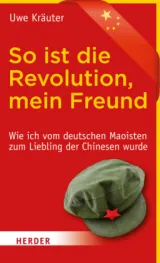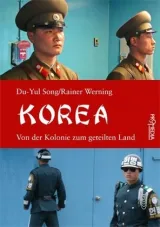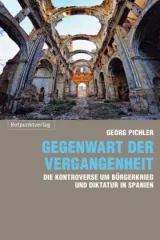Eine Krankenschwester, ein Sozialarbeiter, ein Banker befinden: Ich möchte meine Arbeit gern gut machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Was ist los mit einer Gesellschaft, in der man es sich nicht leisten kann, gute Arbeit zu machen?
Neu 2012 (Thema)
Der vorliegende Essay stellt den Versuch dar, verschiedene Argumentationsstränge einer grundlegenden Neuinterpretation der Kritik der politischen Ökonomie in einer Art Übersicht oder Gesamtschau vorzustellen.
Der vorliegende Band mit Aufsätzen und Gesprächen enthält Heterogenes, und doch sind die darin versammelten Texte alle aufeinander bezogen. Es geht um Deutsche und Juden, um Israel und den Zionismus, um den Palästina-Konflikt sowie um den Begriff des Antisemitismus. Was die Beiträge kennzeichnet, ist ein sie determinierender übergreifender Kontext die Auseinandersetzung mit den politischen, historischen und ideologischen Dimensionen einer von der Vergangenheit durchtränkten Gegenwart, die ihrerseits Bild und Deutung der Vergangenheit in entscheidender Weise prägt.
Die Liste rechtsextremer Überfälle, Morde und Anschläge in Deutschland ist lang. Doch bislang hieß das Prinzip Verdrängung. Und ein gängiges Klischee dazu lautete: Neonazis terrorisieren allenfalls die ostdeutsche Provinz.
Die Turbulenzen um Banken, Staatsschulden und den Euro verwirren Politiker, Journalisten und Bürger es hat den Anschein, als sei Hysterie ein Rohstoff der Kasinoökonomie. Dabei sind viele Mythen in Umlauf: Wird Deutschland zum Zahlmeister Europas?
Dass sich im Übergang von parlamentarischer Demokratie zur medialisierten Postdemokratie und vom Kapitalismus der Realwirtschaft zum neoliberalen Finanzkapitalismus und vor allem in der Komplizenschaft beider Protagonisten ein Weg zu einer unmenschlichen Gesellschaft auftut, haben mittlerweile nicht nur jene erkannt, die schon immer dagegen waren. Diese Entwicklung wird verkörpert in Erscheinungen wie Berlusconi, Sarkozy oder Guttenberg, sie ist aber auch spürbar im eigenen Alltag: In der rücksichtslosen Aneignung von Architektur und Landschaft durch die Profi tinteressen der Wirtschaft und in der Arroganz der Macht der Politik gegenüber den Interessen der einzelnen. Sie ist spürbar in der immer absurderen Ungleichverteilung von Chancen und Reichtum, und äußert sich schließlich auch in einem rapiden Verfall der (politischen) Kultur diese Entwicklung hat auch die bürgerliche Mitte tief gespalten: Dem Citoyen wird unerträglich, was sich der Bourgeois vielleicht gerade noch gefallen lässt.
In den frühen 70er Jahren floh der deutsche Maoist Uwe Kräuter, in Deutschland wegen seiner Teilnahme an einer gewalttätigen Demonstration verurteilt, nach China. Schnell fand er im Reich der Mitte, in dem alles so ganz anders ist, seine neue Heimat. Verheiratet mit einem chinesischen Filmstar ist er inzwischen nicht nur der am längsten in China lebende Deutsche, sondern kommt als Unternehmer in Peking zwischen Kapitalismus und Kommunistischer Partei bestens zurecht.
Korea und seine Bevölkerung sind geteilt. Ihre Geschichte kann dennoch nur als gemeinsame geschrieben werden: Von der Kolonisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dem ersten heißen Krieg nach 1945, den geopolitischen Interessen, die den Konflikt geschürt haben, bis zu den Auswirkungen des seit über 60 Jahren anhaltenden Kriegszustandes. Fachkundig haben Rainer Werning und Du-Yul Song eine Historiographie dieses weltpolitischen Brennpunktes geschrieben.
Erinnern, versöhnen, vergessen. Der Streit um Spaniens Geschichte. Von Erich Hackl in Junge Welt vom 11.04.2013. "Man ist geneigt, Georg Pichler Etikettenschwindel vorzuwerfen, wenn er im Untertitel seines Buches »Gegenwart der Vergangenheit« behauptet, es handle von der »Kontroverse um Bürgerkrieg und Diktatur in Spanien«.
Klarissa Lueg geht der Frage nach dem Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und der Hierarchie im journalistischen Feld nach. Dabei wird grundsätzlich die Herkunft von ChefredakteurInnen und JournalistenschülerInnen und die Bedeutung dieser sozialen Herkunft für Berufszugang und Positionierungsstrategien erläutert. Es wird deutlich, dass nicht nur die Karrierewege der untersuchten Gruppen selbst ein herkunftsspezifisches Muster aufweisen, sondern dass auch die Verteilung und Zuweisung von Macht im journalistischen Feld eng mit der Herkunft ihrer TrägerInnen verbunden ist.