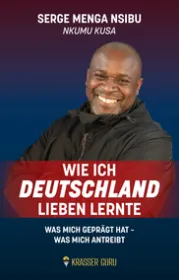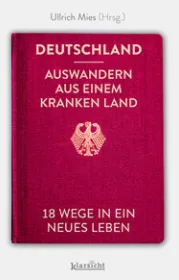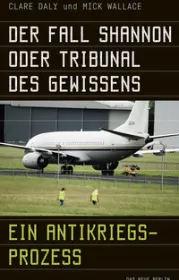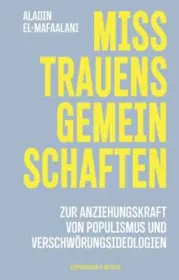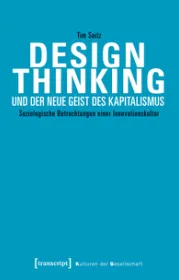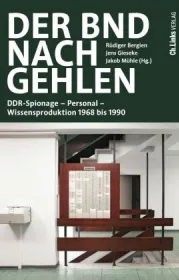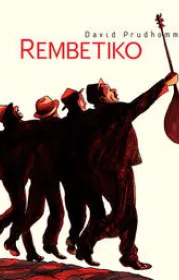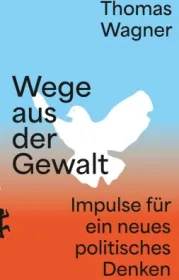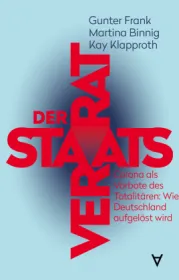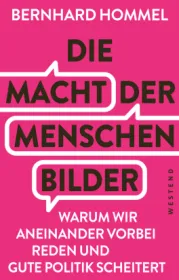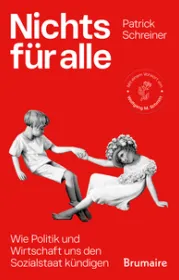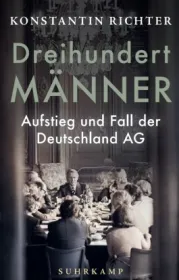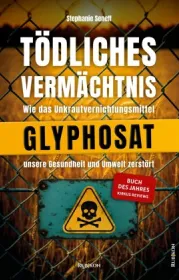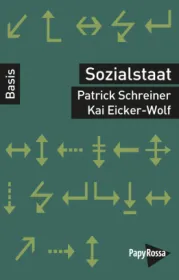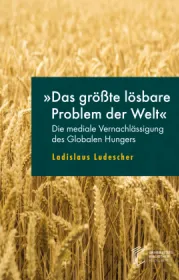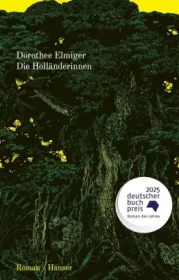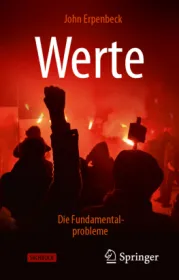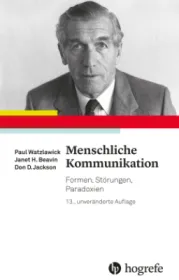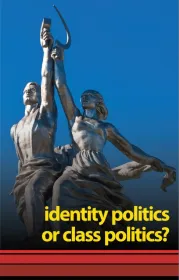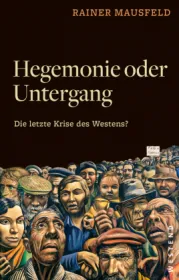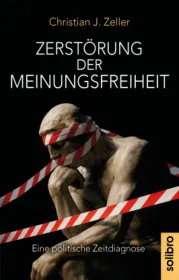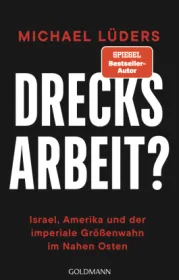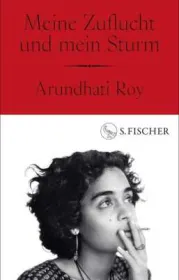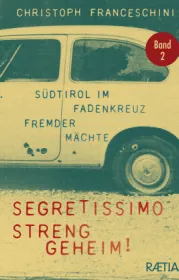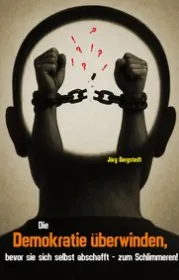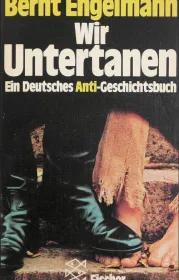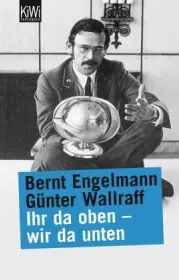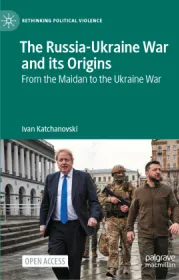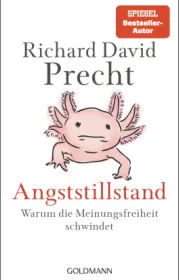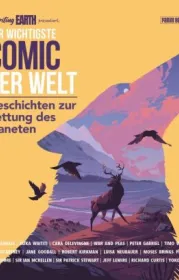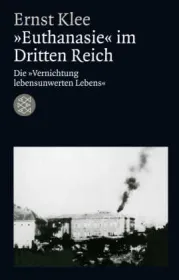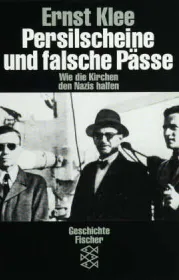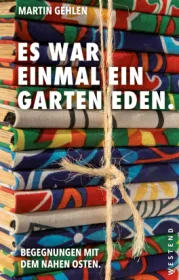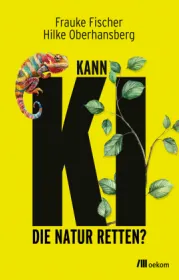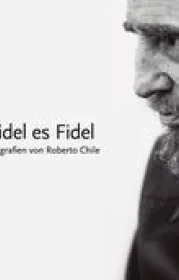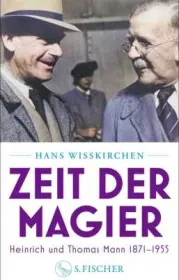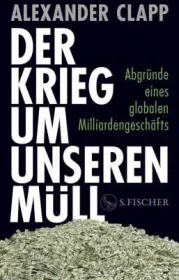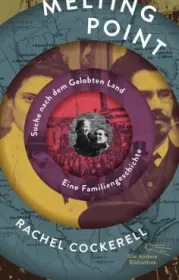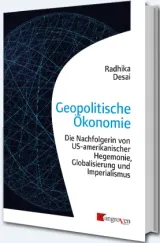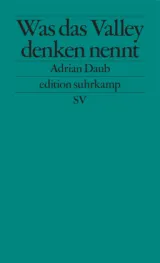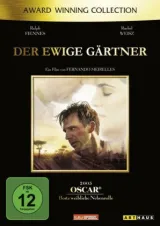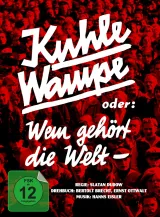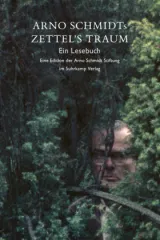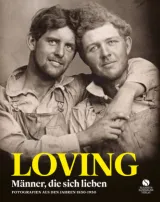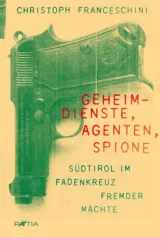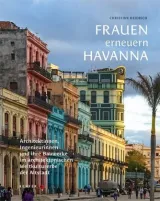"Geopolitische Ökonomie: Die Nachfolgerin von US-amerikanischer Hegemonie, Globalisierung und Imperialismus" interpretiert die historische Entwicklung der multipolaren Weltordnung radikal neu, welche momentan aus dem Staub der Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgeht.Die Autorin, Radhika Desai, übt dazu zunächst eine radikale Kritik an vorhandenen Theoriekonstrukten der US-Hegemonie, der Globalisierung und des Imperialismus, welche die Internationale Politische Ökonomie (IPÖ) und die Internationalen Beziehungen (IB) bis jetzt dominiert haben und nach wie vor dominieren. Dabei enthüllt sie nicht nur ihre ideologischen Ursprünge, sondern auch die aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Versuche der US-Regierung, die Welt durch den Dollar als Weltwährung zu dominieren.
I:VIDEO (Thema)
»Aus Erfahrung gut« – das war ab 1958 der Reklamespruch des Elektrogeräteherstellers AEG. Unternehmen wie Google oder Uber würden mit einem solchen Slogan nie werben, geht es ihnen doch gerade darum, mit der Erfahrung zu brechen und bestehende Geschäftsmodelle aufzumischen: »Disruption«. Wie »Content« oder »Kommunikation« gehört das Konzept zu jenen Motiven, die in Aktionärsprospekten, aber auch in Porträts über Elon Musk, Mark Zuckerberg & Co. häufig bemüht werden. Adrian Daub lehrt in Stanford, kennt die Techbranche also aus nächster Nähe.
In einer globalisierten Welt verkörpert die Hanse das Ideal vom verantwortlich handelnden Unternehmer nicht weniger als die Sehnsucht nach einer starken europäischen Wirtschaftsmacht. Doch was war die Hanse wirklich?
"Sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bey Nacht ruhig schlafen können." Mit diesen berühmten Worten übergibt der Ehrbare Kaufmann Johann Buddenbrook die Geschäfte an seinen Sohn. Nicht erst seit den Zeiten Thomas Manns ist die Hanse ein beliebter Erinnerungsort der Deutschen. Noch jede Generation hat sie als vermeintlich zeitgemäße Antwort für die Herausforderungen ihrer Gegenwart herangezogen. Aktuell erlebt das Ideal des Ehrbaren Kaufmanns eine beispiellose Renaissance. Doch was wissen wir tatsächlich von den hansischen Kaufleuten im Mittelalter?
Justin Quayle, Diplomat im britischen Hochkommissariat in Nairobi, ist ein besonnener Mann, der Konflikten eher aus dem Weg geht und sich mit Hingabe seinem Hobbygarten widmet. Sein beschauliches Leben endet mit dem Tag, an dem seine Frau Tess bestialisch ermordet wird. Auf der Suche nach ihrem Mörder findet Justin heraus, dass Tess den illegalen Machenschaften eines britischen Pharmakonzerns auf der Spur war, in die selbst Vertreter aus höchsten Regierungskreisen verwickelt zu sein scheinen. Je intensiver Quayle die Nachforschungen seiner Frau fortführt, desto mehr bröckelt auch seine diplomatisch-beherrschte Fassade. Er entdeckt nicht nur posthum die grenzenlose Liebe zu seiner Frau, sondern übernimmt auch Stück für Stück ihr leidenschaftliches, bedingungsloses Engagement ...
Berlin 1931. Vater Bönike und sein Sohn sind arbeitslos, wie Millionen andere. Tochter Anni hat zwar eine schlecht bezahlte Anstellung in einer Fabrik, aber als ihr Bruder sich verzweifelt das Leben nimmt, muss die Familie ihre Wohnung räumen. Ihre Zuflucht ist die Gartenkolonie Kuhle Wampe vor den Toren Berlins. Als Anni zu allem Unglück von ihrem Freund Fritz schwanger wird, drängen ihre Eltern sie, sich zu verloben. Doch Fritz weigert sich und Anni muss ihre Familie verlassen. Bei einer Freundin findet sie zunächst Unterschlupf - aber was soll jetzt aus ihr und dem Kind werden?
1970 erschien Arno Schmidts lang erwartetes Hauptwerk Zettel’s Traum. Leser staunten – das Buch hatte über 1300 Seiten im DIN-A3-Format, wog 10 Kilo und war eine Reproduktion von Schmidts Schreibmaschinen-Skript mit handschriftlichen Korrekturen und Einfügungen. Eine unorthodoxe Zeichensetzung und die Abkehr von allen Rechtschreibregeln verstärkten den Eindruck, dass Zettel’s Traum ein unlesbares Buch sei. Trotzdem (oder gerade deswegen) wurde es bald ein Kultbuch und verkaufte sich in fünfzig Jahren etwa 25.000 Mal. Wie viele dieser Exemplare tatsächlich gelesen worden sind, weiß freilich niemand.Das Lesebuch zu Arno Schmidts Zettel's Traum stellt einzelne Szenen aus dem großen Werk zusammen, das halb Roman, halb literarischer Essay zu Werk und Leben Edgar Allan Poes ist.
Es gibt einen unverwechselbaren Blick, den zwei Menschen haben, wenn sie verliebt sind. Und wenn Sie es spüren, können Sie es nicht verbergen. Dieses Buch ist eine Hymne auf die Liebe.Die außergewöhnliche Sammlung des New Yorker Ehepaars Hugh Nini und Neal Treadwell gewährt Einblicke in bisher unbekannte Fotografien von Männern, die sich lieben, über ein Jahrhundert hinweg: von 1850-1950. Sie erstreckt sich über den gesamten Globus von den USA und Kanada bis hin zu den europäischen, südamerikanischen, asiatischen und australischen Kontinenten.
Neapel in den Neunzigern, Giovanna ist dreizehn Jahre alt, die Vorzeigetochter kultivierter Mittelschichtseltern, eine strebsame Schülerin. Doch plötzlich verändert sich alles, ihr Körper, ihre Stimmung, die Noten brechen ein, und immer öfter gerät sie mit ihren Eltern aneinander. Zufällig kommt Giovanna der Vorgeschichte ihres Vaters auf die Spur, der aus einem ganz anderen Neapel stammt, einem leidenschaftlichen, vulgären Neapel. Dort treibt sie sich herum, aber die Geheimnisse, auf die sie da stößt, verstören sie. Und als sie bei einem Abendessen bemerkt, wie ein Freund der Familie unterm Esstisch zärtlich die Füße ihrer Mutter streift, verliert sie vollends die Fassung. Denn wem kann sie überhaupt noch trauen?
Selten erhält man einen so tiefen Einblick in die Arbeit von Agenten, Informanten und Spionen: Decknamen und deren Träger, Treffpunkte und Übergabemethoden, Korrespondenzen und Augenzeugenberichte. Nach 1945 ist Südtirol ein Hotspot der Nachrichtendienste. Die Stadt Bozen wird zum Schauplatz länderübergreifender Operationen US-amerikanischer, italienischer, österreichischer und deutscher Geheimdienste. Aber auch östliche Nachrichtendienste ziehen von hier aus ihre Fäden. In der heißen Phase der Attentate in den 1960er-Jahren spitzt sich diese Situation deutlich zu.
Zum 500-jährigen Stadtjubiläum von Havanna stellt diese Publikation zwölf kubanische Architektinnen und Ingenieurinnen vor.
Frauen in leitenden Positionen in der Architektur sind weltweit in der Minderheit. Anders jedoch in Havanna, dessen Stadterneuerung beispielhaft ist und ihr Können beweist. Das vorliegende Projekt will Frauen im Bauwesen zu mehr Öffentlichkeit verhelfen und sie am Beispiel von Kuba zum Engagement in leitenden Positionen ermutigen. Kurz vor einem sich andeutenden Umbruch in Kuba werden die Leistungen von Architektinnen und Ingenieurinnen in Havannas Altstadt gewürdigt.