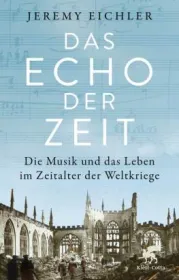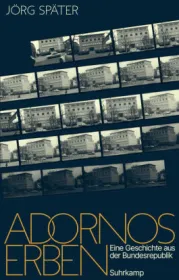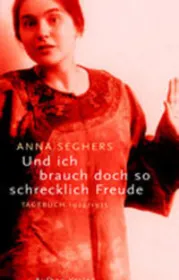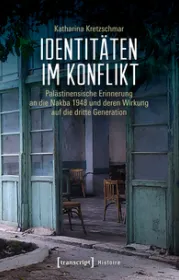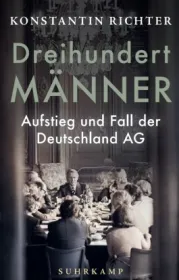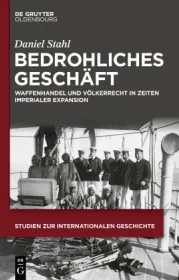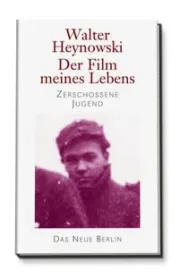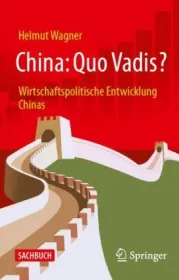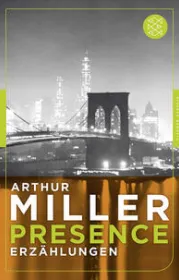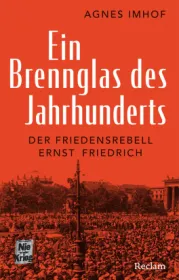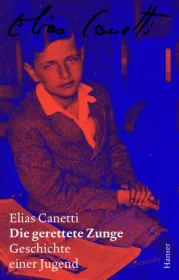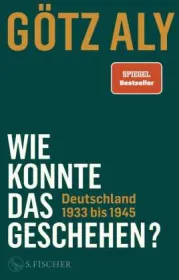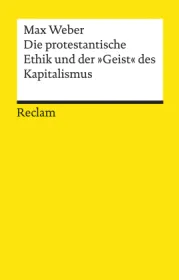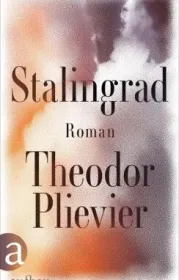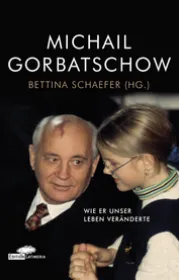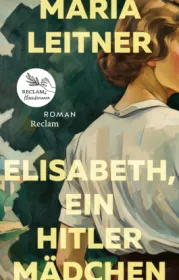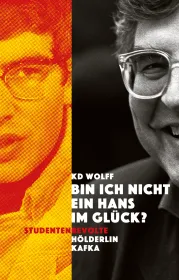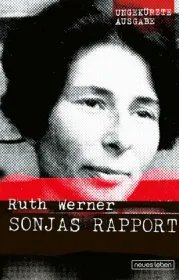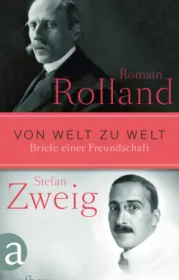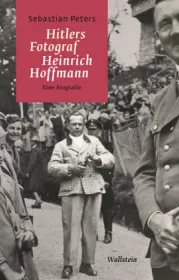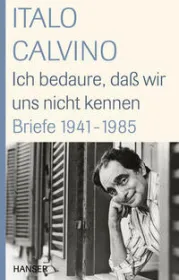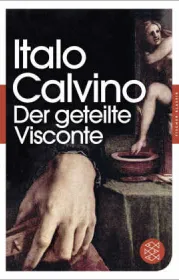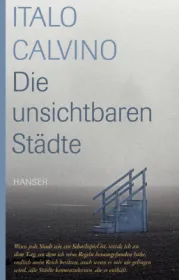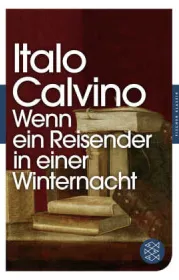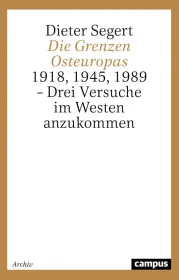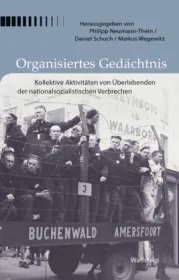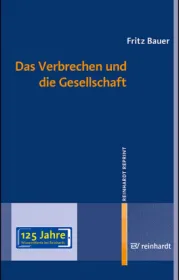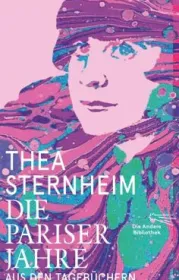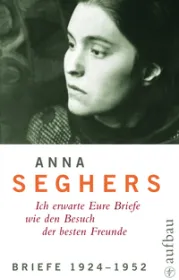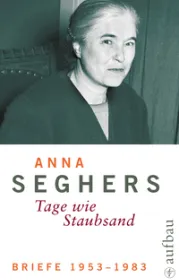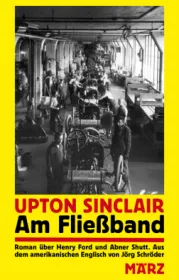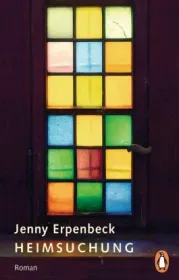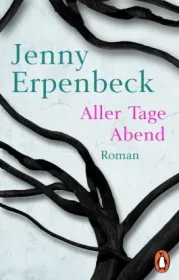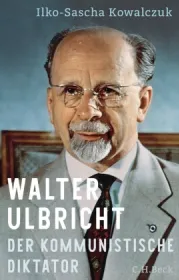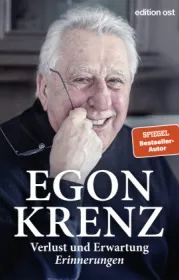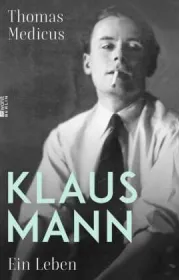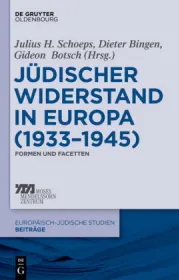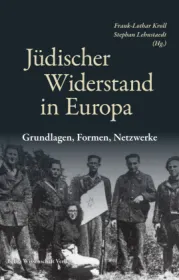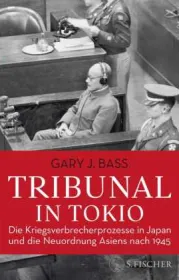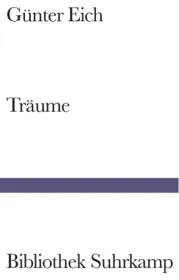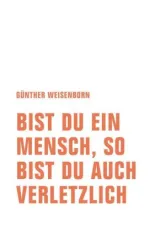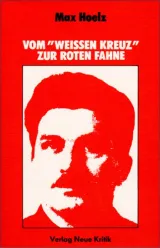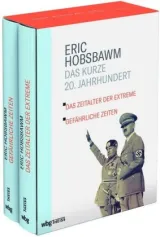"Unser Reich": So nannten Menschen unterschiedlicher Sprachen und Religionen von Südtirol über Mähren bis Galizien und Transsilvanien das Habsburgerreich. Pieter Judson erzählt in seiner meisterhaften Gesamtdarstellung die Geschichte der Donaumonarchie und der Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie ganz neu und revidiert gründlich das vertraute Bild vom verknöcherten "Vielvölkerreich".
Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Erblande der Habsburger unteilbar wurden, war damit der Grundstein für eines der mächtigsten europäischen Reiche gelegt. Pieter Judson erzählt die Geschichte dieses Imperiums chronologisch vom 18. Jahrhundert bis zu dessen Auflösung am Ende des Ersten Weltkriegs. Dabei berücksichtigt er neben der politischen Geschichte immer auch den Alltag der Menschen an der Peripherie.
20. Jahrhundert (Thema)
Ob als junger Wilder in den späten Jahren der Weimarer Republik oder als kritischer und engagierter Autor im Nachkriegsdeutschland: Günther Weisenborn hat immer wieder klar Stellung bezogen. Die Erinnerung an den Widerstand gegen die Nationalsozialisten war ihm ebenso wichtig wie das Warnen vor einem Wiedererstarken des Faschismus in der jungen Bundesrepublik, in der er sich immer wieder den Anfeindungen der Rechten ausgesetzt sah. Weisenborn war ein vielbeachteter und erfolgreicher Autor: Seine Stücke wurden von zahlreichen Bühnen im In- und Ausland gespielt, seine Romane in 18 Sprachen übersetzt. Heute ist vieles von dem, was er geschrieben hat, in Vergessenheit geraten - oder noch gar nicht veröffentlicht worden.
Aristokratin, Kommunistin, Katholikin, unbeugsame Nazigegnerin und Exilantin: Hermynia Zur Mühlen wurde 1883 in Wien als Gräfin Folliot de Crenneville geboren und starb 1951 im englischen Exil. Geschätzt von Joseph Roth und Karl Kraus, war sie eine Ausnahmeerscheinung der deutschsprachigen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. Mit ihren proletarischen Märchen hat sie ein eigenes Genre erfunden, darüber hinaus war sie eine politische Erzählerin und Publizistin von Rang.
Durch den Ersten Weltkrieg, die ungeheuren Verluste an den Fronten, die ökonomische Not im Hinterland und die gesteigerte Ausbeutung der Arbeitenden eskalieren die Verhältnisse.
Ein Teil der sozialdemokratischen Bewegung radikalisiert sich und es kommt zur Spaltung. In dieser Zeit wird der Zar in Russland gestürzt und mit dem Machtantritt der Bolschewiki scheint die kommunistische Weltrevolution zum Greifen nahe. Dies ist die Richtschnur für die radikale Linke - auch im Deutschen Reich
Max Hoelz: Ein im Vogtland und im Mansfeldischen auch heute noch von Sagen umwobener Name. Sein Leben kann sinnbildlich für den Beginn des "Zeitalters der Extreme" (Hobsbawm) und die Konfrontationen im 20. Jahrhundert stehen: Das Erleben des Ersten Weltkriegs führte ihn vom weißen Kreuz zur roten Fahne. Er wurde zum Rächer der Armen und Erniedrigten. Im Juni 1921 zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, im Juli 1928 freigelassen, setzt er sich für die Politik der kommunistischen Partei ein und reist Ende August 1929 in die Sowjetunion.
Am 16. September 1933 wird sein Leichnam aus der Oka geborgen.
Die Autobiographie von Max Hoelz ist keine "Memoirenschriftstellerei eines großen Politikers"; sie ist der Lebensbericht eines deutschen Revolutionärs, den die Geschichtsbücher in der BRD wie in der DDR verschwiegen haben. Im ersten Teil seines Buches schildert Hoelz seinen Werdegang vom entrechteten Landarbeiter zum Techniker, sein Leben während des Ersten Weltkrieges und den sehr abrupten, spontanen Politisierungsprozess während der Revolution von 1918/19 und seine Aktivitäten in den Jahren bis 1921. Sein Erfahrungsbericht vermittelt eindrucksvoll den Übergang von passiver Hinnahme gesellschaftlicher Unterdrückung zur bewussten Anwendung von organisierter Gegengewalt.
"Eine neue Welt wird nicht von denen geschaffen, die tatenlos beiseitestehen, sondern von denen, die sich in die Arena begeben, deren Kleider vom Sturmwind zerfetzt sind und deren Leiber im Kampf bleibende Spuren davontragen." Nelson Mandela
1962, auf dem Höhepunkt einer brutalen Kampagne des südafrikanischen Apartheidregimes gegen die politische Opposition, wurde der vierundvierzigjährige Anwalt und Aktivist des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) Nelson Mandela verhaftet. Er ahnte nicht, dass er die folgenden siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis verbringen würde. Im Laufe seiner 10 052 Tage in Haft schrieb der künftige Führer Südafrikas eine Vielzahl von Briefen an sture Gefängnisbehörden, an Mitstreiter, Regierungsfunktionäre und insbesondere an seine Frau Winnie und seine fünf Kinder.
Piemont, 1946. Giulia Masca kommt als gemachte Frau zurück in das Städtchen ihrer Kindheit, wo sie noch eine Rechnung offen hat. Vor fast fünfzig Jahren wurde sie hier von ihrer besten Freundin Anita und ihrem Verlobten hintergangen, weshalb Giulia die Flucht ergriff und sich in New York eine neue Existenz aufbaute. Nach einem halben Jahrhundert will sie Anita wieder treffen - wie werden sie sich gegenübertreten?
Von einer, die bleibt, und einer, die geht.
Hobsbawms 1995 erstmals erschienenes Werk "Das Zeitalter der Extreme" ist längst ein moderner Klassiker, der Titel zur Chiffre für das 20. Jahrhundert geworden. Erzählt wird darin die Geschichte des "Kurzen 20. Jahrhunderts" von 1914 bis 1991 - aus der Sicht des marxistischen Historikers, der zugleich teilnehmender Beobachter dieses 20. Jahrhunderts war.
Die Autobiografie "Gefährliche Zeiten" ergänzt das "Zeitalter der Extreme": Es ist der eindrucksvolle Lebensbericht eines großen Gelehrten, der Rechenschaft ablegt über sein persönliches 20. Jahrhundert. Im Zusammenspiel von Geschichtsbuch und Lebensgeschichte entsteht ein weites Panorama dieses Jahrhunderts.
Die erste vollständige und wissenschaftlich aufgearbeitete Ausgabe des legendären, 57 Jahre hindurch geführten Tagebuchs des Schriftstellers, Diplomaten und Kunstmäzens Harry Graf Kessler.
Gesamtausgabe aller neun Bände