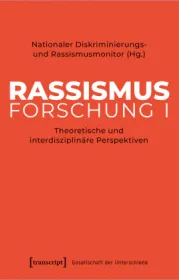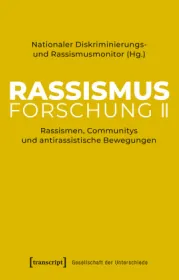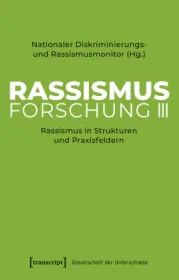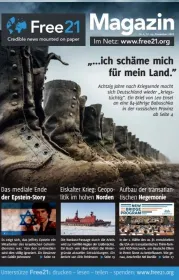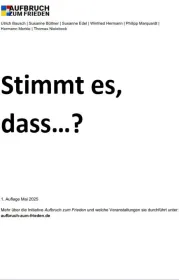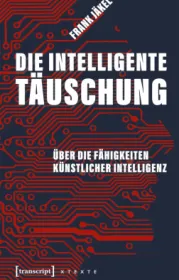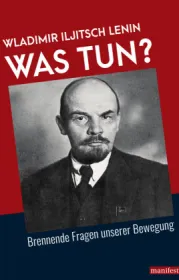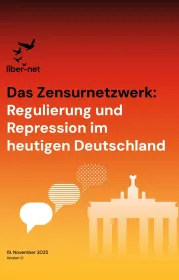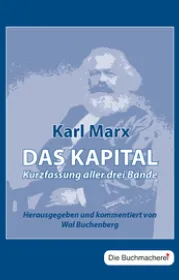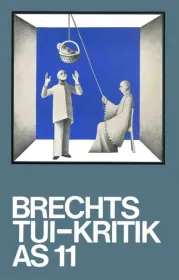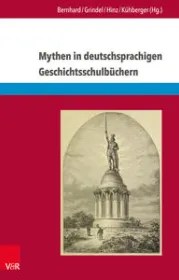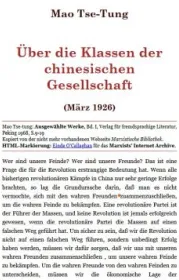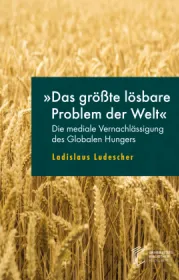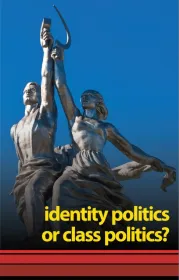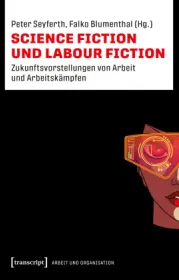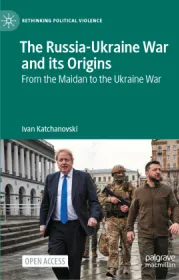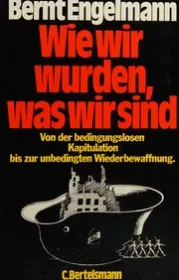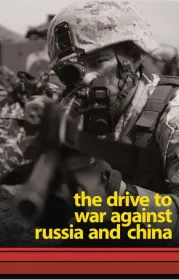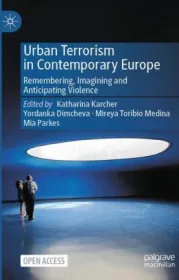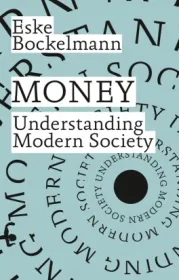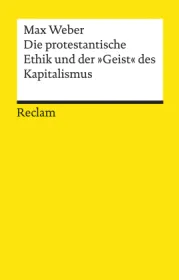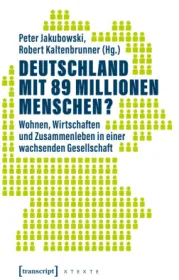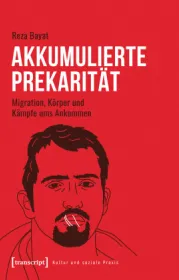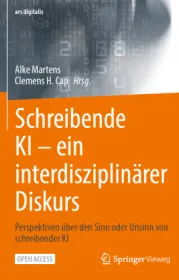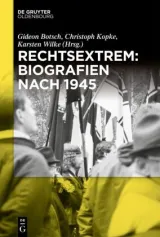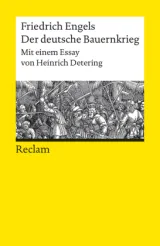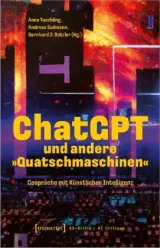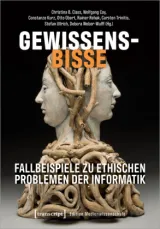"Wir wissen genau, was wir tun sollten, aber tun etwas völlig anderes. Wir schieben die wichtigen Dinge auf und erledigen das Unwichtige. Am Ende des Tages fragen wir uns, wo der Tag geblieben ist, am Ende des Jahres, wo das Jahr - und am Ende des Lebens? Es nützt nichts, sich vorzunehmen, etwas zu ändern, solange wir nicht die Gesetzmäßigkeit verstehen, die gegen uns arbeitet. Mit Hilfe der Spieltheorie lassen sich wie in einem Spiel Reaktionen und Spielzüge unserer Gegenspieler vorhersehen. Unter allen möglichen Gegenspielern gibt es einen, der besonders heimtückisch ist: wir selbst.
Kostenlos (Thema)
Der Rechtsextremismus begleitet die Geschichte der Bundesrepublik seit ihren Anfängen. Dazu gehören u.a. Parteien, im Hintergrund arbeitende Kulturorganisationen, Jugendbünde, aber auch militante und terroristische Gruppierungen.
Die Existenz vielfältiger Organisationen und Zusammenschlüsse, ihre inhaltliche Ausrichtung und die Vernetzung untereinander waren und sind in hohem Maß auch durch das Engagement einzelner Akteure und Akteurinnen geprägt. Der Band versammelt biografische Studien zu 24 einschlägigen Protagonistinnen und Protagonisten des bundesdeutschen Rechtsextremismus. Der akteurszentrierte Ansatz vertieft die geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisse über diese "besondere politische Kultur" (Peter Dudek/Hans-Gerd Jaschke) in Deutschland.
Neuauflage des Grundlagenwerkes zur Situation Schwarzer Frauen von der Sklaverei bis heute.
In 13 chronologisch geordneten Essays zeichnet die radikale politische Aktivistin Angela Davis die Entwicklung der amerikanischen Frauenbefreiungsbewegung von den 1960er Jahren bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches (1981) nach und verknüpft sie mit der Geschichte Schwarzer Frauen in den USA - von der Sklaverei bis zu den Ungerechtigkeiten der Gegenwart. Denn mit dem Ende der Sklaverei in der Folge des amerikanischen Bürgerkrieges war der Rassismus noch nicht überwunden. Die Schwarzen wurden zwar zu Bürger_innen, aber zu Bürger_innen zweiter Klasse.Angela Davis beleuchtet kritisch, wie sich der Kampf um die Bürgerrechte der Schwarzen mit den Kämpfen weißer Frauen für Bildung, Wahlrecht und Gleichberechtigung verband.
Wenige Werke der politischen Literatur haben vor der Geschichte so glänzend bestanden wie Leo Trotzkis 'Verratene Revolution'. Mehr als achtzig Jahre nach ihrer Entstehung im Jahr 1936 ist diese Analyse der Sowjetunion noch immer unübertroffen. Sie sagt mehr über die Struktur und die Dynamik der sowjetischen Gesellschaft aus, als irgendein anderes Buch. Trotzki charakterisierte die Sowjetunion als eine 'Übergangsgesellschaft', deren Charakter und Schicksal die Geschichte noch nicht entschieden habe, und betont die Notwendigkeit für die Arbeiterklasse, das stalinistische Regime zu stürzen, auf der Grundlage der Sowjetdemokratie wieder die Kontrolle über den Staat zu erlangen und die Sowjetgesellschaft in den Sozialismus zu führen.
Auch nach Jahrzehnten von Aktivismus und Forschung gilt: Die (Geschlechter-)Verhältnisse im Feld des Politischen und auf der Ebene der kollektiven Weltdeutung sind nach wie vor von Ungleichheiten dominiert. Die Beitragenden zeigen auf, dass die feministische Kritik im Moment des Einwands bereits Möglichkeiten entfaltet, diese Verhältnisse neu zu denken. Ob im Widerspruch gegen die hegemoniale Zuweisung eines bestimmten Ortes, einer gesellschaftlichen Position oder einer vermeintlichen »Natur« - die feministische Kritik entwirft stets auch emanzipatorische Visionen eines solidarischen Zusammenlebens: Sie gibt der Welt eine neue Wirklichkeit.
„Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs ist die deutsche Öffentlichkeit, die sich schon zuvor nicht gerade durch Vielfalt ausgezeichnet hat, extrem eintönig geworden. Der immer gleiche Diskurs von Politikern und Medien und die tägliche gebetsmühlenartige Wiederholung der Textbausteine vom ebenso „grundlosen“ wie „brutalen“ völkerrechtswidrigen Angriffskrieg“ bzw. der „schon lange überfälligen“ „Zeitenwende“ haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die deutsche Gesellschaft wurde erfolgreich eingeschworen auf den nationalen Kriegskurs immer heftigerer Wirtschaftssanktionen und der Lieferung immer schwererer Waffen an die Ukraine sowie die massenhafte Aufnahme der ansonsten so unbeliebten Kriegsflüchtlinge. (…) Eine gehörige Portion an Verstandesverachtung bzw. gesundem Nationalismus war durchaus nötig, um die dafür geforderten geistigen Wendungen mitzumachen. Dazu hier einige abweichende und unpatriotische Bemerkungen – eine Sammlung der Artikel zum Ukraine-Krieg und der Berichterstattung zu ihm.“
Jubiläumsjahr 2025: 500 Jahre Deutscher Bauernkrieg. Nach der Niederlage der Revolution von 1848 erinnert Friedrich Engels an die Bauernkriege der Reformationszeit, den »Angelpunkt der deutschen Geschichte«. Keine nüchterne historische Darstellung hatte er dabei im Sinn, sondern eine ermutigende Streitschrift für Zeitgenossen: »Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition.« Seine glänzend geschriebene Darstellung der Aufstände verbindet sozialgeschichtliche Analysen mit einer packenden Erzählung: Ein literarisches Meisterwerk ist neu zu entdecken.
Spiele sind durch Produktion, Distribution und Konsumption in politische Strukturen eingebunden. Sie spiegeln nicht nur ihre Umwelt wider, sondern werden auch maßgeblich durch diese geformt. Die Beiträger_innen fragen transdisziplinär nach der Analyse solcher »Politiken des Spiels«: Innerhalb welcher rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Regeln findet das Spiel statt? In welchen Machtverhältnissen stehen die am Spiel beteiligten Akteur_innen? Und wie geht die Branche mit aktuellen politischen Diskursen um? Dabei betrachten sie zahlreiche Formen des Spiel(en)s in diachroner sowie synchroner Perspektive und machen deutlich: Spielen ist ein hochpolitischer Akt.
Die Veröffentlichung von ChatGPT im Herbst 2022 heizte die Kontroverse um Künstliche Intelligenz an und führte zu einer seitdem unaufhörlichen Fragelust - verstärkt dadurch, dass dieselben Prompts schon kürzeste Zeit später andere Outputs generieren. In einem experimentellen Format präsentieren die Herausgeber_innen erste kommentierte Gespräche mit KI-Sprachmodellen. Sie geben Einblick in dialogische Szenen, die eine fortlaufende Transformation der Technik und Eigentümlichkeiten maschinellen Lernens erfassen.
Die vielfältigen Möglichkeiten moderner IT-Systeme bringen drängende ethische Probleme mit sich. Neben der offensichtlichen Frage nach einer moralisch tragbaren Verwendung von Informationstechnologien sind ebenso die Aspekte des Entwerfens, Herstellens und Betreibens derselben entscheidend. Die Beiträge setzen sich mit dem Konfliktpotenzial zwischen Technik und Ethik auseinander, indem sie lebensnahe Fallbeispiele vorstellen und fragenbasiert zur Diskussion einladen. Damit liefern sie eine praktische Herangehensweise zum gemeinsamen Nachdenken über moralische Gebote und ethischen Umgang mit IT-Systemen und ihren Möglichkeiten.