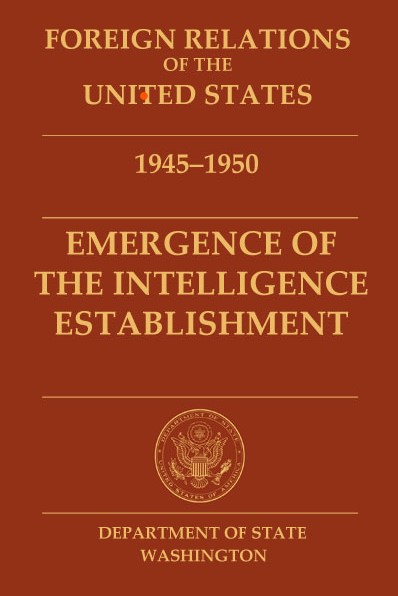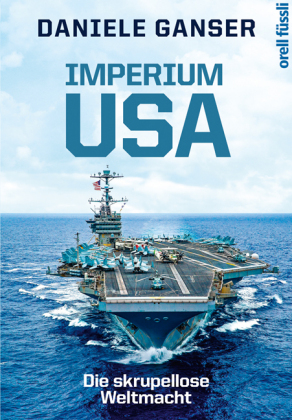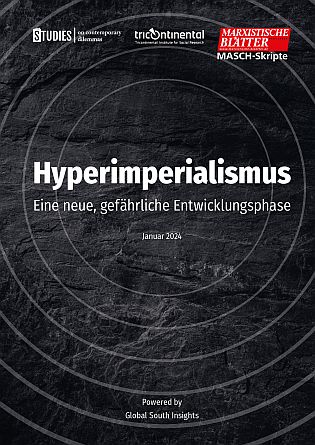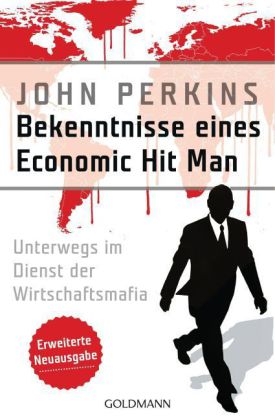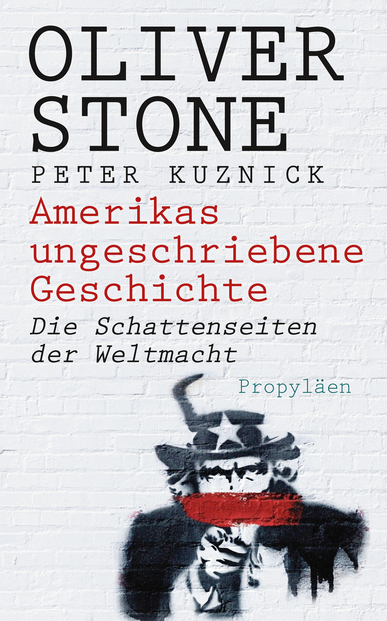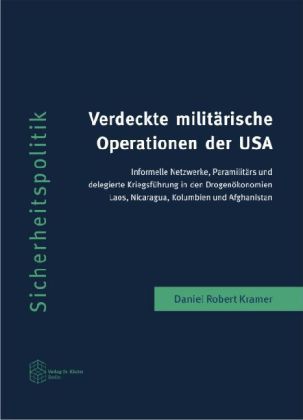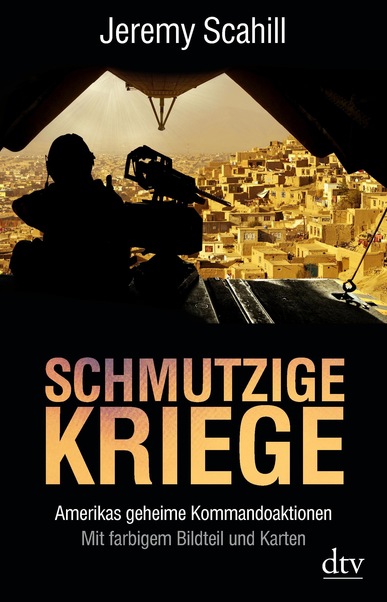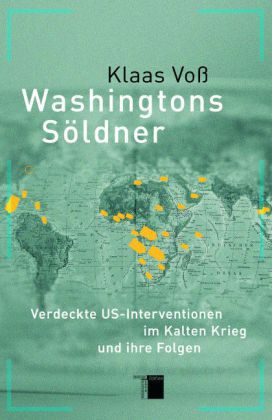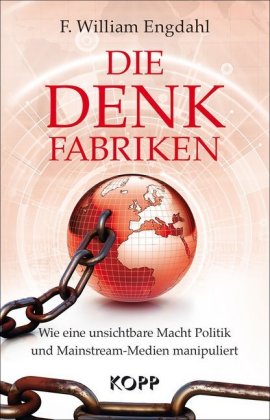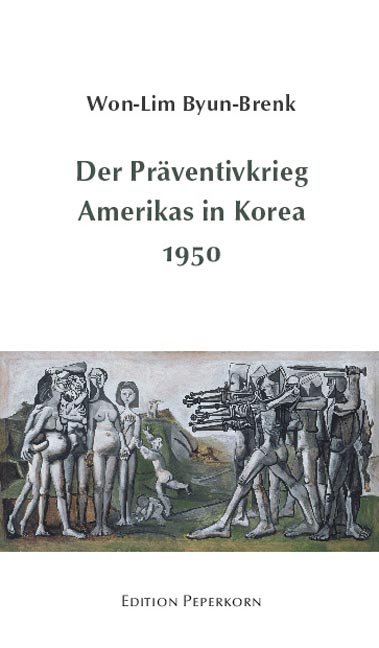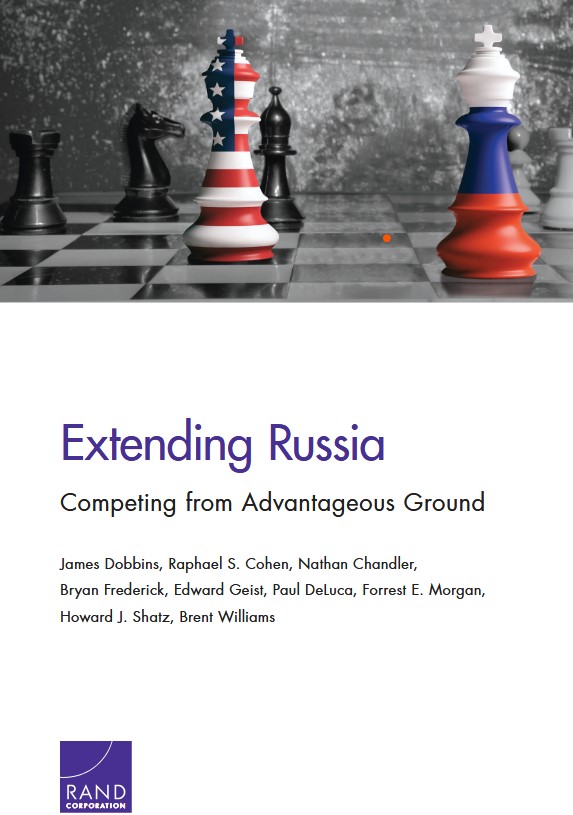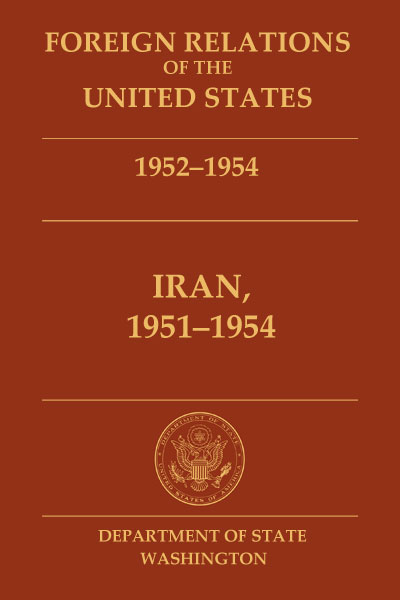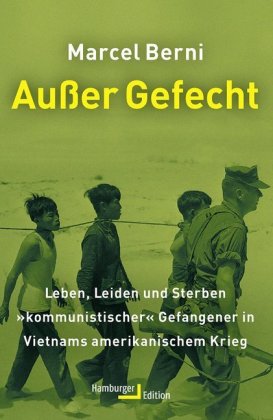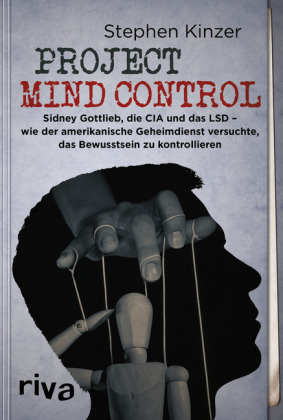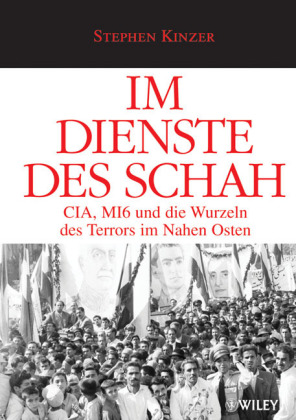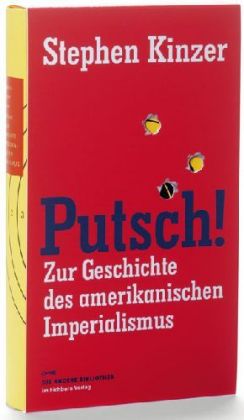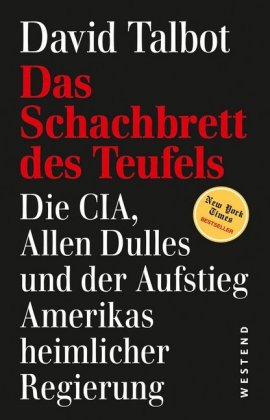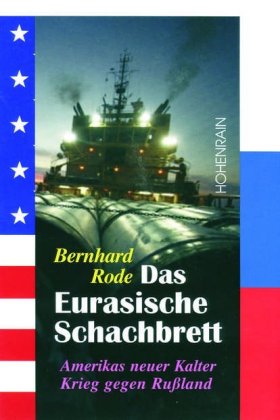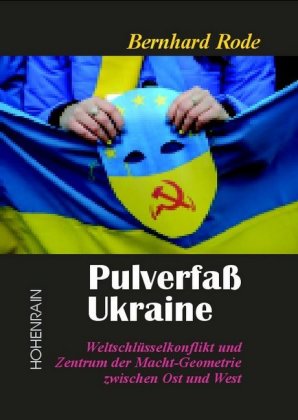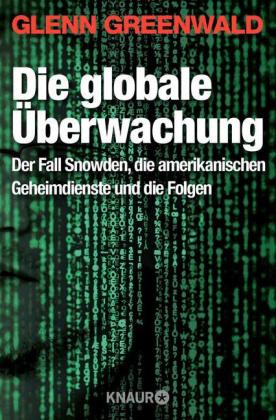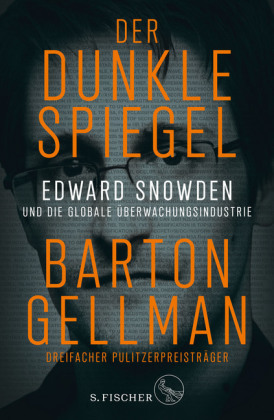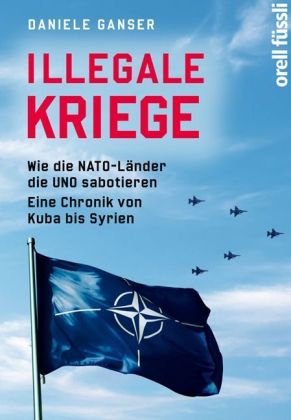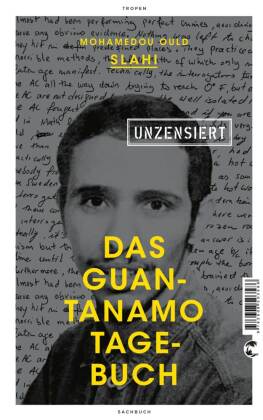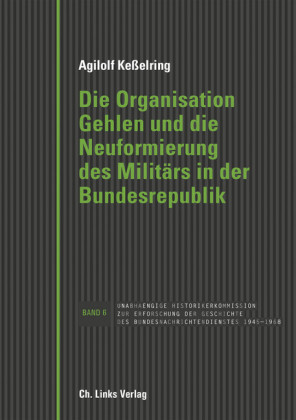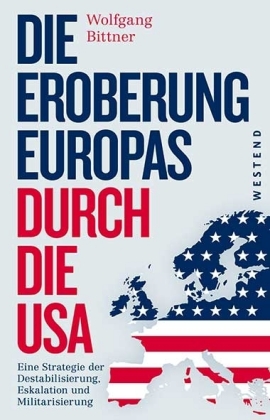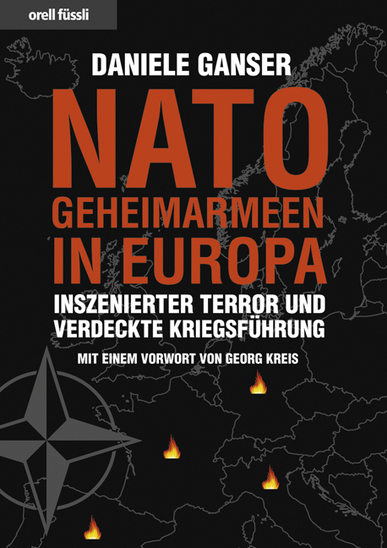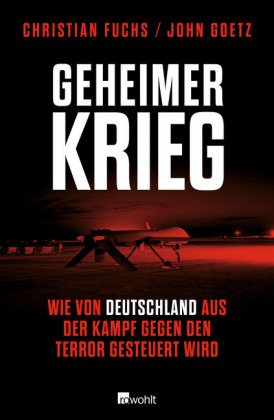Der zweite kalte Krieg
Zur Geopolitik und strategischen Dimension der USA
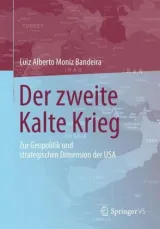
Die Geopolitik und strategische Dimension der US-amerikanischen Außenpolitik unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama steht im Zentrum dieser Argumentation des brasilianischen Politikwissenschaftlers und Historikers Luiz Alberto Moniz Bandeira. Der Autor eröffnet in seiner Monografie ein politisch-historisches Panorama und analysiert den Einfluss der USA auf historische und politische Prozesse in der Welt seit den 2000er Jahren.
USA, Geopolitik, Rebellionen im Überblick.- Das geopolitische Great Game von Eurasien bis Nordafrika.- Der zweite Kalte Krieg - ein Anfangspanorama.- Der zweite Kalte Krieg im Zeichen von Öl und Gas.- Von Bushs freedom agenda zu den bunten Revolutionen.- Die NATO-Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands.- Die Xinjang-Frage und Washingtons China-Politik.- Die Irak-Invasion - erklärte und latente Absichten.- Militärische Besetzung des Mittleren Ostens, Wirtschaftskrise.- USA, Afghanistan, Irak: Wirtschaftszwang und Tragödie.- Technologische (Drohnen-)Kriegsführung als Ausweg.- Der Drohnenterror in Pakistan.- Aufstand in Tunesien, sunnitische Rebellen, Geldgeber.- Aufstand in Libyen - Nation aus Volksstämmen.- Auf Gaddafis Entgegenkommen folgt die Intervention.- USA und NATO geeint im Kampf um globale Führungsrolle.- Humanitäre Intervention und die Frage der Glaubwürdigkeit.- Von Tunesien bis Saudi-Arabien: innerislamische Gefechte.- Der antiwestliche Terrorkrieg in Nordafrika.- Syriens Aufstand: Vom kalten zum heißen Revolutionskrieg.- Real- und Psychokrieg im Schlüsselland Syrien.- Großsyrien - das Endzeit-Szenario der Dschihadisten.- Globale Machtverschiebung und militärisches Outsourcing.- Großisrael, Israel und Palästina.- Israels Verwundbarkeit und das iranische Atomprogramm.- Israel am Vorabend der Apokalypse?.- Arabischer Frühling: Chaos- und Terrordemokratie.
Quellen (Auswahl)
Erstellt: 13.10.2016 - 22:28 | Geändert: 12.10.2025 - 16:48