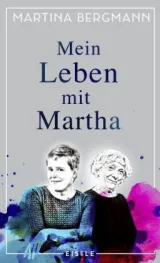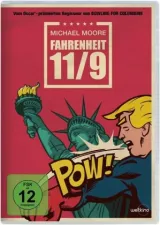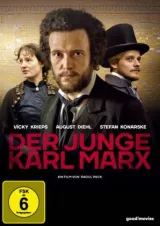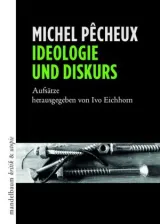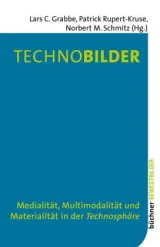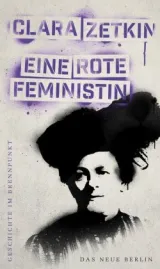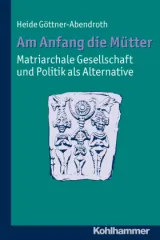Der literarische Bericht einer ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft. Ein glänzend geschriebenes Plädoyer für ein Altern in Würde
Das Leben ist schön!
Martina kümmert sich um Martha. Martha ist Mitte achtzig und in einer "poetischen Verfassung". So nannte das Heinrich, der Mann, mit dem Martha fast vierzig Jahre lang zusammenlebte. Aber jetzt ist Heinrich tot, und Martina beschließt, sich der alten Dame anzunehmen, ohne mit ihr verwandt zu sein oder sie auch nur gut zu kennen. Oder ist es vielmehr Martha, die sich Martina ausgesucht hat? So genau ist das nicht mehr auszumachen, aber es ist auch nicht wichtig, weil sie nämlich beide glücklich sind, so wie es ist. Martina Bergmann tritt in ihrem ebenso klaren wie empathischen Bericht den Gegenbeweis dafür an, dass die Betreuung eines dementen Menschen eine Bürde sein muss. Sie schildert, wie es sich anfühlt, mit jemandem zusammenzuleben, der trotz seiner Einschränkungen klug und humorvoll, ja geradezu hellsichtig ist. Ein glänzend geschriebenes Plädoyer für das würdevolle Zusammenleben der Generationen. Und ein bewegendes Portrait zweier unkonventioneller Frauen.
Mai 2019
Kaum eine Wahl hat die Öffentlichkeit so stark beschäftigt wie die von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Als einer der wenigen, die das Ergebnis vorhergesagt haben, offenbart Oscar®-Preisträger Michael Moore die Umstände und Mechanismen, die zum Wahlerfolg des umstrittenen Kandidaten geführt haben. Im Fokus seiner Kritik steht dabei nicht nur der Präsident selbst, sondern vor allem auch das Versagen der Demokraten.
Paris, 1844, am Vorabend der industriellen Revolution: Der 26-jährige Karl Marx lebt mit seiner Frau Jenny im französischen Exil. Als Marx dort dem jungen Friedrich Engels vorgestellt wird, hat der notorisch bankrotte Familienvater für den gestriegelten Bourgeois und Sohn eines Fabrikbesitzers nur Verachtung übrig. Doch der Dandy Engels hat gerade über die Verelendung des englischen Proletariats geschrieben, er liebt Mary Burns, eine Baumwollspinnerin und Rebellin der englischen Arbeiterbewegung. Engels weiß, wovon er spricht. Er ist das letzte Puzzlestück, das Marx zu einer rückhaltlosen Beschreibung der Krise noch fehlt.
Michel Pêcheux (1938-1983) ist in den deutschsprachigen Auseinandersetzungen um eine kritische Gesellschaftstheorie weniger als eine Randfigur. Dieser Band - die erste Textsammlung in deutscher Sprache - dokumentiert sein Denken zwischen Marxismus und Psychoanalyse. Als Mitarbeiter und Schüler von Louis Althusser schreibt er dessen Ideologietheorie aus einer Perspektive der Befreiung fort; in der Kritik an der herrschenden Linguistik und in der Auseinandersetzung mit Foucault entwickelt Pêcheux eine eigene Theorie der Materialität der Diskurse.
Die voranschreitende Evolution der Medien hat eine Flut an Interface- und Displaytechnologien hervorgebracht, die neuartige multi-modale Repräsentationsformen erlauben und forcieren. Will man demnach der Beschreibung und Analyse moderner Medientechnologien in bildtheoretischer Perspektive gerecht werden, sollte dem traditionellen Bildbegriff ein aktualisiertes Verständnis dieser Phänomene zur Seite gestellt werden.
Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin: Clara Zetkin initiierte mehr als nur den Internationalen Frauentag
Klug, mutig, unbequem - Der Name Clara Zetkin signalisiert Widerstand. Vehement trat sie für die Rechte der Frauen ein und gilt praktisch als Begründerin des Internationalen Frauentages am 8. März. Als Frauenrechtlerin, revolutionäre Sozialistin und Kommunistin in der Tradition Rosa Luxemburgs wurde sie in der DDR hoch verehrt, im Westen der Republik vor der Wende kaum erwähnt.
Gerade einmal 20 Jahre alt, schloss sie sich 1878 den Sozialisten an, als die Partei von Bismarck verboten wurde. Zehn Jahre später gehörte die Volksschullehrerin zu den Wortführern der Frauenbewegung. Für Clara Zetkin war Emanzipation keine Geschlechter-, sondern eine Klassenfrage. Gleichberechtigung für Frauen und für Männer in einer gerechten Welt forderte sie in der SPD-Frauenzeitschrift "Die Gleichheit", die sie von 1891 bis 1917 herausgab. Ihr größter Erfolg: Gegen den Willen ihrer männlichen Genossen setzte sie 1910 auf der Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen den Internationalen Frauentag durch. Erstmals wurde er 1911 in Deutschland, Dänemark, Österreich-Ungarn und in der Schweiz begangen.
Eva Geber hat einen biographischen Roman geschrieben über Louise Michel (1830-1905), die Ikone der Pariser Kommune 1871. Für die einen war sie eine blutrünstige Wölfin, für die anderen die große Bürgerin, die rote Jungfrau, die gute Louise. Ihr Mut im Kampf, ihre Unerschrockenheit vor Gericht sind legendär. Verurteilt zur Deportation nach Neukaledonien, suchte Louise Michel Kontakt mit der indigenen Bevölkerung. Sie erlernte die Sprache der Kanak und vermittelte in zwei Schriften deren Mythen und Kultur. Bis zu ihrem Tod blieb die Insel für sie Sehnsuchtsort. Obwohl Louise Michel keine Gelegenheit ausgelassen hat, im Kampf zu sterben, erreichte sie ein hohes Alter.
Laura lässt das Geheimnis, das den mittelalterlichen jüdischen Schatz von Erfurt umgibt, nicht mehr los. Sie taucht ein in das Schicksal von Rachel und Joschua, die 1349 zusammen mit ihrem Vater alles zurücklassen und vor dem Pestpogrom fliehen mussten. Vielleicht ist es diese Geschichte, weshalb Laura gerade jetzt Alexej begegnet, der lieber verschweigen möchte, dass er Jude ist. Allmählich versteht Laura, in wie viele Fettnäpfchen man treten kann, wenn man sich in einen Juden verliebt, und was es heute bedeutet, jüdisch zu sein.
Der Band legt eine kritische Zeitdiagnose und sozialwissenschaftliche Analyse der aktuellen sozialen und politischen Verhältnisse des 21. Jahrhunderts vor. Die Autorinnen und Autoren nehmen eine "Vermessung der sozialen Welt" vor. Ausgangspunkt sind Prozesse der neoliberalen Globalisierung, die nahezu alle Lebensbereiche prägen und durchdringen. Dies wird beispielhaft diskutiert anhand der Krise der Europäischen Union, der Globalisierung des Krieges und dem Problem der Armut in einer reichen Gesellschaft - vor allem in Hinblick auf die Armut von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund.
Für diesen Band wurden aus dem umfangreichen Oeuvre der international renommierten Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth 20 Beiträge ausgewählt, die das Themenspektrum der modernen Matriarchatsforschung in seiner Komplexität und Differenziertheit zeigen. Beginnend mit grundsätzlichen Klärungen und gesellschaftskritischen Analysen, spannt sich der Bogen über Untersuchungen zu matriarchalen Kultur- und Kunstformen bis hin zu Reflexionen über die Matriarchatspolitik als Weg zu einer wirklich gender-egalitären, nachhaltigen und friedfertigen Gesellschaft.