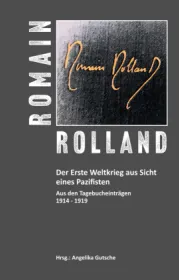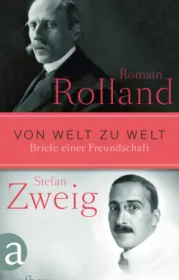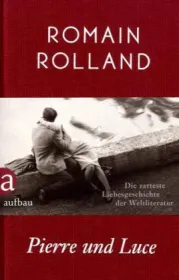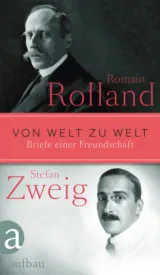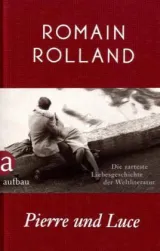Nun war seine reine Stimme verklungen, die Stelle war leer, das Gewissen der Menschheit stumm. Und Rolland empfindet das Schweigen, das entsetzliche Schweigen des freien Geistes im Getümmel der Knechte furchtbarer als den Donner der Kanonen. Die er zu Hilfe rief haben ihn verlassen. Die letzte Wahrheit, die des Gewissens, hat keine Gemeinsamkeit, niemand hilft ihm, für die Freiheit des europäischen Geistes zu kämpfen, für die Wahrheit inmitten der Lüge, für die Menschlichkeit gegen den wahnwitzigen Haß. Er ist wieder allein mit seinem Glauben, mehr allein als in den bittersten Jahren seiner Einsamkeit.
Aber Alleinsein hat für Rolland nie Resignation bedeutet. Zuschauen, wie ein Unrecht tätig wirkt, ohne Einspruch zu erheben, hat schon dem jungen Dichter so verbrecherisch geschienen wie das Unrecht selbst. »Ceux qui subissent le mal sont aussi criminels que ceux qui le font.« Und keiner so sehr wie der Dichter scheint ihm die Verantwortung zu haben, dem Gedanken das Wort zu geben und das Wort durch die Tat zu verlebendigen. Die bloße Arabeske zur Zeitgeschichte zu schreiben ist zu wenig: erlebt der Dichter die Zeit vom Mittelpunkt seines Seins, dann ist es seine Verpflichtung, für die Idee seines Seins zu wirken, die Idee lebendig zu machen. »Die Elite des Geistes stellt eine Aristokratie dar, die vorgibt, jene des Blutes zu ersetzen. Aber sie vergißt, daß jene damit begann, ihre Privilegien mit dem Blute zu bezahlen. Seit Jahrhunderten hören die Menschen viele Worte der Weisheit, aber selten sehen sie die Weisen sich aufopfern. Um die anderen gläubig zu machen, muß man beweisen, daß man selbst glaubt. Es genügt nicht, bloß Worte zu sprechen.« Der Ruhm ist nicht nur ein sanfter Lorbeerkranz, er ist auch ein Schwert. Glaube verpflichtet: wer einen Johann Christof das Evangelium eines freien Gewissens sprechen ließ, darf sich nicht verleugnen, wenn die Welt ihm das Kreuz bereitet hat, er muß das Apostolat auf sich nehmen und gegebenenfalls das Märtyrertum. Und während fast alle Künstler der Zeit in ihrer überreizten »passion d'abdiquer«, in ihrer Leidenschaft, die eigene Meinung wegzuwerfen und sich ganz in der Massenmeinung willenlos aufzulösen, die Gewalt, die Macht, den Sieg nicht nur als den Herrn der Stunde bejubeln, sondern sogar als Sinn der Kultur, als Lebenskraft der Welt, stellt sich hier das unbestechliche Gewissen schroff gegen alle.
»Jede Gewalt ist mir verhaßt,« schreibt Rolland in jenen entscheidenden Zeiten an Jouve, »kann die Welt nicht ohne Gewalt auskommen, so ist es meine Pflicht, nicht mit ihr zu paktieren, sondern ein anderes, entgegengesetztes Prinzip darzustellen, das jenes aufhebt. Jedem seine Rolle, jeder gehorche seinem Gott.« Nicht einen Augenblick ist er sich im unklaren, wie groß der Kampf ist, den er aufnimmt, aber das Jugendwort klingt noch in seiner Brust: »Unsere erste Pflicht ist, groß zu sein und die Größe auf Erden zu verteidigen.«
Wieder wie damals, als er mit seinen Dramen einem Volke den Glauben wiedergeben wollte, als er die Bilder der Heroen über eine kleine Zeit erhob, als er in dem Werk eines schweigenden Jahrzehnts die Völker zur Liebe und zur Freiheit aufrief, wieder beginnt er allein. Keine Partei ist um ihn, keine Zeitung, keine Macht zu seiner Verfügung. Er hat nichts als seine Leidenschaft und jenen wunderbaren Mut, dem das Aussichtslose nicht Abschreckung, sondern Anreiz ist. Allein beginnt er den Kampf gegen den Wahnwitz von Millionen. Und in diesem Augenblick lebt das europäische Gewissen – mit Haß und Hohn verjagt aus allen Ländern und Herzen – einzig in seiner Brust. Stefan Zweit Projekt Guttenberg
https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/rolland/chap068.html
Die Manifeste
Zeitungsaufsätze sind die Form seines Kampfes: um der Lüge und ihrem öffentlichen Ausdruck, der Phrase, entgegenzutreten, muß Rolland sie auf ihrem eigenen Kampfplatz aufsuchen. Aber die Intensität der Ideen, die Freiheit ihrer Meinung, die Autorität seines Namens macht diese Aufsätze zu Manifesten, die Europa überfliegen und einen geistigen Waldbrand entzünden. Wie elektrische Funken an unsichtbaren Drähten laufen sie weiter, hier furchtbare Explosionen des Hasses herbeiführend, dort hell hinableuchtend in die Tiefen freier Gewissen, immer aber Wärme, Erregung in den polarsten Formen der Entrüstung und Begeisterung erzeugend. Niemals vielleicht haben Zeitungsaufsätze eine so gewitterhafte, zündende und reinigende Wirkung gehabt wie diese zwei Dutzend Aufrufe und Manifeste eines einzelnen freien, klaren Menschen in einer geknechteten und verwirrten Zeit.
Künstlerisch zählen diese Aufsätze selbstverständlich nicht gleich den überlegten, ausgefeilten, komponierten Werken. Auf weiteste Kreise berechnet, eingeengt durch den Gedanken an die Zensur (denn es war Rolland vor allem wichtig, daß die Aufsätze, die er im »Journal de Genève« veröffentlichte, auch in der Heimat gelesen würden), müssen sie die Gedanken zugleich mit Bedacht und mit Eile entwickeln. Sie enthalten wunderbare, unvergeßliche Schreie, sublime Stellen der Empörung und Beschwörung, aber sie sind Produkte der Leidenschaft, ungleich darum im Sprachlichen, oft auch gebunden an das gelegentliche Geschehnis. Ihr Wert liegt weitaus im Moralischen: hierin sind sie eine einzige und unvergleichliche Leistung. Künstlerisch fügten sie dem Werke Rollands kaum mehr als einen neuen Rhythmus an: ein gewisses Pathos des öffentlichen Sprechers, eine heroisch gehobene Rede, die bewußt zu Tausenden und Millionen spricht. Denn in diesen Aufsätzen redet nicht ein einzelner, sondern das unsichtbare Europa, als dessen Kronzeuge und öffentlichen Verteidiger Romain Rolland sich zum ersten Male fühlt.
Was sie in unsrer Welt damals bedeutet haben, wird das eine spätere Generation, die sie nun gesammelt in den Bänden »Au-dessus de la Mêlée« und »Les Précurseurs«, liest, überhaupt noch ermessen können? Man vermag eine Kraft nie zu berechnen, ohne ihren Widerstand, eine Tat nie ohne ihr Opfer. Um die moralische Bedeutung, den heroischen Charakter dieser Manifeste würdigen zu können, muß man den (heute kaum mehr faßlichen) Irrsinn des ersten Kriegsjahres, die geistige Epidemie ganz Europas, das intellektuelle Narrenhaus sich vergegenwärtigen. Muß sich erinnern, daß Maximen, die uns heute das Banalste scheinen, wie zum Beispiel, daß nicht alle Menschen einer Nation für den Ausbruch eines Krieges verantwortlich seien, als strafwürdige politische Verbrechen galten, muß sich vergegenwärtigen, daß ein Buch wie dieses heute uns selbstverständliche »Au-dessus de la Mêlée« vom Staatsanwalt ein »niederträchtiges« genannt wurde, daß der Autor verfemt war, die Aufsätze lange verboten gewesen sind, während eine Schar von Pamphleten gegen dieses freie Wort ungehindert ihren Weg nahm. Man muß sich zu diesen Aufsätzen immer die Atmosphäre, das Schweigen der anderen hinzudenken, um zu verstehen, daß sie so laut hallten, weil sie in eine ungeheure geistige Leere hineingesprochen waren, und wenn heute ihre Wahrheiten leicht als selbstverständlich abgetan werden können, sich an das wundervolle Wort Schopenhauers erinnern, »der Wahrheit ist auf Erden nur ein kurzes Siegesfest verstattet zwischen zwei langen Zeiträumen, in denen sie als paradox verspottet oder als banal mißachtet wird«. Heute mag (für einen flüchtigen Augenblick) der Zeitpunkt gekommen sein, wo viele dieser Worte als banal gelten werden, weil sie inzwischen von tausenden Nachschreibern kleingemünzt wurden. Wir aber haben sie zu einer Zeit gekannt, da jedes dieser Worte wie ein Peitschenschlag wirkte, und die Empörung, die sie damals verursachten, bezeugt das historische Maß ihrer Notwendigkeit. Nur die Wut der Gegner (heute noch erkenntlich in einer Flut von Broschüren) gibt Ahnung von dem Heroismus dieses Mannes, der sich zum erstenmal mit seiner freien Seele »über das Getümmel« erhob. Vergessen wir es nicht: »Dire ce qui est juste et humain«, zu sagen, »was gerecht und menschlich ist«, galt damals als das Verbrechen der Verbrechen. Denn damals war die Menschheit so toll vom ersten Blute, daß sie, wie Rolland einmal so wundervoll sagte: »Jesum Christum, wenn er auferstanden wäre, noch einmal gekreuzigt hätte, weil er sagte: Liebet einander.«
https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/rolland/chap069.html
Über dem Getümmel
Am 22. September 1914 erscheint im »Journal de Genève« jener Aufsatz »Au-dessus de la Mêlée«, nach dem flüchtigen Vorpostengeplänkel mit Gerhart Hauptmann die Kriegsansage an den Haß, der entscheidende Hammerschlag zum Bau der unsichtbaren europäischen Kirche inmitten des Krieges. Das Titelwort ist seitdem Kampfruf und Hohnwort geworden: aber mit diesem Aufsatz erhebt sich zum erstenmal im mißtönenden Gezänke der Parteien die klare Stimme der unbeirrbaren Gerechtigkeit, Tausenden und immer neuen Tausenden zum Trost.
Ein merkwürdiges verwölktes tragisches Pathos beseelt diesen Aufsatz: geheimnisvolle Resonanz der Stunde, da Unzählige und darunter nächste Freunde verbluten. Das Erschütterte und Erschütternde eines gewaltsamen Aufbruchs des Herzens ist darin, ein losgerungener heroischer Entschluß, mit dem Ganzen einer wirr gewordenen Welt sich auseinanderzusetzen. In einem Hymnus an die kämpfende Jugend erhebt sich der Rhythmus: »O, heroische Jugend der Welt! Mit wie verschwenderischer Freude schüttet sie ihr Blut in die hungrige Erde! Wie wundervolle Opfergarben mäht die Sonne dieses herrlichen Sommers sie hin. Ihr alle, Jünglinge aller Völker, die ein gemeinsames Ideal gegeneinander stellt ... wie teuer seid ihr mir, die ihr hingeht, um zu sterben. Ihr rächt die Jahre des Skeptizismus, der genießerischen Schwächlichkeit, in der wir aufwuchsen ... Sieger oder Besiegte, Tote oder Lebende, seid glücklich!«
Aber nach diesem Hymnus an die Gläubigen, die höchster Pflicht zu dienen meinen, richtet Rolland die Frage an die geistigen Führer aller Nationen: »Ihr, die ihr solche lebendigen Schätze an Helden in Händen hattet, wofür verausgabt ihr sie? Welches Ziel habt ihr der großherzigen Hingabe ihres Opfermutes gegeben? Den gegenseitigen Mord, den europäischen Krieg.« Und er erhebt die Anklage, daß sich die Führer nun mit ihrer Verantwortung feige hinter einem Götzen – dem »Schicksal«! – verstecken und, nicht genug, diesen Krieg nicht verhindert zu haben, ihn noch anfachen und vergiften. Entsetzliches Bild! Alles stürzt hin in diesem Strome, in allen Ländern, allen Nationen gleicher Jubel für das, was sie zermalmt. »Nicht nur die Leidenschaft der Rasse schleudert in blinder Wut die Millionen Menschen gegeneinander ... Die Vernunft, die Religion, die Dichtung, die Wissenschaft, alle Formen des Geistes haben sich mobilisiert und folgen in jedem Staate den Armeen. Ohne Ausnahme verkündet mit voller Überzeugung die Elite jedes Landes, daß die Sache gerade ihres Volkes die Gottes, die der Freiheit und des menschlichen Fortschrittes sei.« Mit leichtem Spott schildert er dann die grotesken Zweikämpfe der Philosophen und Gelehrten, das Versagen der beiden großen Kollektivmächte, des Christentums und des Sozialismus, um sich selbst entschlossen von diesem Getümmel abzuwenden: »Die Vorstellung, daß die Vaterlandsliebe notwendigerweise den Haß der andern Vaterländer und das Massaker jener bedinge, die sie verteidigen, diese Vorstellung hat für mich eine absurde Wildheit, einen neronischen Dilettantismus, der mir widerstrebt bis in die letzten Tiefen meines Wesens. Nein, die Liebe zu meinem Vaterlande fordert nicht, daß ich die gläubigen und treuen Seelen, die das ihrige lieben, hasse und hinmorde. Sie fordert, daß ich sie ehre und mich mit ihnen zu unserem gemeinsamen Wohle vereine.« Und er fährt fort: »Zwischen uns Völkern des Abendlandes gab es keinen Grund zum Kriege. Abgesehen von einer Minderheit vergifteter Presse, die ein Interesse an der Aufzüchtung dieses Hasses hat, hassen wir Brüder in Frankreich, England und Deutschland einander nicht. Ich kenne sie und kenne uns. Unsere Völker verlangen nichts als den Frieden und ihre Freiheit.« Deshalb bedeutet es eine Schande für die Geistigen, wenn sie bei Kriegsausbruch die Reinheit ihres Denkens beschmutzen. Es ist schändlich, den freien Geist als Knecht der Leidenschaft einer kindlichen und absurden Rassenpolitik zu sehen. Denn nie dürfen wir die Einheit in diesem Zwiste vergessen, unser aller Vaterland. »Die Menschheit ist eine Symphonie großer gemeinsamer Seelen. Wer nur imstande ist, sie zu begreifen und sie zu lieben, wenn er zuvor einen Teil ihrer Elemente zerstört, zeigt, daß er ein Barbar ist ... Wir, die europäische Elite, haben zwei Heimstätten, unser irdisches Vaterland und die Stadt Gottes. In der einen sind wir zu Gast, die andere müssen wir uns selbst erbauen ... Es ist unsere Pflicht, den Wall um diese Stadt so weit und so hoch zu erbauen, daß sie die Ungerechtigkeit und den Haß der Nationen überhöht und die brüderlichen und freien Seelen der ganzen Welt in sich versammeln kann.«
Zu so hohen Idealen schwebt hier der Glaube auf wie eine Möwe über die blutige Flut. Freilich, Rolland weiß selbst, wie wenig diese Worte Hoffnung haben, das Getöse von dreißig Millionen waffenklirrender Menschen zu übertönen. »Ich weiß, daß diese Worte wenig Aussicht haben, gehört zu werden ... Aber ich spreche nicht, um zu überzeugen, sondern um mein Gewissen zu erleichtern. Und ich weiß, daß ich zugleich das von Tausenden andern erleichtere, die in allen Ländern nicht zu sprechen wagen, oder zu sprechen verhindert sind.« Wie immer, ist er bei den Schwächeren, bei der Minderheit. Und seine Stimme wird immer stärker, weil sie fühlt, daß sie für unzählige Schweigende spricht.
https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/rolland/chap070.html
Der Kampf gegen den Haß
Dieser Aufsatz »Au-dessus de la Mêlée« war der erste Axtschlag im wild aufgewucherten Walde des Hasses: dröhnendes Echo donnert von allen Seiten, es braust unwillig in den Blättern. Aber der Entschlossene läßt nicht ab: er will in das ungeheuere und gefährliche Dunkel eine Lichtung roden, durch die ein paar Sonnenstrahlen der Vernunft in die stickige Atmosphäre hereinschimmern können. Seine nächsten Aufsätze wollen Klarheit schaffen, einen hellen, reinen, fruchtbaren Raum; und vor allem wollen die schönen Aufsätze »Inter arma Caritas« (30. Oktober 1914), »Les Idoles« (4. Dezember 1914), »Notre prochain, l'ennemi« (15. Mai 1915), »Le meurtre des élites« (14. Juni 1915) den Schweigenden eine Stimme geben: »Helfen wir den Opfern! Freilich, viel vermögen wir nicht. Im ewigen Kampfe zwischen dem Guten und dem Bösen sind die Aussichten ungleich: man braucht ein Jahrhundert, um das aufzubauen, was ein Tag zerstört. Jedoch, die tolle Wut dauert nur einen Tag und die geduldige Arbeit ist das tägliche Brot aller Tage. Sie unterbricht sich selbst nicht in einer Stunde des Weltunterganges.«
Nun hat der Dichter klar seine Aufgabe erkannt: den Krieg zu bekämpfen wäre sinnlos. Vernunft bleibt machtlos gegen Elemente. Aber im Kriege das zu bekämpfen, was die Leidenschaften der Menschen wissend dem Entsetzlichen hinzutun, die geistige Vergiftung der Waffen, scheint ihm seine vorbestimmte Pflicht. Das Furchtbarste gerade dieses Krieges, das, was ihn so von allen früheren unterscheidet, ist seine bewußte Vergeistigung, der Versuch, ein Geschehnis, das vergangene Zeiten einfach als naturhaftes Verhängnis wie Pest und Seuche hinnehmen, heroisch in eine »große Zeit« zu verklären, der Gewalt eine Moral, der Vernichtung eine Ethik zu unterstellen, einen Massenkampf der Völker gleichzeitig in einen Massenhaß der Individuen zu steigern. Nicht den Krieg also bekämpft Rolland (wie vielfach vermeint wurde), er bekämpft die Ideologie des Krieges, die künstliche Vergöttlichung des ewig Bestialischen; und er bekämpft im einzelnen die träge, leichtfertige Hingabe an eine kollektive und bloß für Kriegsdauer konstruierte Ethik, die Flucht vor dem Gewissen in die Massenlüge, die Suspendierung der inneren Freiheit auf Kriegsdauer.
Nicht gegen die Massen, gegen die Völker wendet sich also sein Wort. Sie sind Unwissende, Belogene, arme Getriebene, denen man durch Lüge den Haß verständlich gemacht hat – »il est si commode de haïr sans comprendre« – »es ist so bequem zu hassen, wenn man nicht versteht«. Alle Schuld liegt bei den Treibern und bei den Fabrikanten der Lüge, bei den Intellektuellen. Sie sind schuldig, und siebenfach schuldig, weil sie, dank ihrer Bildung und ihrer Erfahrung, die Wahrheit wissen mußten und sie verleugnen, weil sie aus Schwäche und vielfach aus Berechnung sich der banalen Meinung angeschlossen haben, statt kraft der ihnen gegebenen Autorität die Meinung zu führen. Bewußt haben sie statt des einst vertretenen Ideals der Menschlichkeit und Völkereintracht spartanische und homerische Heldenidole rekonstruiert, die in unsere Zeit so wenig passen, wie Lanzen und Rüstungen zwischen Maschinengewehre. Und vor allem, sie haben den Haß, der allen Großen aller Zeiten eine verächtliche und niedere Begleiterscheinung des Krieges war, den die Geistigen durch Ekel, die Kämpfenden durch Ritterlichkeit von sich wiesen, diesen Haß haben sie nicht nur mit allen Argumenten der Logik, der Wissenschaft, der Dichtung verteidigt, sie haben ihn sogar (mit Suspendierung der christlichen Evangelienworte) zur sittlichen Pflicht erhoben und jeden, der sich gegen die kollektive Gehässigkeit wehrte, zum Verräter am Vaterland gestempelt. Gegen diese Feinde des freien Geistes hebt Rolland sein Wort: »Nicht nur, daß sie nichts taten, um das wechselseitige Mißverstehen zu vermindern und den Haß zu begrenzen, im Gegenteil: mit wenigen Ausnahmen haben sie alles getan, ihn auszubreiten und zu vergiften. Zum großen Teil war dieser Krieg ihr Krieg. Mit ihren mörderischen Ideologien haben sie Tausende von Gehirnen verführt und in frevelhafter Sicherheit ihrer Wahrheit, unbelehrbar in ihrem Stolze, Millionen fremder Existenzen für die Phantome ihres Geistes in den Tod getrieben.« Schuldig ist nur der Wissende oder der, dem die Möglichkeit gegeben war, wissend zu sein, der aber aus Trägheit der Vernunft und des Herzens, aus falscher Ruhmsucht oder Feigheit, aus Vorteilsgründen oder aus Schwäche sich einer Lüge hingegeben hat.
Denn der Haß der Intellektuellen war eine Lüge. Wäre er eine Wahrheit, eine Leidenschaft gewesen, so hätte er die Schwätzer das Wort wegwerfen und eine Waffe ergreifen lassen müssen. Haß und Liebe kann nur Menschen gelten, nicht Begriffen, nicht Ideen, deshalb war der Versuch, Haß zwischen Millionen unbekannter Individuen zu säen und ihn »verewigen« zu wollen, ein Verbrechen gegen den Geist so sehr, wie gegen das Blut. Deutschland zu verallgemeinern in einen einzigen Gegenstand des Hasses, Treibende und Getriebene in eine seelische Verfassung, war bewußte Fälschung. Es gab nur eine Gemeinsamkeit: die der Wahrhaftigkeit und die der Lügner, die der Menschen des Gewissens und die der Phrase. Und so wie Rolland im Johann Christof das wahre Frankreich vom falschen, das alte Deutschland vom neuen sonderte, um die allmenschliche Gemeinsamkeit zu zeigen, so unternimmt er mitten im Kriege den Versuch, die erschreckende Ähnlichkeit der Kriegsvergifter in beiden Lagern an den Pranger zu stellen und die heroische Einsamkeit der freien Naturen in beiden Ländern zu feiern, um – gemäß jenem Worte Tolstois – der Pflicht des Dichters gerecht zu werden, der »Bindende zwischen den Menschen« zu sein. Die »cerveaux enchainés«, die »gefesselten Gehirne« seiner Komödie Liluli, tanzen in verschiedenen Uniformen hüben und drüben unter der Peitsche des Negers Patriotismus den gleichen indianischen Kriegstanz: die deutschen Professoren und die der Sorbonne haben eine erschreckende Ähnlichkeit in ihren logischen Sprüngen und die Haßgesänge eine groteske Gleichheit des Rhythmus und der Konstruktion.
Das Gemeinsame aber, das Rolland zeigen will, soll zugleich eine Tröstung sein. Die Worte der menschlichen Erhebung sind freilich schwerer zu erspähen, als jene des Hasses, denn die freie Meinung muß durch einen Knebel sprechen, während die Lüge durch die Megaphone der Zeitungen dröhnt. Mühsam muß man die Wahrheit und die Wahrhaftigen suchen, weil der Staat sie versteckt, aber die beharrlich spürende Seele findet sie bei allen Völkern und Nationen. An Beispielen, Büchern und Menschen, deutschen wie französischen, beweist Rolland in diesen Aufsätzen, daß hüben und drüben, sogar oder gerade in den Schützengräben, ganz brüderliches Empfinden bei Tausenden und Abertausenden herrscht. Er veröffentlicht Briefe deutscher Soldaten neben denen französischer: sie sind in der gleichen menschlichen Sprache geschrieben. Er erzählt von der Feindeshilfe der Frauen und siehe: es ist die gleiche Organisation des Herzens inmitten der grausamen der Waffen. Er publiziert Gedichte von hüben und drüben: sie vereinen sich im Gefühl. Wie er einst in seinen »Biographien der Helden« den Leidenden der Welt zeigen wollte, daß sie »nicht allein seien, sondern die Größten aller Zeiten mit ihnen«, so sucht er denen, die inmitten der Tollheit sich in manchen Stunden selbst für Ausgestoßene halten, weil sie nichts von den gehässigen Empfindungen der Zeitungen und Professoren in sich fühlen, ihre unbekannten Brüder im Schweigen bekannt zu machen – wieder bemüht, die unsichtbare Gemeinde der freien Seelen zu vereinen. »Das gleiche Glück,« schreibt er, »das wir in diesen zitternden Märztagen beim Anblick der ersten aufschießenden Blumen empfinden, ich fühle es auch, wenn ich die zarten und kraftvollen Blüten menschlichen Mitleids die Eiskruste des Hasses Europas durchdringen fühle. Sie bezeugen, daß die Lebenswärme fortdauert und nichts sie zerstören kann.« Unerschütterlich setzt er »l'humble pèlerinage«, die »demütige Pilgerschaft« fort, bemüht, »unter den Ruinen die letzten Herzen zu entdecken, die dem alten Ideal der menschlichen Brüderschaft getreu blieben. Welche melancholische Freude, sie zu entdecken und ihnen zu Hilfe zu kommen.« Und um dieses Trostes, um dieser Hoffnung willen gibt er sogar dem Krieg, dem seit seiner frühesten Kindheit gefürchteten und gehaßten, einen neuen Sinn: »Der Krieg hat den schmerzvollen Vorteil gehabt, die Geister, die sich dem nationalen Hasse verweigern, auf der ganzen Welt zu vereinigen. Er hat ihre Kraft gestählt, zu einem ehernen Block, ihre Willen zusammengeschlossen. Wie doch jene sich täuschen, die meinen, die Ideen der Brüderlichkeit seien erstickt ... Ich zweifle nicht im mindesten an der zukünftigen Einheit der europäischen Gemeinschaft. Sie wird wahr werden. Und der Krieg von heute ist nur ihre blutige Taufe.«
Samariter der Seelen, sucht er so die Verzagten mit Hoffnung, dem Brot des Lebens, zu trösten. Vielleicht über seine eigenste innerste Meinung hinaus kündet er seine Zuversicht: und nur wer den Hunger der Zahllosen, in den Kerker eines Vaterlandes, hinter die Gitter der Zensur Gesperrten kannte, wird ermessen, was ihnen diese Manifeste des Glaubens, dies endlich vernommene Wort ohne Haß, diese Botschaft der Brüderlichkeit damals bedeutet haben.
https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/rolland/chap071.html