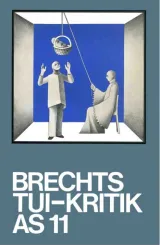Brechts Tui-Kritik
Aufsätze, Rezensionen, Geschichten
„Brechts Tui-Kritik" — die Ankündigung eines Buches dieses Titels wurde von vielen als Mystifikation empfunden. Selbst mancher, der sich als Brechtkenner empfindet, wußte mit dem Ausdruck „Tui-Kritik" nichts anzufangen. Ist das ein brauchbarer Titel, den so viele nicht verstehen? Wir denken, jeder wird ihn schnell verstehen lernen. Jeder kennt aus eigner Anschauung, was das ist, „Tuismus". Kein Intellektueller, der nicht schon mehr oder weniger nachhaltig von den Mechanismen des Marktes berührt worden wäre! Über so manche Diskussion hat sich der Tuismus wie Mehltau auf eine Pflanze gelegt.
Hier also die Worterklärung vorweg: „Tui" ist ein Kunstwort, von Brecht gebildet durch Verkehrung des Begriffs „intellektuell" in „Tellekt-Uell-In" — TUI.
Der Tui ist der Vermieter seiner Denkkraft und Formulierungskunst, der seine intellektuellen Fähigkeiten zugleich für den Konkurrenzkampf gegen andere Tui gebraucht, um die eigene Marktgeltung herauf- und die der andern herabzusetzen.
Mit der Tui-Kritik verhält es sich wie mit den philosophischen Lehren Brechts: bis heute steht für viele beides im Schatten der Stücke und Gedichte. Der Theoretiker Brecht und der Kritiker des gegen die gesellschaftliche Vernunft mißbrauchten Intellekts ist fast noch ein Geheimtip. Das ist kein Wunder, weil an den Schalthebeln des kulturellen Verteilungsapparats allzuviele sitzen, die sich von Brechts fröhlich beißender Kritik getroffen fühlen konnten. An die Tui-Figur heftete sich, vom fragmentarischen Charakter des Brechtschen Werkes begünstigt, eher ein biographisches Interesse an persönlichen Vorlieben oder Feindschaften, an vermeintlichen Marotten des Stückeschreibers.
Die Tui-Kritik ist für uns nicht hauptsächlich Objekt der Philologie oder Biographie, noch bloßer Anlaß, des zwanzigsten Todestages Brechts zu gedenken, sondern sie ist lebendige Forderung, Orientierung in der theoretischen Auseinandersetzung.
Die Kritik des Tui bedarf der Ergänzung durch die Vorschläge, die Brecht unter dem Titel des „eingreifenden Denkens" gemacht hat. Daher gehört in den Schwerpunkt des Heftes die Befassung mit dem, was Brecht als Haltung der Weisheit empfahl. Der Vermieter des Intellekts gewinnt scharfe Konturen erst vor dem Bild des Weisen und Lehrers, der „nützlichen" Verkörperung von Brechts Denk- und Verhaltenslehre.
Nicht nur in den Werken, die den Tui im Titel führen, wird sein Treiben von Brecht behandelt. Das servile Metier des Tui hetzt diesen berufsmäßigen Formulierer und Ausredner durch alle Gänge und Winkel des gesellschaftlichen Gefüges, in dem die Herrschenden seine Dienste in Anspruch nehmen, wird daher auch in mehr oder weniger allen Werken Brechts gestaltet und untersucht. Entsprechendes gilt für die Verhaltensmöglichkeiten nützlichen, eingreifenden Denkens. Daher erschien es uns sinnvoll, eine Untersuchung zu dem, was Brecht das „demonstrandum des dreigroschenromans" genannt hat, in unseren Band aufzunehmen sowie eine — zwar in der DDR bereits veröffentlichte, aber für westdeutsche Leser kaum zugängliche — Arbeit über „Brecht und die Schicksale der Materialästhetik", die das Konzept des
„Autors als Produzent" und damit einen der Gegenbegriffe zum „Autor als Tui" verfolgt.
Die Geschichten am Schluß stellen Versuche dar, aus der großen Fülle der täglich gehandelten Resultate tuistischen Fleißes zu erzählen, um den Fundus der durchschauten Tricks in vergnüglicher Weise anzureichern. Zugleich sind die Geschichten als Vorschläge aufzufassen, anhand des je neuen Materials Brechts Tui-Kritik fortzuführen. Das Festhalten an ihr ist geboten, solange es die Vermietung des Intellekts gibt, und den Einwand, sie erbringe nichts Neues, sondern lediglich die Wiederholung der Resultate eines Klassikers, wies bereits Me-ti zurück, als seinen Lehren der Mangel an Neuigkeit vorgehalten wurde: „Ich lehre es, weil es alt ist, d. h. weil es vergessen werden und als nur für vergangene Zeiten gültig betrachtet werden könnte. Gibt es nicht ungeheuer viele, für die es ganz neu ist? "
Wikipedia (DE): Tui (Intellektueller)
Autoreninfos
Weitere Autoren
Urs Bircher, Franco Buono, Herbert Claas, Manfred Diekenbrock, Jürgen Engelhardt, Gerhard Friedrich, Rainer Kawa, Werner Mittenzwei, Freya Mülhaupt, Gerhart Pickerodt, Karen Ruoff, Dieter Schlenstedt, Hartmut Stenzel, Dieter Thiele, Dieter Wöhrle
Analyse von Wolfgang Fritz Haugs Essay „Zur Aktualität von Brechts Tui-Kritik“
Zusammenfassung
Dieses Dokument fasst die zentralen Thesen und Argumente aus Wolfgang Fritz Haugs Aufsatz „Zur Aktualität von Brechts Tui-Kritik I“ zusammen. Haugs Analyse erweitert Bertolt Brechts Definition des „Tui“ als reinen „Vermieter des Intellekts“ in einer marktwirtschaftlichen Ära. Der Kerngedanke des Aufsatzes ist, dass das Wesen des Tuismus nicht allein aus der Warenform des Denkens entspringt, sondern fundamental in den Klassenverhältnissen und der damit verbundenen ideologischen Herrschaftssicherung verwurzelt ist.
Die Schlüsselerkenntnisse sind:
- Erweiterte Definition des Tui: Haug argumentiert, dass Brechts Definition zu eng ist. Der Tui ist nicht nur ein Produkt von „Märkten und Waren“, sondern entstammt historisch und strukturell den Verhältnissen der Klassenherrschaft, vergleichbar mit dem Klerus oder Staatsdienern, die als „Surplus-Esser“ am Mehrprodukt partizipieren.
- Die Klassenbasis: Unter Berufung auf Marx und Engels wird der Tui als Teil der Arbeitsteilung innerhalb der herrschenden Klasse verstanden. Tuis sind die „aktiven konzeptiven Ideologen“, die die „Illusion dieser Klasse über sich selbst“ zu ihrem Hauptnahrungszweig machen und damit die Herrschaftsverhältnisse legitimieren.
- Ambivalenz des Intellektuellen: Die gesellschaftliche Position des Intellektuellen wird als „schillernd“ beschrieben – sie schwankt zwischen der Legitimation von Herrschaft und idealistischen Impulsen, die über Klassenschranken hinausweisen.
- Der „Standpunkt des Bauches“: Die entscheidende Determinante ist nicht, ob geistige Arbeit verkauft wird, sondern ob sie sich „mit dem Kopf oder mit dem Bauch zur Gesellschaft“ verhält. Der Tui denkt antizipatorisch im Sinne der zahlungskräftigen Herrschenden, was eine Artistik des Denkens erfordert, die sich nach Klasseninteressen statt nach Erkenntnis ausrichtet.
- Tui-Techniken: Haugs Analyse identifiziert konkrete Strategien der Herrschaftslegitimation, wie die Transposition materieller Interessen in eine geistige Sphäre, die Umdeutung von Partikularinteressen zu Allgemeininteressen und die Nutzung begrifflicher Winkelzüge.
- Brechts künstlerische Absicht: Der Tui auf der Bühne ist keine naturalistische Abbildung der Intelligenz, sondern eine stilisierte Kunstfigur. Er repräsentiert die gesellschaftliche Funktion der Indienstnahme des Intellekts für Herrschaftszwecke in reiner Form, um diese Mechanismen für das Publikum durchschaubar zu machen, wie es die „Brotkorb-Szene“ exemplarisch zeigt.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Das Tui-Konzept: Jenseits von Markt und Ware
Wolfgang Fritz Haug beginnt seine Analyse mit Brechts prägnanter Definition des Tui: „Der Tui ist der Intellektuelle dieser Zeit der Märkte und Waren. Der Vermieter des Intellekts.“ Er stellt jedoch umgehend fest, dass diese Definition zu eng gefasst ist, um das Phänomen, das Brecht darstellt, vollständig zu erfassen.
- Historische Vorläufer: Das Anschauungsmaterial für die Tui-Figur entstammt laut Haug wesentlich den Verhältnissen der Klassenherrschaft. Brecht greift auf historische Figuren wie den Klerus, insbesondere den klösterlichen, zurück, um Habitus, Hierarchie und Denkschulen zu illustrieren. Diese waren nicht primär durch Ware-Geld-Beziehungen geprägt. Ihre Funktion basierte auf der Formel: Der Ideologe sichert die Herrschaft und wird im Gegenzug an der Ausbeutung beteiligt.
- Der Tui als „Surplus-Esser“: Ähnlich dem Pfaffen oder dem späteren Staatsdiener zehrt der Tui vom gesellschaftlichen Mehrprodukt. Seine Gedanken werden nicht zwangsläufig unmittelbar auf dem Markt verkauft. Er ist ein „Surplus-Esser“, dessen Existenz auf der materiellen Produktion anderer beruht.
2. Die Klassenbasis des Tuismus
Die entscheidende Grundlage für das Verständnis des Tui ist der Klassengegensatz. Haug stützt sich hierbei maßgeblich auf die Analysen von Karl Marx und Friedrich Engels.
- Arbeitsteilung in der herrschenden Klasse: In der „Deutschen Ideologie“ zeigen Marx und Engels auf, dass sich innerhalb der herrschenden Klasse eine Arbeitsteilung zwischen geistiger und materieller Arbeit entwickelt.
- Die „Denker dieser Klasse“ (die Tuis) fungieren als „aktive konzeptive Ideologen“, deren Hauptaufgabe es ist, „die Ausbildung der Illusion dieser Klasse über sich selbst zu ihrem Hauptnahrungszweig“ zu machen.
- Die „aktiven Mitglieder dieser Klasse“ (Kapitalisten, Herrscher) verhalten sich zu diesen Gedanken passiv und rezeptiv, da sie weniger Zeit haben, sich selbst Illusionen zu schaffen.
- Die „schillernde“ Position des Intellektuellen: Diese Arbeitsteilung führt zu einer ambivalenten, „schillernden“ Position der Intelligenz.
- Ihre Klassenlage kann vom „Herrenmenschen bis hin zum Lumpenproleten“ reichen.
- Ihre ideologische Tendenz schwankt zwischen „skrupelloser Herrschaftslegitimation“ und „großartiger, über die Klassenschranken hinausleuchtender idealischer Illusion“.
- Diese Ambivalenz bedeutet, dass keine Bestimmung der Intelligenz existiert, die nicht auch in ihr Gegenteil umschlagen könnte.
3. Der Warencharakter des Denkens und der „Standpunkt des Bauches“
Haug untersucht die Konsequenzen, die sich aus der Vermarktung von Gedanken ergeben, betont aber, dass die Warenform allein nicht der entscheidende Faktor für den Tuismus ist.
- Verkauf von Meinungen: Der alte Bauer Sen in Brechts „Kongreß der Weißwäscher“ bringt es auf den Punkt: „Die Gedanken, die man hier kauft, stinken ... Man verkauft Meinungen wie Fische, und so ist das Denken in Verruf gekommen.“
- „Verkaufen“ vs. „sich verkaufen“: Haug differenziert scharf:
- Der reine Verkauf eines geistigen Produkts als Ware macht dieses nicht zwangsläufig unbrauchbar oder korrumpiert. Ein Intellektueller kann „anständige Ware“ verkaufen, die auch für die Werktätigen nützlich ist.
- Der entscheidende Akt ist, wenn ein Kopfarbeiter „sich verkauft“. Dies bedeutet, dass er seinen Kopf in den Dienst derer stellt, die über Reichtum und Macht verfügen. Dieses „Sich-Verkaufen“ bedarf keines formellen Tauschverhältnisses.
- Der „Standpunkt des Bauches“: Der zentrale Mechanismus des Tuismus ist das Denken aus dem „Standpunkt des Bauches“. Der Intellektuelle versucht, so zu denken, „wie die Besitzenden es ihm honorieren werden“. Dies erfordert „antizipatorische Anstrengungen und Einfühlungsvermögen hohen Grades“ und führt zu einer „erstaunlichen Artistik des Denkens“.
- Die inhaltliche Ausrichtung des Denkens entspringt somit nicht der Warenform als solcher, sondern den konkreten Klasseninteressen und -kämpfen.
- Die Folge ist eine Standpunktlosigkeit, die es dem Tui erlaubt, jeden beliebigen Standpunkt eines zahlungsfähigen Käufers einzunehmen.
4. Marx’ Analyse als Paradigma der Tui-Kritik
Haug illustriert das Wesen des Tuismus anhand von Marx’ Kritik an politischen Ökonomen, die zeigt, dass der Ausdruck „bürgerlicher Intellektueller“ zu undifferenziert ist.
| Intellektuellen-Typus | Charakterisierung laut Marx | Funktion / Merkmal |
| Der Tui (Beispiele) | ||
| McCulloch | Ein Mann, der mit Ricardos Theorie „Geschäfte machen wollte“. Er war Plagiator, Karrierist und passte Theorien an die Interessen seiner Gönner (Whigs) an. | Vermarktung fremder Ideen, Anpassung an politische Interessen, Streben nach Posten und Pfründen. |
| Malthus | Ein „professioneller Sykophant“ der herrschenden Klassen. Er rechtfertigte Armut und Elend als gottgewollt und zeichnete sich durch „Grundgemeinheit der Gesinnung“ und „schamlos handwerksmäßig betriebenen Plagiarismus“ aus. | Rücksichtsvolle, nicht rücksichtslose Konsequenz aus wissenschaftlichen Prämissen; ideologische Rechtfertigung des Status quo. |
| Der Gegenentwurf | ||
| Ricardo | Verkörpert „wissenschaftliche Ehrlichkeit“ und „impartiality“. Sein Standpunkt ist „Produktion der Produktion halber“, da er die kapitalistische Produktionsweise für die vorteilhafteste hielt. | Erkenntnis der Erkenntnis halber (im Rahmen seiner historischen Voreingenommenheit); rücksichtsloses Denken, das nicht von äußeren Interessen geleitet wird. |
Marx’ entscheidendes Kriterium für intellektuelle Verworfenheit fasst Haug mit dessen Zitat zusammen: „Einen Menschen aber, der die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst (...), sondern von außen, ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehnten Standpunkt zu akkomodieren sucht, nenne ich ‚gemein‘.“
5. Techniken und Strategien der Tui-Legitimation
Der Tui erfüllt seine ideologische Hauptaufgabe – die Rechtfertigung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse – durch eine Reihe spezifischer Techniken, die auf dem Grundsatz „Das Bewusstsein bestimmt das Sein“ basieren.
- Transposition ins Geistige: Materielle Interessen werden in eine ideologische Sphäre verlagert. Im Tui-Roman heißt es über die Staatschefs in Versailles: Sie warfen dem Gegner nicht vor, „Petroleum oder Erzlager“ gestohlen zu haben, sondern sprachen von seinem „Eroberungswillen“ und seiner „Barbarei“. So fiel die Unterhaltung „niemals unter ein geistiges Niveau hinunter“.
- Partikularinteressen als Allgemeininteresse: Es besteht die ständige Notwendigkeit, „ein besonderes Interesse als Allgemeines oder ‚das Allgemeine‘ als herrschend darzustellen“.
- Winkelzüge mit Begriffen: Tuis nutzen den Unterschied zwischen Begriff und Sache. Beispiel: Franz-Josef Strauß’ Replik „Der Eigentumsbegriff ist unteilbar!“ auf die Forderung nach Mitbestimmung. Während Eigentum (die Sache) teilbar ist, kann der Begriff als unteilbar postuliert werden, um die Forderung abzuwehren.
- Umlenken von Wut und Angst: Ein Wirtschaftsblatt erklärt den Rückgang der Selbständigen nicht mit der Kapitalkonzentration, sondern mit hohen „Steuer- und Soziallasten“ und einer „von linken Kräften gesteuerten Verleumdungskampagne“. Die Wut wird so von den Verursachern (Großkapital) auf den Sozialstaat und „die Linke“ gelenkt.
- Umdeutung von Elend: Ein Redner auf einem Kongress verteidigt die bestehenden Zustände mit dem Argument, dass nur in ihnen das „Recht auf Trübsinn“ existiere, während eine utopische Gesellschaft ihren Mitgliedern nicht gestatten könne, unglücklich zu sein.
6. Brechts künstlerische Absicht: Der Tui als Bühnenfigur
Haug verteidigt Brechts Tui-Konzept gegen Kritiker wie Ilja Fradkin, der Brechts Einschätzung der Intelligenz für falsch hielt. Haug stellt klar, dass Brechts Tui-Figur nicht naturalistisch zu verstehen ist.
- Keine Abbildung der Realität: Die Tuis sind nicht identisch mit „der Intelligenz im Kapitalismus“. Die Figur ist vielmehr eine „zur Kunstfigur ästhetisch konkretisierte Dimension gesellschaftlicher Indienstnahme des Intellekts für Zwecke der Klassenherrschaft“. Sie ist das reine, „entmischte“ Konzentrat eines Funktionszusammenhangs.
- Ziel der Durchschaubarkeit: Die Figur soll dem Publikum – insbesondere den Intellektuellen – helfen, sich ihrer eigenen Verstrickungen bewusst zu werden und sich entschiedener für Demokratie und die Arbeiterbewegung einzusetzen. Das Theater soll das Publikum „gewitzter“ machen.
- Die „Brotkorb-Szene“ als Beispiel: Diese Szene aus „Turandot“ (Szene 4a) zeigt exemplarisch Brechts Methode.
- Problem: Wie wird ein idealistischer Jüngling zum Tui?
- Bühnenlösung: Ein Tui-Schüler muss eine Rede halten. Der Lehrer bedient eine Vorrichtung, mit der ein Brotkorb vor den Augen des Redners gehoben oder gesenkt wird. Der Lehrer sagt: „Immer wenn ich den Brotkorb höher ziehe, weißt du, daß du etwas Falsches sagst.“
- Funktion: Ein komplexer, in der Realität vermittelter Prozess der Korrumpierung und Anpassung wird als unmittelbar anschaulicher Vorgang auf die Bühne gebracht. Dies legt den „harten Kern“ frei und macht Mechanismen wie die Berufsverbote für linke Lehramtskandidaten verständlich, die Haug als real existierenden „Brotkorb“ bezeichnet.
7. Selbstreflexion: Die Vereinnahmung der Tui-Kritik
Im Nachtrag warnt Haug davor, dass auch die Tui-Kritik selbst tuistisch werden kann. Als Beispiel nennt er den Germanisten Reinhold Grimm, der die Tui-Figur zu einem bloßen „Motiv der Intellektuellenkritik“ degradiert. Indem er eine motivgeschichtliche Verbindung zu Nietzsche herstellt, wird das Interesse an Brechts Kritik zu einem „Desinteresse am objektiven Tui-Problem“ gelehrt. Haug schließt mit der Feststellung: „Der Tuismus hat seine Kritik wieder eingeholt!“
Erstellt: 12.11.2025 - 05:38 | Geändert: 12.11.2025 - 07:36