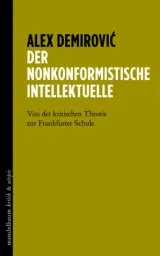Der nonkonformistische Intellektuelle
Von der kritischen Theorie zur Frankfurter Schule
Die Studie zeigt, wie die kritischen Theoretiker nach dem Nationalsozialismus zur Erneuerung der marxistischen Theorie in Westdeutschland beigetragen haben. Vernunft und Theorie sollten wieder verbindlich gemacht werden. Die Grundlage dafür bildete die Lehre an der Universität und der Wiederaufbau des Instituts für Sozialforschung.
Die Studierenden sollten auf anspruchsvollste Weise mit philosophischen Begriffen, mit den Bewegungsgesetzen der bürgerlichen Gesellschaft und mit empirischen Methoden vertraut gemacht werden. Als anti-autoritäre Intellektuelle sollten sie sich nicht auf mächtige Tendenzen der Geschichte berufen, sondern autonom denken sowie widerständig und demokratisch handeln.
Untersucht wird, wie Horkheimer und Adorno die institutionellen Bedingungen für diese neue Form kritischer Intellektualität schufen, wie sie ihre Lehre und Forschung durchführten, um eine emanzipatorische Wahrheitspolitik zu ermöglichen, der es um die Veränderung des Ganzen geht.Nach über 20 Jahren ist die bahnbrechende Studie zu den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten Max Horkheimers und Theodor W. Adornos nach ihrer Rückkehr aus dem Exil wieder erhältlich.
Die aktualisierte Neuauflage ist um ein Nachwort ergänzt.
Inhaltsverzeichnis und Leseprobe des Verlags
Unscharfer Ausdruck: Die 1999 erstmals erschienene Monographie »Der nonkonformistische Intellektuelle« erzählt die Geschichte des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und konzentriert sich dabei vor allem auf die Lehre und Forschung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Die Neuauflage des Buchs des Sozialwissenschaftlers Alex Demirović steht allerdings vor dem Problem, dass die Bedingungen für nonkonformes Denken an der Universität noch schlechter sind als Mitte des 20. Jahrhunderts: In seinem Essay »Traditionelle und kritische Theorie« benannte Max Horkheimer die »möglichst strenge Weitergabe der kritischen Theorie« als eine Bedingung ihres Erfolgs. Im Deutschland der Nachkriegszeit bemühten sich Horkheimer und Theodor W. Adorno darum bekanntlich an der Universität in Frankfurt am Main. Dass Wahrheit und Vernunft ein Subjekt als Träger brauchen, ist auch der Ausgangspunkt von Alex Demirovićs monumentaler Monographie (...). Von Leon Maack jungle.world 14.03.2024
Die Praxis der Kritischen Theorie: Die Studie »Der nonkonformistische Intellektuelle« ist neu aufgelegt – und wurde in Frankfurt mit deren Autor Alex Demirović aktuell diskutiert: (...) 100 Menschen sind gekommen, um der Vorstellung von Alex Demirović’ Buch »Der nonkonformistische Intellektuelle« beizuwohnen, das ihn, wie er sagt, »zwölf Jahre meines Lebens gekostet hat«. Stephan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung (IfS), und Christina Engelmann, die an einer aktuellen Studie zu feministischen Perspektiven auf die Geschichte des IfS mitgearbeitet hat, diskutieren die neu aufgelegte Studie zur Erneuerung des marxistischen Denkens durch die Kritische Theorie im Nachkriegsdeutschland. Von Lukas Geisler Neues Deutschland 02.02.2024
Soziologe Alex Demirovic zur Frankfurter Schule: Der ewige Kampf des Nonkonformisten: Soziologe Alex Demirovic stellt ein dickes Buch über die Frankfurter Schule vor. Dieses Buch muss es in sich haben. Der Autor erinnert sich an einen zwölf Jahre dauernden Entstehungsprozess. Sein Gedanke dabei sei häufiger gewesen: „Ich sterbe.“ 800 Seiten umfasst das Werk des in Frankfurt lehrende Gesellschaftswissenschaftlers Alex Demirovic, in dem er kurzerhand die ganze Geschichte der kritischen Theorie aufgeschrieben hat. Und hört man Redner und Rednerinnen an diesem Abend zu, kann man zu gar keinem anderen Schluss gekommen: Das Buch hat es tatsächlich in sich. Von Baha Kirlidokme Frankfurter Rundschau 25.01.2024
REZENSION: Dicke Bücher können vieles sein; gleich den dicken Menschen sagt diese Eigenschaft nichts über ihr Wesentliches aus. Bei jenen aber denkt man unweigerlich an eine Regel: dass das dicke Buch gewichtig ist, weil es einen Gegenstand entweder gründlich darstellt, zusammenfasst und voraussetzungslos in ihn einführt oder seine Entdeckung im bruchlosen Zusammenhang auseinanderlegt. Jedenfalls ist die Meinung gänzlich herkömmlich, ein Brocken an theoretischer Literatur hätte alles in sich einverleibt, was zu seiner Aneignung vonnöten sei. Dies ist beim großen Werk von Alex Demirović anders. Denn ungleich den bekannten geschichtlichen Darstellungen der sogenannten Frankfurter Schule oder Teilen daraus von Jay und Wiggershaus bis Steinert und Dubiel, die auf traditionelle Weise ordnungsgemäß ihrem Untersuchungsgegenstand thematistisch und mit einheitlicher Methode zu Leibe rücken, ist das Verfahren Demirovićs und der Charakter seines Buches radikal supplementär: weder löst es eine Problematik aus den Texten heraus noch wird eine empirische Geschichte neben ihnen dargestellt, sei es eine biographische oder soziale. Was zur Sprache kommt ist Hintergründiges, das die Struktur der Texte oder der Gesellschaft weniger grundiert als ihr hinzugeführt wird. Natürlich geht es nicht um Anekdoten; sondern in einem sehr präzisen Sinn geht es um die Dokumentation von Spuren der Intention, aus denen die Texte herausgewachsen waren wie auch von solchen, die ihre Veröffentlichung und Verbreitung begleitet haben. Wegen des einheitlichen Charakters der Texte, die gegebene Gesellschaft auch bei scheinbar entlegenen Thematiken zu entziffern und zu analysieren, ist das Begreifen der Intentionen nicht psycho- oder sozioanalytisch motiviert, sondern in dem Sinne politologisch, dass die Macht als Erscheinungsform der Gestaltbarkeit im Zentrum steht: die Texte haben nur insoweit Relevanz, als sie in einem Verhältnis zur Praxis stehen. ueliraz.ch 1999
Pressenotizen Perlentaucher
Der Autor
Alex Demirović, geb. 1952, Promotion in Philosophie, Apl. Prof. für Politikwissenschaft und Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Mitgründer der Assoziation für kritische Gesellschaftsanalyse. Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung 1991−2001, zahlreiche Gastprofessuren, darunter in Wien, Wuppertal, Berlin, Paris, Toronto. Arbeitsschwerpunkte: Kritische Gesellschaftstheorie, Demokratietheorie, Diskursanalyse.
Erstellt: 11.02.2025 - 12:10 | Geändert: 18.02.2025 - 12:55