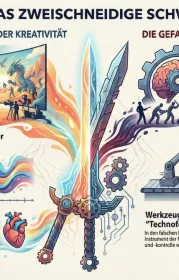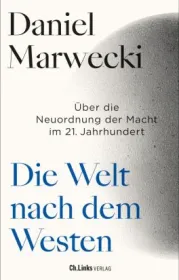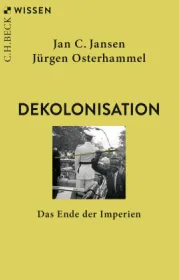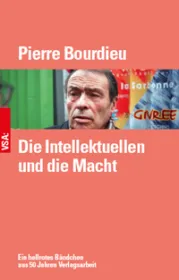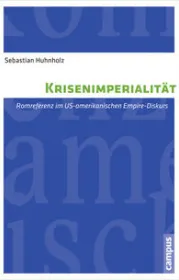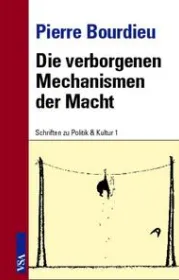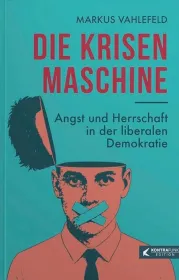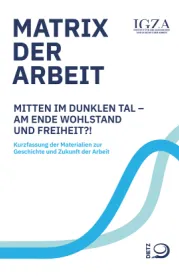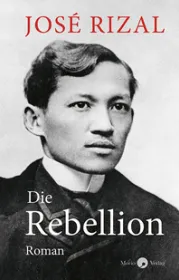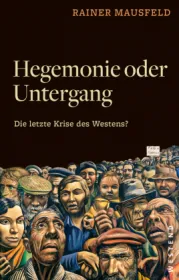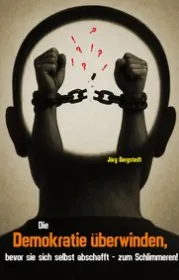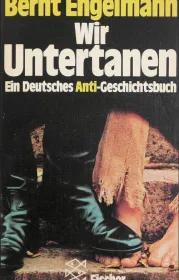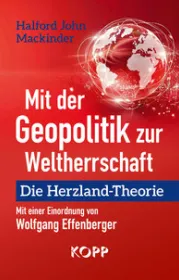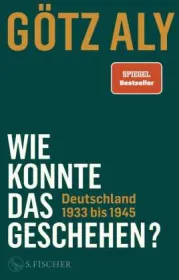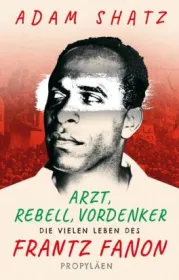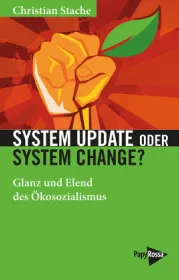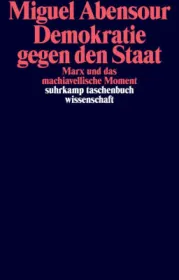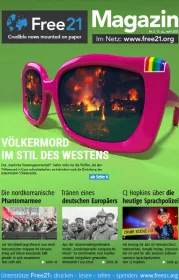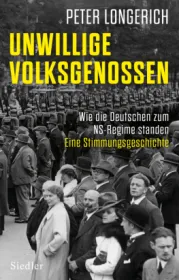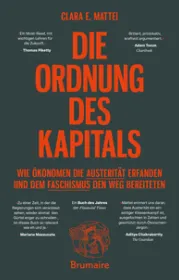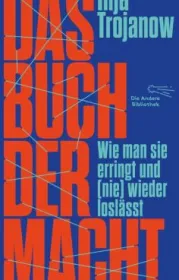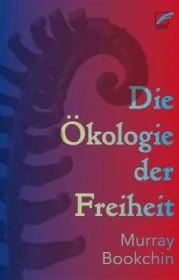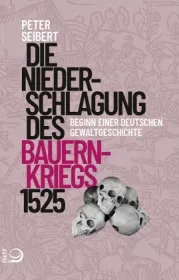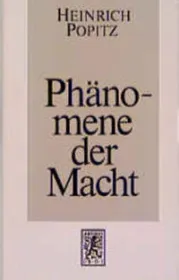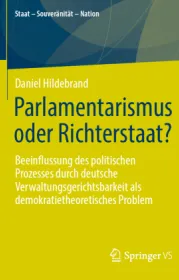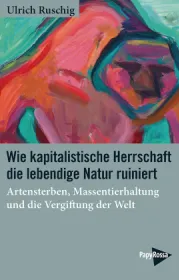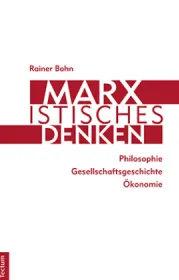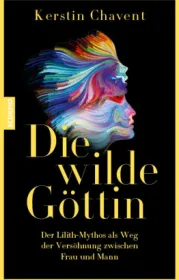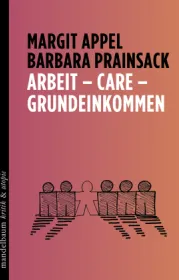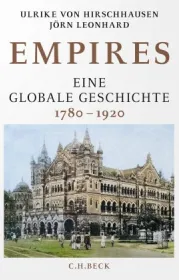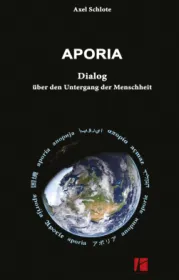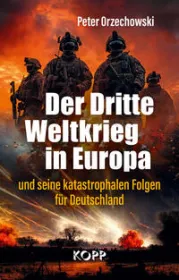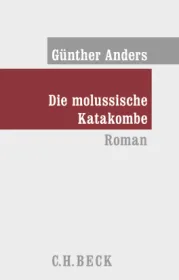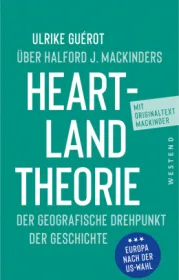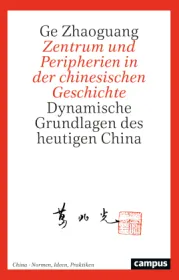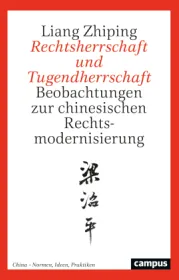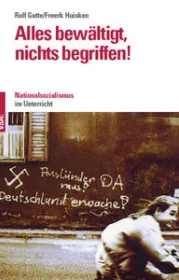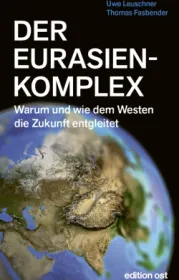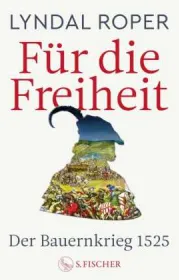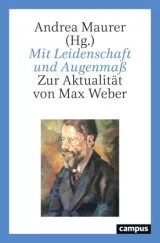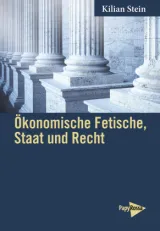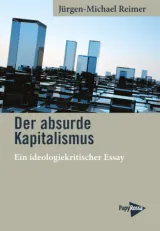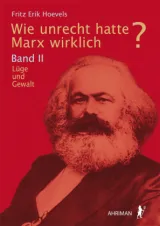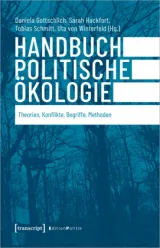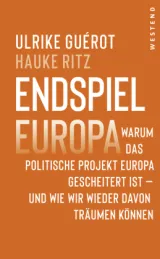Max Weber gilt als der Begründer der modernen Sozialwissenschaften und vor allem der Soziologie. Er ist durch seine Studie zur Protestantischen Ethik (1904/05) und durch seine Vorträge »Beruf zur Wissenschaft« und »Beruf zur Politik« weltberühmt geworden. Weber legte darüber hinaus bestechende und bis heute einflussreiche Analysen der modernen westlichen Gesellschaften und des rationalen Kapitalismus vor. Der Band bündelt aktuelle Einschätzungen renommierter Wissenschaftler_innen und gibt Auskunft über die Wirkung und die Weiterführung wichtiger Weber’scher Konzepte und Studien.
Wikipedia (DE): Herrschaft