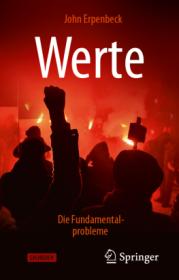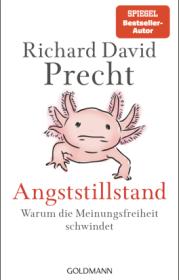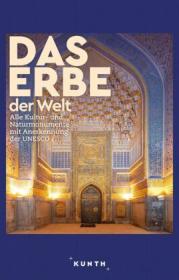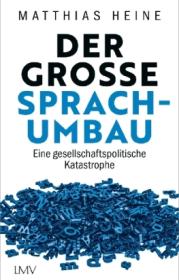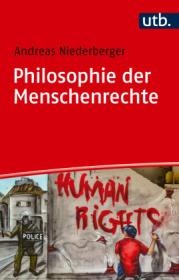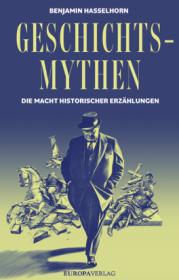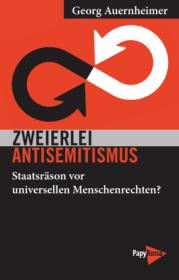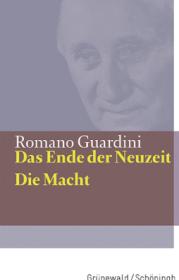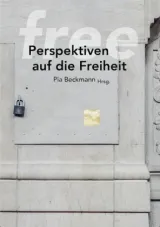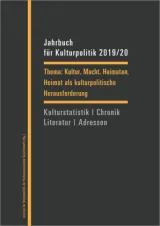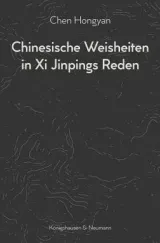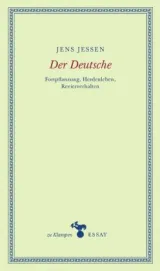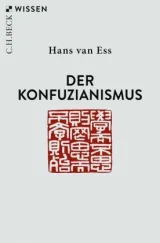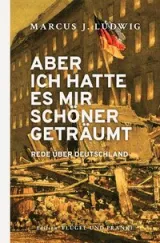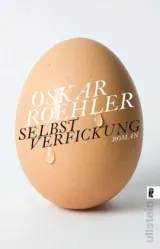"Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen oder nicht wahrnehmen und die uns im Leben dennoch stark beeinflussen." Winfried Muthesius
Was bedeutet uns Freiheit? Kann sie an Diffamierung grenzen? Wann geraten Gerichte an ihre Grenzen? Stärkt Protest demokratische Freiheitsrechte in Zeiten einer Pandemie? Können wir wieder so vorurteilsfrei werden wie ein Kind? Wie frei ist die Generation der Millenials eigentlich? Werden die Seufzer der Opfer und Täter im Gold lautlos verwahrt? Kann Kunst und Kultur den Menschen besser machen? Was hat Freiheit mit Kreativität zu tun? Diesen Fragen gehen namhafte Autor_innen im Alter von 17 bis 64 Jahren aus ihrer Perspektive nach. Gleichzeitig werden einzelne Schicksale ins Visier genommen.