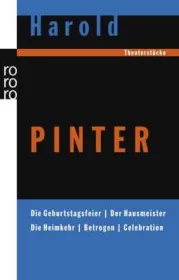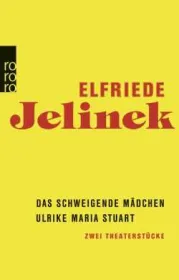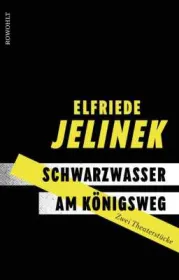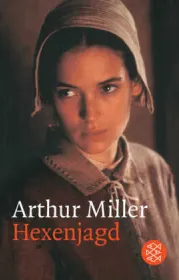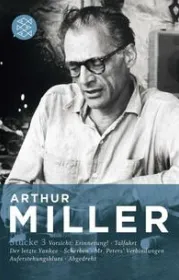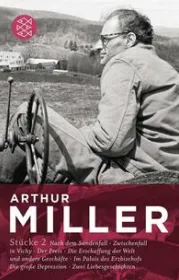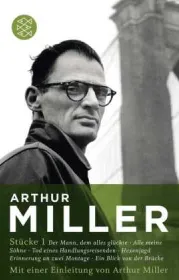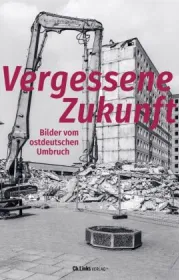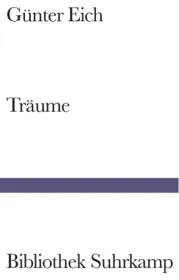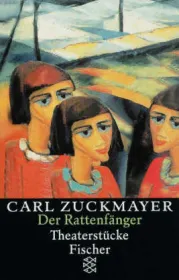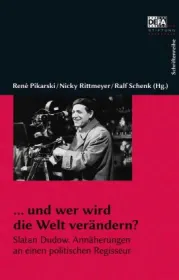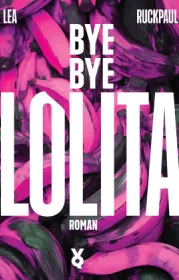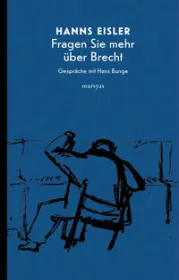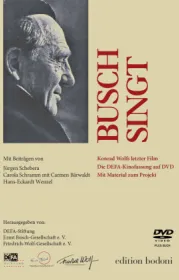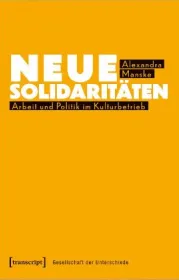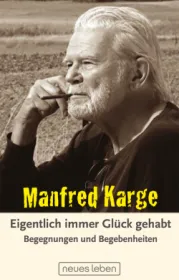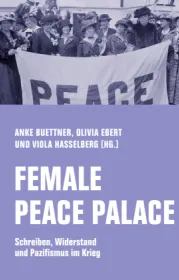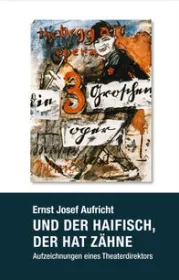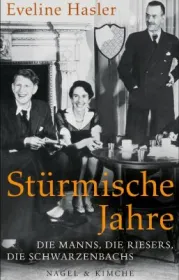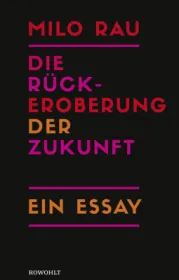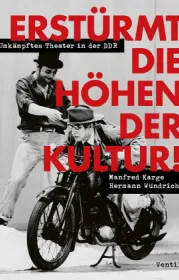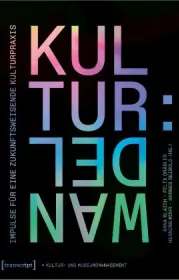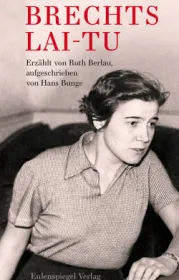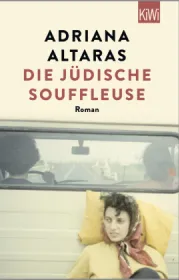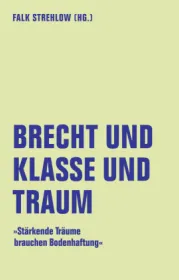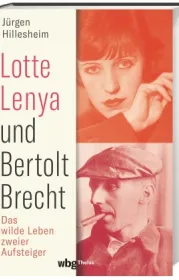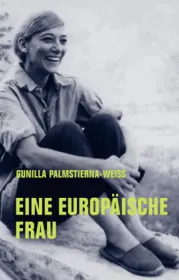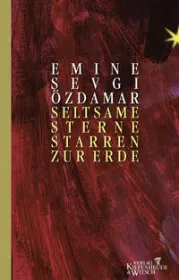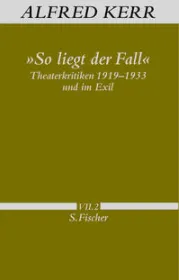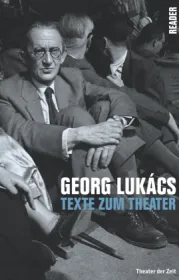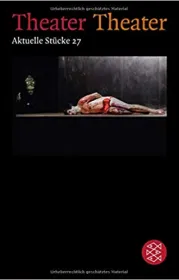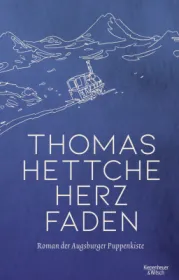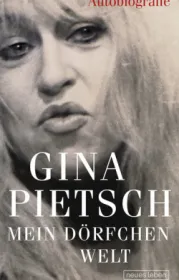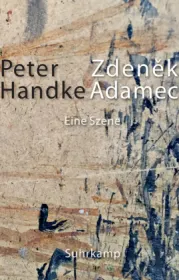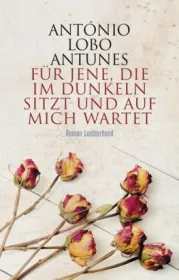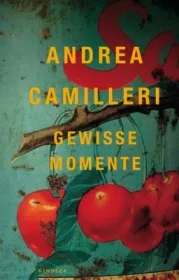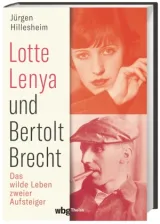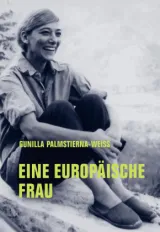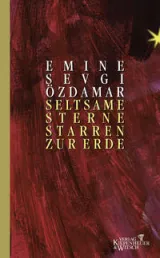Ein Klassiker der modernen Theaterliteratur.
"Der leere Raum" basiert auf vier Vorlesungen, die Peter Brook unter dem Titel The Empty Space: The Theater Today in den sechziger Jahren an den Universitäten von Hull, Keele, Manchester und Sheffield hielt. 1968 erschienen diese Gedanken zum Gegenwartstheater in Buchform. Nachdem der Band für längere Zeit vergriffen war, machte ihn der Alexander Verlag 1983 wieder greifbar für das deutsche Publikum. Brook unterteilt das Theater in vier verschiedene Formen: Das konventionelle Theater definiert er als "tödlich", das an Ritualen festhaltende Theater als das "heilige", das leicht verständliche, volksnahe Theater als "derbes" und das von ihm favorisierte als "unmittelbares Theater".