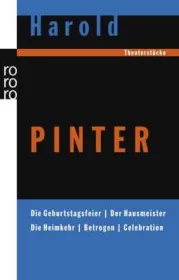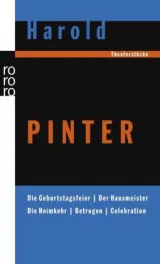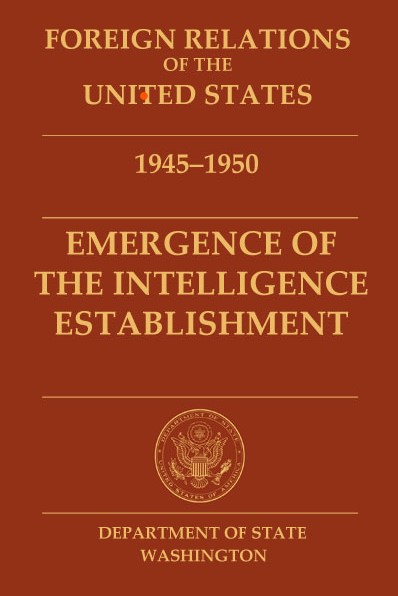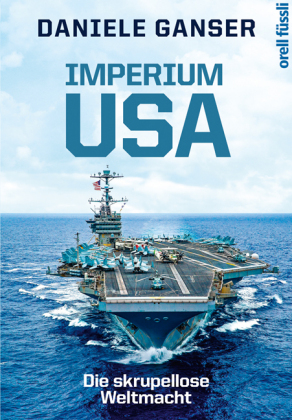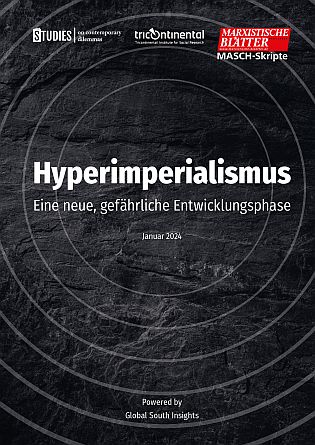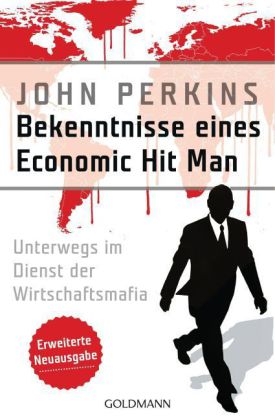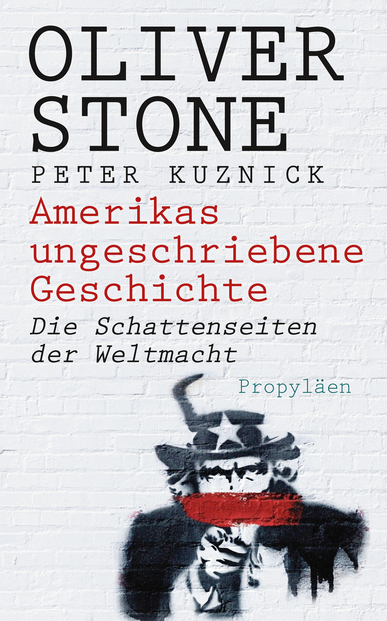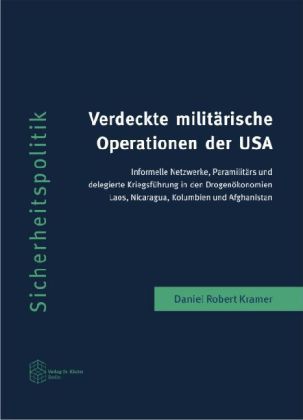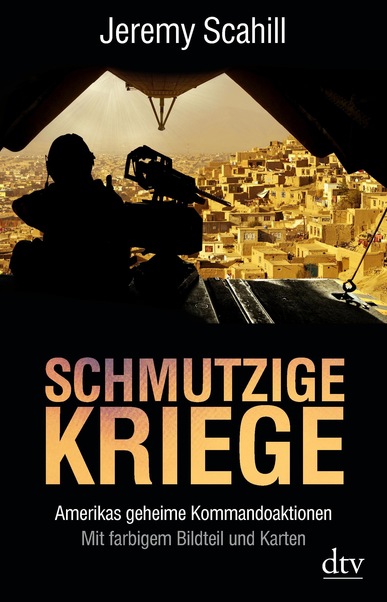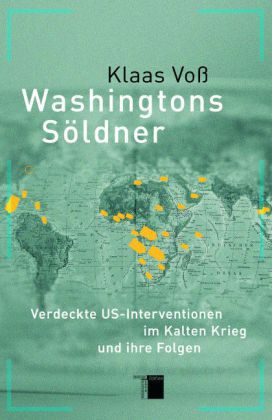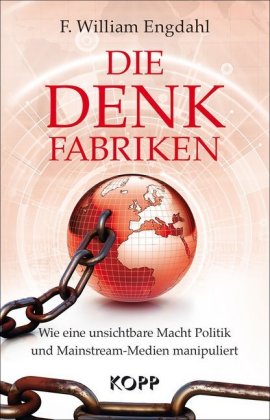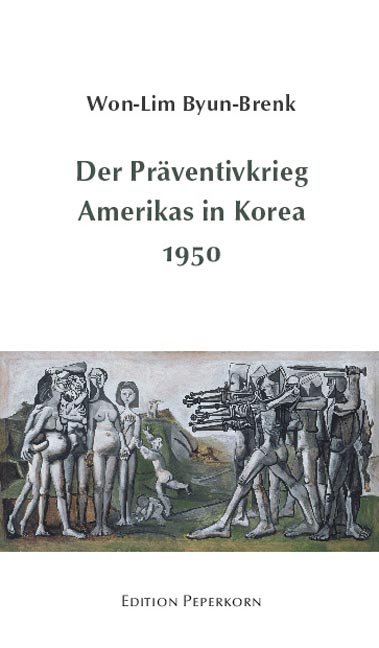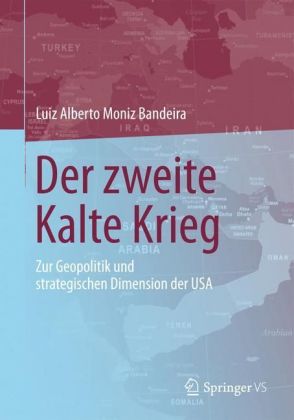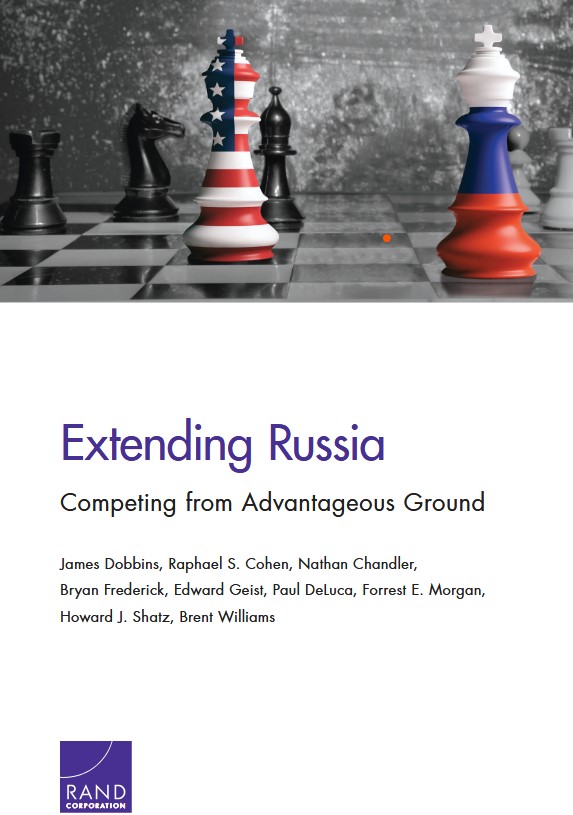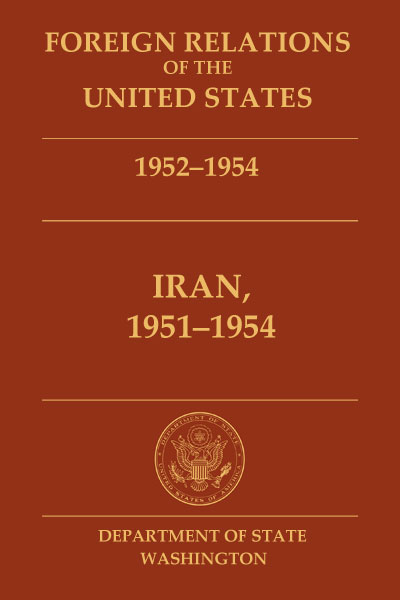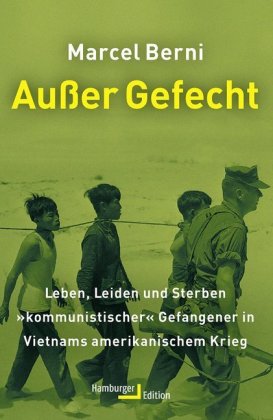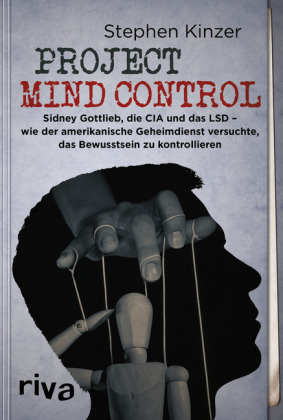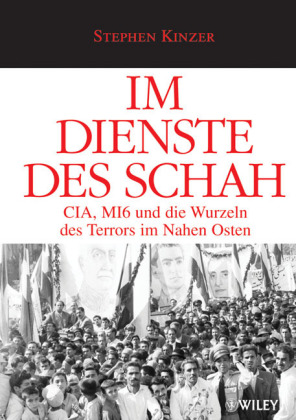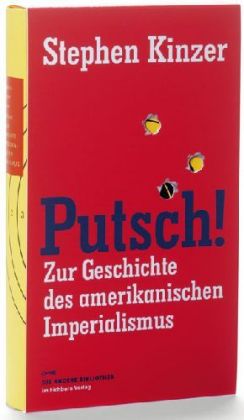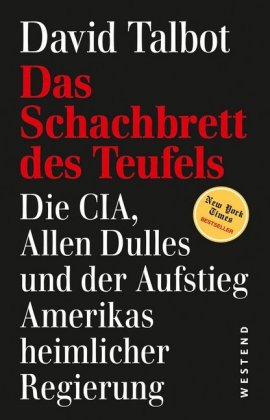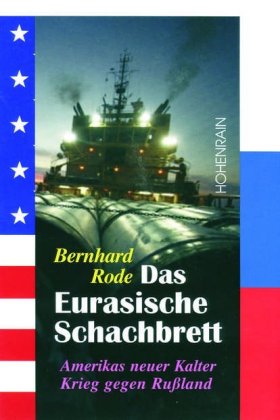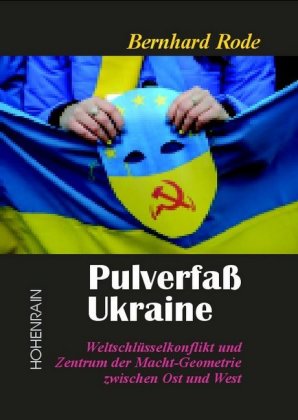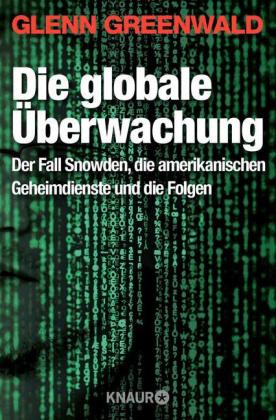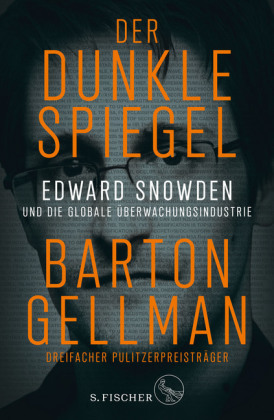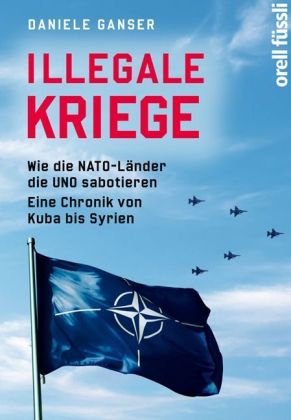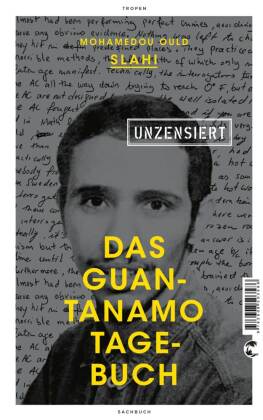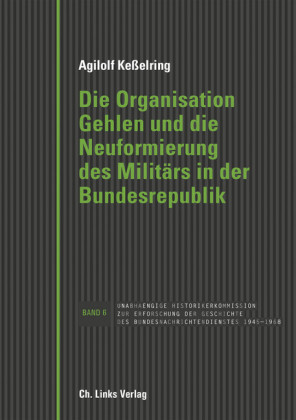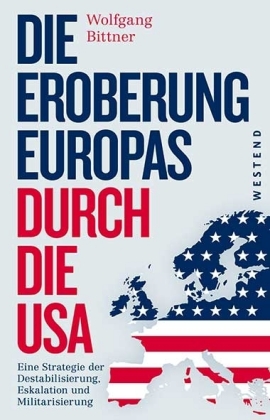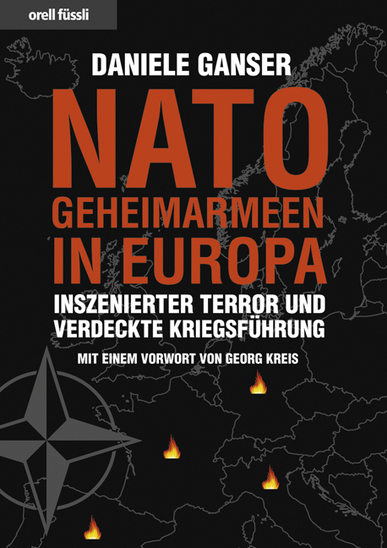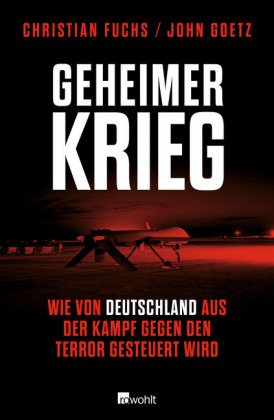Harold Pinters Nobelvorlesung „Kunst, Wahrheit & Politik“
Kunst, Wahrheit & Politik: 1958 schrieb ich folgendes: „Es gibt keine klaren Unterschiede zwischen dem, was wirklich und dem was unwirklich ist, genauso wenig wie zwischen dem, was wahr und dem was unwahr ist. Etwas ist nicht unbedingt entweder wahr oder unwahr; es kann beides sein, wahr und unwahr.“
Ich halte diese Behauptungen immer noch für plausibel und weiterhin gültig für die Erforschung der Wirklichkeit durch die Kunst. Als Autor halte ich mich daran, aber als Bürger kann ich das nicht. Als Bürger muss ich fragen: Was ist wahr? Was ist unwahr? Harold Pinter – Nobelvorlesung 2005
Zusammenfassung
Dieses Dokument fasst die zentralen Thesen von Harold Pinters Nobelvorlesung aus dem Jahr 2005 zusammen. Pinter etabliert eine fundamentale Dichotomie zwischen der Natur der Wahrheit in der Kunst und der Rolle der Wahrheit in der Politik. In der Kunst beschreibt er die Wahrheit als schwer fassbar, vieldeutig und oft widersprüchlich – ein Zustand, den er als Autor als gegeben akzeptiert. Als Bürger jedoch fordert er eine klare Unterscheidung zwischen Wahrheit und Unwahrheit.
Den Kern seiner politischen Analyse bildet eine scharfe Kritik an der Außenpolitik der Vereinigten Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg, die er als systematisch, brutal und verlogen darstellt. Pinter argumentiert, dass politische Sprache, insbesondere von den USA und Großbritannien, gezielt eingesetzt wird, um die Öffentlichkeit in Unwissenheit zu halten und Macht zu sichern. Er bezeichnet dies als ein „weitverzweigtes Lügengespinst“. Konkrete Beispiele wie die Interventionen in Nicaragua und Chile sowie die Invasion des Irak im Jahr 2003 dienen ihm als Belege für einen von Lügen und Staatsterrorismus geprägten Machtanspruch.
Pinter schließt mit einem eindringlichen Appell an die intellektuelle Entschlossenheit der Bürger, die „wirkliche Wahrheit“ ihres Lebens und ihrer Gesellschaften zu ergründen. Nur durch diese unerschrockene Suche nach Wahrheit könne die fast verlorene Würde des Menschen wiederhergestellt werden.
--------------------------------------------------------------------------------
Detaillierte Analyse der Kernthemen
1. Die Dichotomie von Wahrheit in Kunst und Politik
Pinter strukturiert seine Vorlesung um den fundamentalen Gegensatz, wie Wahrheit im künstlerischen Schaffen und im bürgerlich-politischen Leben behandelt wird.
Wahrheit in der Kunst
Pinter bekräftigt seine 1958 formulierte Aussage: „Es gibt keine klaren Unterschiede zwischen dem, was wirklich und dem was unwirklich ist, genauso wenig wie zwischen dem, was wahr und dem was unwahr ist. Etwas ist nicht unbedingt entweder wahr oder unwahr; es kann beides sein, wahr und unwahr.“
- Unerreichbarkeit der Wahrheit: In der Dramatik ist die Wahrheit niemals singulär oder endgültig. Stattdessen existieren „viele Wahrheiten“, die sich widersprechen, ignorieren oder verspotten. Die Suche danach ist der Antrieb des künstlerischen Bemühens, auch wenn man die Wahrheit oft nur flüchtig oder unbewusst erhascht.
- Der intuitive kreative Prozess: Pinter beschreibt seinen Schreibprozess als nicht-analytisch. Seine Stücke entstehen oft aus einem einzelnen Wort, einer Zeile oder einem Bild.
- Beispiel Die Heimkehr: Entstand aus dem Satz „Was hast du mit der Schere gemacht?“
- Beispiel Alte Zeiten: Entstand aus dem Wort „Dunkel“.
- Autonomie der Figuren: Die geschaffenen Charaktere entwickeln ein Eigenleben und widersetzen sich dem Autor. Sie lassen sich nicht manipulieren oder in eine bestimmte Richtung zwingen. Der Autor führt mit ihnen ein „endloses Spiel: Katz und Maus, Blindekuh, Verstecken“.
- Vieldeutigkeit der Sprache: Die Sprache in der Kunst ist ein „Treibsand oder Trampolin, ein gefrorener Teich, auf dem man, der Autor, jederzeit einbrechen könnte.“
Wahrheit in der Politik
Im Gegensatz zur Kunst fordert Pinter als Bürger eine unbedingte Verpflichtung zur Wahrheit. Er stellt fest, dass die politische Sprache der Mächtigen systematisch darauf abzielt, diese Wahrheit zu verschleiern.
- Macht statt Wahrheit: „Die Mehrheit der Politiker, nach den uns vorliegenden Beweisen, an der Wahrheit kein Interesse hat sondern nur an der Macht und am Erhalt dieser Macht.“
- Das „Lügengespinst“: Um Macht zu erhalten, sei es unabdingbar, dass die Menschen unwissend bleiben. „Es umgibt uns deshalb ein weitverzweigtes Lügengespinst, von dem wir uns nähren.“
- Fallbeispiel Irak-Invasion (2003): Pinter listet die offiziellen Rechtfertigungen für die Invasion auf und deklariert sie als Unwahrheiten:
- Irak besitze Massenvernichtungswaffen, die in 45 Minuten einsatzbereit seien. (Falsch)
- Irak unterhalte Beziehungen zu al-Qaida und trage Mitverantwortung für den 11. September. (Falsch)
- Irak stelle eine Bedrohung für die Sicherheit der Welt dar. (Falsch)
2. Politisches Theater und künstlerische Objektivität
Pinter unterscheidet zwischen seinem allgemeinen dramatischen Werk und dezidiert politischem Theater. Letzteres erfordert eine andere Herangehensweise.
- Grundregeln des politischen Theaters:
- Moralpredigten sind zu vermeiden.
- Objektivität ist unabdingbar.
- Die Personen müssen „frei atmen können“, der Autor darf sie nicht seinen eigenen Vorurteilen unterwerfen.
- Eigene Werke als Beispiele:
- Die Geburtstagsfeier: Lässt in einem „dichten Wald der Möglichkeiten“ Spielraum für Alternativen, bevor ein Akt der Unterwerfung in den Fokus rückt.
- Berg-Sprache: Bietet keinen solchen Spielraum. Das Stück ist „brutal, kurz und hässlich“ und illustriert die Banalität der Folter und die Notwendigkeit der Folterer, sich zu amüsieren (Verweis auf Abu Ghraib).
- Asche zu Asche: Wird als ein Stück beschrieben, das „unter Wasser zu spielen scheint“, in dem eine ertrinkende Frau vergeblich nach anderen sucht und in einer Landschaft des Verderbens verloren ist.
3. Anklage der US-Außenpolitik seit 1945
Ein Großteil der Vorlesung ist eine vehemente und detaillierte Kritik an den verdeckten und offenen Interventionen der USA weltweit. Pinter behauptet, dass die Verbrechen der USA im Gegensatz zu denen der Sowjetunion „nur oberflächlich protokolliert, geschweige denn dokumentiert, geschweige denn eingestanden, geschweige denn überhaupt als Verbrechen wahrgenommen worden sind.“
Die Methode des „Low Intensity Conflict“
Die bevorzugte Methode der USA sei nicht die direkte Invasion gewesen, sondern der sogenannte „Low Intensity Conflict“. Pinter definiert dies als einen Prozess, bei dem:
- Tausende von Menschen langsam sterben, anstatt durch eine Bombe auf einen Schlag.
- Das „Herz des Landes infiziert“ wird, um eine „bösartige Wucherung“ zu erzeugen.
- Nachdem die Bevölkerung unterjocht oder getötet ist, die eigenen Verbündeten (Militär, Kapitalgesellschaften) die Macht übernehmen.
- Anschließend wird vor der Kamera verkündet, die „Demokratie habe sich behauptet.“
Fallstudie: Nicaragua
Pinter bezeichnet die Ereignisse in Nicaragua als „hochsignifikanten Fall“ und „schlagendes Beispiel“ für die Weltsicht der USA.
- Erfolge der Sandinisten (nach 1979):
- Abschaffung der Todesstrafe.
- Landreform für 100.000 Familien.
- Bau von 2.000 Schulen.
- Alphabetisierungskampagne, die die Analphabetenrate auf unter ein Siebtel senkte.
- Einführung von kostenloser Bildung und Gesundheitsfürsorge.
- Senkung der Kindersterblichkeit um ein Drittel.
- Reaktion der USA: Die USA denunzierten diese Erfolge als „marxistisch-leninistische Unterwanderung“ und als „gefährliches Beispiel“, das andere Länder zur Nachahmung inspirieren könnte. Präsident Reagan bezeichnete Nicaragua als „totalitären Kerker“ und die von den USA unterstützten Contra-Rebellen als moralisches Äquivalent zu den Gründervätern der USA.
- Die Anekdote mit Raymond Seitz: Pinter berichtet von einem Treffen in der US-Botschaft in London, bei dem ein Priester die Gräueltaten der Contras schilderte (Zerstörung von Schulen und Kliniken, Vergewaltigungen, Morde). Der US-Diplomat Raymond Seitz antwortete darauf mit dem Satz: „Father, ich möchte Ihnen etwas sagen. Im Krieg leiden immer Unschuldige.“
- Ergebnis: Durch „gnadenlose ökonomische Schikanen und 30.000 Tote“ wurde die sandinistische Regierung letztlich gestürzt.
Globale Dimension der Interventionen
Pinter betont, dass diese Politik global war. „Nach dem Ende des 2. Weltkriegs unterstützten die Vereinigten Staaten jede rechtsgerichtete Militärdiktatur auf der Welt, und in vielen Fällen brachten sie sie erst hervor.“ Er listet folgende Länder auf: Indonesien, Griechenland, Uruguay, Brasilien, Paraguay, Haiti, die Türkei, die Philippinen, Guatemala, El Salvador und Chile. Er fasst die öffentliche Wahrnehmung dieser Verbrechen mit dem Satz zusammen: „Nichts ist jemals passiert. Sogar als es passierte, passierte es nicht.“
4. Die gegenwärtige Weltordnung
Pinter argumentiert, dass die USA ihre Strategie des verdeckten Konflikts aufgegeben haben und nun offen agieren.
- „Full Spectrum Dominance“: Die offiziell verkündete Politik sei die „full spectrum dominance“, was die Kontrolle über Land, Meer, Luft, Weltraum und alle Ressourcen bedeute.
- Militärische Präsenz: Zur Untermauerung nennt er Zahlen: 702 US-Militäranlagen in 132 Ländern und 8.000 aktive Atomsprengköpfe (2.000 davon binnen 15 Minuten feuerbereit).
- Guantanamo Bay: Er prangert das Lager als „absolut rechtswidrige Situation“ an, in der Hunderte ohne Anklage inhaftiert sind. Er bezeichnet Zwangsernährung von Hungerstreikenden als Folter und kritisiert das Schweigen des britischen Premierministers Tony Blair, weil die USA Kritik als „feindseligen Akt“ definieren.
- Die Irak-Invasion als „Banditenakt“: Er bezeichnet die Invasion als „Akt von unverhohlenem Staatsterrorismus“, der auf Lügen basierte und zum Tod von „mindestens 100.000 Irakern“ führte, bevor der Aufstand begann. Er zitiert den US-General Tommy Franks: „Leichen zählen wir nicht.“ Pinter fordert, Bush und Blair vor den Internationalen Strafgerichtshof zu stellen.
5. Der Appell an den Bürger und die Würde des Menschen
Pinter schließt seine Vorlesung mit einer Reflexion über die Rolle des Schriftstellers und einer Aufforderung an alle Bürger.
- Die manipulative Kraft der Sprache: Er analysiert den Ausdruck „das amerikanische Volk“ als rhetorischen Trick, ein „luxuriöses Kissen zur Beruhigung“, das kritisches Denken erstickt. Er illustriert dies mit einer satirischen Rede, die er für Präsident Bush verfasst hat.
- Die Pflicht zur Wahrheitssuche: Pinter stellt fest, dass ein Schriftsteller manchmal „den Spiegel zerschlagen“ muss, weil von der anderen Seite die Wahrheit blickt. Er überträgt diese Aufgabe auf alle: „Die unerschrockene, unbeirrbare, heftige intellektuelle Entschlossenheit, als Bürger die wirkliche Wahrheit unseres Lebens und unserer Gesellschaften zu bestimmen, eine ausschlaggebende Verpflichtung darstellt, die uns allen zufällt.“
- Wiederherstellung der Menschenwürde: Er schließt mit der Warnung: „Wenn sich diese Entschlossenheit nicht in unserer politischen Vision verkörpert, bleiben wir bar jeder Hoffnung, das wiederherzustellen, was wir schon fast verloren haben – die Würde des Menschen.“