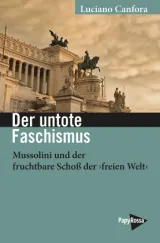Der untote Faschismus
Mussolini und der fruchtbare Schoß der ›freien Welt‹
Ein »Neonazi im Herzen« sei Giorgia Meloni, so Luciano Canfora, die Anzeige eingepreist. Als der Althistoriker 2024 das Strafgericht zu Bari betritt, gleicht er laut FAZ einem »im Herzen blutjungen Rebellen«: Er beweise seinen Vorwurf. »Der untote Faschismus« liest sich als Verteidigungsschrift, die die Geschichte des Faschismus aufblättert. Dem Hohelied eines Churchill auf Mussolini folgt die Einbettung von Francos Spanien oder Salazars Portugal in die »freie Welt« und die Inthronisierung von Statthaltern wie Pinochet, weißer Suprematismus inklusive. Von mitregierenden Neofaschisten in Westeuropa gelangt der Band zur Rückkehr von Nazisymbolik in Osteuropa – Kroatien, Baltikum, Ukraine.
Ließ der NATO-Krieg gegen Serbien den Geist aus der Flasche? Als Vorspiel zur »großen Versuchung«, Russland im Visier? Canfora fragt nach Kontinuitäten, die in Italien wie in Westdeutschland nach 1945 eine Rolle spielten, und nach treibenden Kräften eines Revanchismus, dessen sozialer Restgehalt noch an der Europäischen Zentralbank zu zerschellen droht. Und doch: Die mutmaßliche »Neonazista nell’animo« zog ihre Klage gegen den »linksradikalen Rebellen« (FAZ) zurück, auch dank Druck aus Gewerkschaften und antifaschistischen Organisationen.
Der Autor
Briefing-Dokument: Der Untote Faschismus
Zusammenfassung
Dieses Dokument fasst die zentralen Thesen und Beobachtungen aus Luciano Canforas Einleitung zu „Der untote Faschismus“ zusammen. Die Analyse identifiziert einen besorgniserregenden Aufstieg rechtsextremer Rhetorik und Akteure in der europäischen Politik, insbesondere in Finnland, Deutschland, der Ukraine und Polen. Gleichzeitig wird eine scharfe Kritik an der Verwässerung des Faschismusbegriffs geübt, der durch überdehnte und ahistorische Anwendungen, wie im Werk von Waller R. Newell, seiner analytischen Schärfe beraubt wird. Canfora plädiert stattdessen für eine präzise historische Betrachtung des Faschismus als ein spezifisches Phänomen, das auch nach seiner militärischen Niederlage politisch weiterwirkt.
Ein zentraler Fokus liegt auf der Nachkriegsgeschichte Italiens, in der neofaschistische Kräfte, gestützt durch den „schwarzen Terrorismus“ und verdeckte Operationen (z.B. der Loge P2 im Fall Aldo Moro), maßgeblich zur Zerschlagung der Republik der Parteien beitrugen. Abschließend wird eine entscheidende Unterscheidung zwischen dem historischen Faschismus, der intellektuelle Eliten wie Giovanni Gentile und Guglielmo Marconi für sich gewinnen konnte, und dem heutigen „Postfaschismus“ getroffen. Dieser sei anthropologisch durch „Personen ohne Format“ gekennzeichnet. An die Stelle des klassischen Faschismus trete eine neue, subtilere Form: ein von Giulio Tremonti als „weißer Faschismus“ oder „Finanzfaschismus“ bezeichnetes System, das von den fernen Kommandozentralen europäischer Institutionen aus gesteuert wird.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Zeitgenössische Manifestationen rechtsextremer Ideologien in Europa
Die Quelle dokumentiert eine Reihe von Vorfällen und Tendenzen, die auf eine Wiederbelebung rechtsextremer und faschistoider Haltungen in mehreren europäischen Ländern hindeuten.
| Land | Akteur/Partei | Ereignis/Beschreibung | Datum |
| Finnland | Wille Rydman (Wirtschaftsminister, "Die Finnen") | Äußerte sich antisemitisch: „So einen Judenkram mögen wir Nazis ja nicht“. Bezeichnet Bürger des Mittleren Ostens als „Affen“. | 31. Juli 2023 |
| Regierung Finnlands | Kurz nach dem NATO-Beitritt wurde eine Regierung gebildet, die vollständig aus Rechten besteht und von der extremistischen Partei „Die Finnen“ getragen wird. | 20. Juni 2023 | |
| Deutschland | Alternative für Deutschland (AfD) | Wurde vom „Corriere della Sera“ als „ausländerfeindlich, antisemitisch und erfolgreich“ beschrieben. | 7. Juli 2023 |
| Italien | "Miss Hitler" | Berichterstattung über eine mögliche Anklage wegen „antisemitischer Tiraden“ in sozialen Medien. | 29. Juli 2023 |
| Roberto Calderoli (Lega-Minister) | Bezeichnete die Abgeordnete Cécile Kyenge als „Orang-Utan“, was als Zeichen von „armseligem Wortschatz“ und „zivilisatorischem Bankrott“ gewertet wird. | (Vor Jahren) | |
| Ukraine | Asow-Bataillon | Gründer des Bataillons ließ Spuren seiner „Neonazismus“-Vergangenheit aus dem Internet tilgen. Das Bataillon erhielt symbolische Unterstützung von italienischen Politikern. | 25. Mai 2022 |
| Rechtsextreme Aktivisten | Zündeten Bomben im Gericht von Kiew, um einen Prozess zu stören. Der Vorfall wird als Wiedererstarken extremistischer Gruppen im Zuge des Krieges interpretiert. | 5. Juli 2023 | |
| Polen | Grzegorz Braun (Abgeordneter der Rechten) | Löschte mit einem Feuerlöscher die jüdische Menora im Warschauer Parlament und bezeichnete sie als „satanisches“ Symbol. | 12. Dezember 2023 |
2. Die Problematik der Definition von Faschismus
Ein zentrales Argument des Textes ist die Kritik an einer inflationären und unpräzisen Verwendung des Faschismusbegriffs, die ihn bis zur Bedeutungslosigkeit ausdehnt.
2.1. Kritik an der Überdehnung des Begriffs
Der Autor stellt fest, dass die Kategorie „Faschismus“ oft so weit ausgedehnt wird, bis sie mit der ebenso allumfassenden Kategorie „Totalitarismus“ verschmilzt und damit „gar nichts mehr zu bedeuten“ hat.
2.2. Fallbeispiel: Waller R. Newell
Als symptomatischstes Beispiel für diese „unbeschwerte Oberflächlichkeit“ wird das Buch Tyrants (2016) von Waller R. Newell angeführt.
- Newells Faschismus-Definition: Er liefert ein Verzeichnis von Faschisten, das folgende Behauptung enthält: „Alle Nazis und Bolschewiken waren Faschisten (sic)“.
- Aufgelistete „Faschisten“: Salazar, Somoza, alle arabischen Nationalisten, Mubarak, Assad, die Sowjetunion.
- Aufgelistete „Tyrannen“: Hieron I. von Syrakus, Francisco Franco, Alexander der Große, Napoleon, Ludwig XIV., Kemal Atatürk, Cäsar, alle Tudors.
Der Autor lehnt diesen Ansatz als ein Produkt der „herrschenden angelsächsischen Kultur“ ab, das sich „von selbst erledigt“. Er dient lediglich als Kontrastfolie, um einen analytisch fundierteren Weg aufzuzeigen.
2.3. Plädoyer für eine spezifische historische Analyse
Im Gegensatz zur inflationären Begriffsverwendung wird dafür plädiert, den Faschismus als ein spezifisches historisches Phänomen zu untersuchen, das:
- spezifische Wurzeln und eine charakteristische Geschichte hatte.
- eine große internationale Ausstrahlung und wachsende Zustimmung erfuhr.
- andere Bewegungen in seinen Bann zog, die wiederum eigene nationale Wurzeln hatten.
- auch nach seiner Niederlage die politischen Debatten lebhaft durchdrungen hat und „hinter den Kulissen fortgewirkt“ ist.
3. Die Nachwirkungen des Faschismus in der italienischen Politik
Der Text skizziert die entscheidende Rolle neofaschistischer Kräfte beim Ende der italienischen Nachkriegsrepublik.
- Zusammenbruch der Republik der Parteien: Die aus der Resistenza hervorgegangene Zusammenarbeit der Parteien endete mit der Ermordung von Aldo Moro, die eine erneute Koalition verhinderte. Es folgten lange Jahre der Agonie und die Selbstauflösung der Christdemokraten (DC) und Kommunisten (PCI).
- Die Rolle des Terrorismus: Als „bewaffneter Arm“ der Kräfte, die diese Zusammenarbeit verhinderten, wird der Terrorismus identifiziert.
- „Schwarzer“ Terrorismus (rechts): Verübte wahllose Anschläge wie auf der Piazza Fontana (1969), in Brescia und auf den Italicus-Zug (1974) sowie am Bahnhof von Bologna (1980).
- „Roter“ Terrorismus (angeblich links): Richtete sich gegen Einzelpersonen, wie im Fall Moro.
- Verstrickungen im Fall Moro: Der Autor stellt die These auf, dass die angeblich „Roten“ Brigaden bei der Liquidierung Moros als „Handlanger“ fungierten, während die Loge P2 in Kooperation mit US-amerikanischen und abtrünnigen italienischen Geheimdiensten die Befreiung der Geisel aktiv scheitern ließ.
- Haltung der Parteien: Während der PCI die „Roten Brigaden“ verurteilte und bekämpfte, brach der neofaschistische Movimento Sociale Italiano (MSI) „nie explizit mit den ›Schwarzen‹“. Dies unterstreicht die „offensichtliche“ Rolle neofaschistischer Kräfte bei der Zerschlagung der Republik.
4. Der Charakter des zeitgenössischen „Postfaschismus“
Der Autor argumentiert, dass der heutige Postfaschismus sich fundamental vom historischen Faschismus unterscheidet, und stützt sich dabei auf ein „anthropologisches Argument“.
4.1. Mangel an intellektuellem Format
Der entscheidende Unterschied liegt in der personellen Qualität. Die heutigen neòteroi („die Neueren“) des Postfaschismus werden als „Personen ohne Format“ beschrieben, die ihresgleichen rekrutieren. Ihre Erscheinung wird als „Karikatur“ bezeichnet, die „nicht einmal zum Lachen verführt“.
4.2. Kontrast zum historischen Faschismus
Der historische Faschismus hingegen war in der Lage, das „Beste vom Besten der intellektuellen und akademischen Schichten Italiens“ zu rekrutieren. Als Beispiele werden genannt:
- Giovanni Gentile (Philosoph)
- Alfredo Rocco (Jurist und Staatstheoretiker)
- Guglielmo Marconi (Physik-Nobelpreisträger)
- Giuseppe Bottai (Politiker)
- Alessandro Pavolini (Politiker und Journalist)
- Piero Calamandrei (Jurist, der an der Zivilprozessordnung mitwirkte)
Aus dieser Perspektive, so die Schlussfolgerung, ist der Faschismus „wirklich am Ende“.
4.3. Der „weiße Faschismus“ oder „Finanzfaschismus“
An seine Stelle tritt eine neue, subtilere Herrschaftsform, die von Giulio Tremonti als „weißer Faschismus“ oder „Finanzfaschismus“ bezeichnet wird.
- Akteure: Die „Fähigen“ von heute ziehen es vor, die „Strippen aus der Ferne zu ziehen“.
- Machtzentren: Die Steuerung erfolgt von den „Kommandobrücken der unerreichbaren ›europäischen Institutionen‹“ aus.
- Charakter: Diese Herrschaften werden als „weichgespült“ beschrieben.
Erstellt: 23.03.2025 - 18:30 | Geändert: 13.11.2025 - 22:43