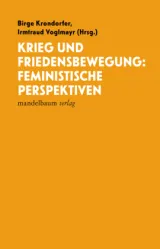Krieg und Friedensbewegung: Feministische Perspektiven
Die aktuellen kriegerischen Katastrophen lassen nicht nur westeuropäische Friedensillusionen, sondern auch die bequeme Einbettung unserer Gesellschaften in ein Friedenskontinuum einbrechen. Wir müssen uns also verstärkt mit Krieg, Gewalt, Militarisierung, Geschlechterverhältnissen und Frauen-Friedensbewegungen auseinandersetzen. Geschichts-, kultur-, sozialwissenschaftliche und philosophische Autorinnen und Aktivistinnen bieten in diesem Band einen interdisziplinären Blick auf die fatalen Auswirkungen von Kriegen auf die Geschlechterbeziehungen und das Alltagsleben.
Das Buch versammelt sowohl Texte, die den Schwerpunkt auf historische Frauenfriedensbewegungen im 19. und 20. Jahrhundert legen, als auch internationale, durchaus widersprüchliche Analysen gegenwärtiger Kriegsgeschehnisse. Grundlegende Fragen zu patriarchaler Gewalt in all ihren Erscheinungsformen, legitimiert durch mediale Darstellungen, runden den Sammelband, dem ein Symposium zum gleichen Thema vorausging, ab.
Inhaltsverzeichnis und Leseprobe des Verlags
Warum Antimilitarismus und Feminismus zusammen gehören: Die Bundeswehr soll weiblicher gemacht werden und die NATO ist jetzt woke. Höchste Zeit, über feministische Perspektiven in der Friedensbewegung nachzudenken. Von Mara Luise Günzel critica-zeitung.de 25.11.2024
Die "Buchpräsentation und Podiumsdiskussion" https://www.youtube.com/watch?v=C1dXwn7e6jw widmet sich dem Band "Krieg & Friedensbewegung". Der Moderator, Josef Müllbauer, betonte die große Bedeutung und den hohen Wert dieses Buches. Es wird als ein Werk beschrieben, das historische Auseinandersetzungen, scharfe Analysen und die aktuellen Kriegsrealitäten2].
Entstehung und Kontext des Buches
Das Buch entstand im Kontext der Frauenhetz, einer feministischen Erwachsenenbildungsstätte im dritten Bezirk in Wien, die seit über 30 Jahren selbstorganisiert existiert. Frauenhetz versteht sich als Schnittstelle zwischen Akademie/Universität und Aktivismus ("die Frauen auf der Straße").
Die Idee zum Buch geht auf ein gut besuchtes Tagessymposium im April 2023 zum Thema "Krieg, Friedensbewegung, Frauen und Geschlechterverhältnisse" zurück, das in Kooperation zwischen der Frauenhetz (vertreten durch Irmi Traut Vogelmeier und Birge Grundorf) und Rosa Logar von WILPF organisiert wurde. Aufgrund der regen und teils "dividierenden Debatten" fragte der Mandelbaumverlag an, ob ein Buch daraus entstehen könnte. Die Herausgabe und Bearbeitung durch Irmi Traut Vogelmeier und Birge Grundorf dauerte eineinhalb bis zwei Jahre und war mit viel Arbeit verbunden. Das Buch erschien im Jahr 2025, wobei die Aktualität des Themas aufgrund der fortlaufenden Kriege (Russland-Ukraine, Israel-Gaza) leider erhalten blieb.
Inhaltliche und strukturelle Aspekte
Der Sammelband umfasst Beiträge von 19 Autorinnen. Diese Autorinnen stammen aus verschiedenen Disziplinen wie Philosophie, Musikwissenschaft und Ökonomie. Viele haben einen aktivistischen Hintergrund und vertreten teils unterschiedliche Positionen zu Krieg und Frieden, bedingt durch ihre jeweilige Betroffenheit und Involviertheit. Die Beiträge nutzen diverse Stile, darunter wissenschaftliche, populärwissenschaftliche, Essays und einen künstlerischen Beitrag. Die Autorinnen arbeiten zudem mit unterschiedlichen feministischen Ansätzen, vom Differenz- über den Gleichstellungs- bis zum Intersektionalen Feminismus.
Das Buch ist in drei große Teile gegliedert:
- Historische Bezüge: Erinnerung an die Entstehung der Frauenfriedensbewegung vor 100 Jahren, mit einem prominenten Fokus auf WILPF (Women's International League for Peace and Freedom) sowie die kraftvolle Frauenfriedensbewegung der 1980er Jahre in West- und Ostdeutschland.
- Aktuelle Kriege: Fokussiert auf die Konflikte, die medial am präsentesten sind: Russland-Ukraine und Israel-Gaza. Es werden aber auch andere Konflikte, etwa in Äthiopien/Tigray, angesprochen. Hier schreiben internationale Autorinnen, unter anderem aus Belarus, der Ukraine und Russland.
- Grundlegendes (Anhaltende Bezüge): Umfassende Analysen und Reflexionen zu wichtigen Themen wie Krieg, Militarisierung, Ökonomie, Ökologie, Medien und Gewalt, stets in Relation zu Geschlecht.
Zentrale Beiträge und Analysen
Im Rahmen der Buchpräsentation wurden exemplarisch mehrere Beiträge vorgestellt:
Historischer Teil:
- Vorwort (Malin Ingeborg Strotz): Stellt weniger ein klassisches Vorwort dar, sondern einen Essay über die Macht des Hausvaters, die historisch auf das römische Recht zurückgeht. Sie argumentiert, dass die Unterdrückten (meist Frauen und subalterne Männer) durch ihr Überlebenswissen über die Herrschaft eine eher Vorstellung von Frieden entwickeln können als die Machthaber.
- Berta von Suttner (Adelheit Bichler): Zeichnet die Lebensstationen der Friedensnobelpreisträgerin nach und beleuchtet ihre vielfältigen Netzwerke und die Gründung von Friedensgesellschaften. Ein Kerngedanke Suttners wird zitiert: Echte Friedenskämpfer müssen Optimisten sein.
- Frauenfriedensbewegung im Kalten Krieg (Giesler Notz): Beschreibt die westdeutsche Bewegung, die sich gegen die Wiederaufrüstung wandte. Die Frauen wurden im Kalten Krieg als kommunistische Tarnorganisation verleumdet, was bis zu Verboten und Hausdurchsuchungen führte. Beschrieben werden auch die großen Frauenfriedensmärsche, wie der von Berlin nach Wien 1982.
Aktuelle Kriege (Osteuropa/Naher Osten):
- Intergenerationenkonflikt in WILPF (Heidi Meinzolt): Beleuchtet die Auseinandersetzungen zwischen den Generationen innerhalb der WILPF, insbesondere über die Frage der Gewaltfreiheit im Angesicht des Rechts auf Verteidigung (Ukraine-Krieg).
- "Fürsorgliche Solidarität" (Olga Sparager): Die belarussische Philosophin entwickelt den Begriff der fürsorglichen Solidarität als Gegenbild zum Konkurrenz- und Machtdenken. Sie beschreibt, wie belarussische Frauen trotz Verfolgung ukrainische Frauen unterstützen.
- Feministischer Antikriegswiderstand in Russland (Maria Menschikowa): Berichtet über die flüchtigen, dezentralen künstlerischen Aktionen dieser Aktivistinnengruppe, die schnell als unerwünschte Organisation eingestuft wurde. Ein Beispiel ist die Verwendung lokaler Bezirksblätter, um darin anstelle von Bauernregeln und Mondkalendern feministische Antikriegsinhalte zu verbreiten.
- Musik als Friedensaktivismus (Isabelle Frei): Die Künstlerin und Aktivistin der jüdisch-arabischen Initiative Standing Together nutzt Musik bei Mahnwachen, um Stimmungen, Zugehörigkeit und politische Botschaften affektiv zu vermitteln.
- Schweigen zu sexualisierter antisemitischer Gewalt (Livia Ergeschi): Die jüdische Autorin beklagt das Schweigen internationaler Frauenorganisationen zur sexualisierten Gewalt gegen Jüdinnen in Israel und der Diaspora.
Grundlegendes (Theorie und Analyse):
- Feministische Friedens- und Konfliktforschung (Patrizia Konrad): Ein Überblick über das Feld. Sie stellt fest, dass die feministische Forschung Sicherheit, Konfliktursachen und klassische Kriegskonzepte neu denkt. Kritisiert wird die Zersplitterung der unterschiedlichen Ansätze (postkolonial, liberal) und der Mangel an Institutionalisierung im deutschsprachigen Raum.
- Krieg und Ökologie (Verena Gater): Behandelt die "leere Stelle" der militärischen Altlasten des Kalten Krieges und führt den Begriff der "langsamen Gewalt" ein (schleichende Zerstörung, Verlust von Ressourcen). Sie betont, dass ökologische Nachhaltigkeit ohne die Einhegung von Altlasten und ohne Frieden unmöglich ist.
- Militarisierung in und durch die Medien (Irmi Traut Vogelmeier): Analysiert Medien als Konstrukteure von Wirklichkeiten und als Werbeträger (z. B. für die Kampagne "Frauen ins Heer"). Sie hinterfragt die Normalisierung des Militärdienstes als "Job wie jeder andere" und fordert eine größere Debatte darüber, dass es sich um eine Institution handelt, in der das Tötungshandwerk erlernt wird.
- Neoliberalismus, Männlichkeit und Militarismus (Gabriele Michaelit): Die Autorin argumentiert, dass der Neoliberalismus die psychopolitischen Grundlagen für Militarismus geschaffen hat. Durch Unsicherheit, Konkurrenzkampf und die Idealisierung von Aggressivität als Durchsetzungsfähigkeit (diskurshafte Ebene) werden die emotionalen Voraussetzungen (Angst, Hilflosigkeit) für die Herausbildung eines autoritären Charakters (nach Erich Fromm) geschaffen. Militarisierung bietet eine scheinbare Befriedigung dieser Bedürfnisse durch die Feind-Freund-Dichotomie und das Gefühl der Stärke.
- Zur Theoretisierung sexueller Gewalt (Julia Sachseder): Die Autorin plädiert dafür, sexuelle Gewalt nicht als Ausrutscher oder instrumentelle Waffe zu sehen, sondern als integralen Bestandteil von politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen. Basierend auf ihrer Forschung in Kolumbien verbindet sie sexuelle Gewalt direkt mit Extraktivismus (Ressourcenausbeutung). Sie nutzt die dekoloniale Perspektive der "Kolonialität der Macht", um zu erklären, wie bestimmte Körper (wie indigene, schwarze, koloniale, weibliche Körper) historisch so positioniert wurden, dass sie leichter sexualisierter Gewalt ausgesetzt werden können, ohne einen internationalen Aufschrei zu provozieren. Sexuelle Gewalt sei eine Technologie der Herrschaft zur Kontrolle von Körpern und Territorien.
Abschließende Reflexionen
Rosa Logar hob hervor, dass die feministische Analyse ("Feminist Intelligence", FI) angesichts der beängstigenden Militarisierung unerlässlich sei. Sie betont die historische Position der WILPF, wonach Krieg eine politische Entscheidung ist und keine Unausweichlichkeit. Sie verwies auf ökonomische Machtinteressen, wie die Verbindung von Kriegsindustrie und Konflikten (z.B. Israel als Testlabor für neue Tötungs- und Überwachungstechnologien, die global verkauft werden). Logar mahnte zudem das repressive Vorgehen der Polizei gegen Friedensgruppen am österreichischen Staatsfeiertag (26. Oktober) an. Abschließend wurde die Kampagne "Move the Money" erwähnt, die sich gegen die Verlagerung immenser Ressourcen in militärische Strategien ausspricht, während bei Alltagsdingen wie der Pflege gespart wird.
Das Buch und die Präsentation bieten somit eine vielschichtige feministische Kritik an Krieg, patriarchalen Strukturen, Neoliberalismus und militarisierten Gesellschaften. Es geht darum, die unsichtbaren oder verdrängten Verbindungen zwischen Gewalt auf mikro- und makroökonomischer Ebene sichtbar zu machen, ähnlich wie ein umfassendes GPS-System die komplexen Routen und Hindernisse auf dem Weg zum Frieden aufzeigt, anstatt nur die offensichtlichen Schlachtfelder.
Erstellt: 19.08.2025 - 12:08 | Geändert: 18.11.2025 - 07:58