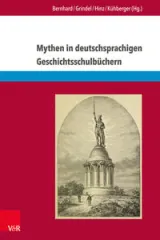Mythen in deutschsprachigen Geschichtsschulbüchern
Von Marathon bis zum Élysée-Vertrag
Dieser Band befasst sich mit Formen und Funktionen von europäischen wie nationalen Mythen in den deutschsprachigen Schulbüchern Deutschlands, Österreichs und der Schweiz von der Schlacht bei Salamis über den Behaim-Globus bis zum Elysée-Vertrag. Dabei wird auch nach unterschiedlichen Zugängen zum Mythos-Begriff in den Kulturwissenschaften und in der Geschichtsdidaktik sowie den sich hieraus ergebenden Impulsen gefragt. Die Schwierigkeiten der De-Konstruktion populärer Geschichtsmythen werden ebenso diskutiert wie die Tradierungsbedürfnisse und Deutungsmuster, die diese Mythen bedienen. Schließlich loten die AutorInnen aus, wie sich über die Beschäftigung mit Mythen neue Perspektiven für die Entwicklung eines kritischen Geschichtsbewusstseins im Unterricht gewinnen lassen.
Beiträgen von Johannes Meyer-Hamme, Susanne Grindel, Hansjörg Biener, Felix Hinz, Roland Bernhard, Christoph Kühberger, Björn Onken, Julia Thyroff, Tobias Kuster, Markus Furrer und Christine Pflüger.
Rezensionen
Geschichtsschulbücher sind "soziale und politische Autobiographie[n]", so der Geschichtsdidaktiker Wolfgang Jacobmeyer in seiner monumentalen Studie über das deutsche Schulgeschichtsbuch. Sie vermitteln jeweils das Geschichtsverständnis, das eine Gesellschaft aus ihrer Gegenwartsperspektive heraus als "richtig" erachtet. [1] Vor diesem Hintergrund erscheint es als ein vielversprechendes Unterfangen, Mythen in Geschichtslehrwerken zum Gegenstand der Forschung zu machen. Denn wo Sinn gestiftet und Orientierungsangebote gemacht werden, sind historische Mythen nicht weit. Von Sebastian Wemhoff Sehepunkte 15.05.2019
Historische Mythen gehören zum Grundbestand geschichtskultureller und politischer Diskurse. Auch im 21. Jahrhundert haben sie nicht an Bedeutung verloren. Vielmehr scheinen sie aktuell intensiv für politische Zwecke genutzt zu werden.1 Im vorliegenden Band wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Geschichtsschulbücher bei der Perpetuierung, aber auch bei der Analyse historischer Mythen spielen. Der Band versammelt die Beiträge einer Tagung, die im Dezember 2014 am Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig stattfand. Von Manuel Köster H/Soz/Kult 06.02.2019
Herausgeber / Autoren
Dr. Roland Bernhard ist Geschichtsdidaktiker und Bildungsforscher an der Universität Salzburg. Er arbeitet derzeit an einem empirischen Post-Doc-Forschungsprojekt zu Geschichtsunterricht in Österreich.
Dr. Susanne Grindel war bis September 2015 stellvertretende Leiterin des Arbeitsbereichs Europa und Lehrbeauftragte am Historischen Seminar der TU Braunschweig.
Dr. Felix Hinz ist Professor für Geschichte und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Prof. Dr. Christoph Kühberger ist Politik- und Geschichtsdidaktiker an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig und Leiter des dort angesiedelten Bundeszentrums für Gesellschaftliches Lernen.
Mythen in deutschsprachigen Geschichtsschulbüchern: Eine thematische Synthese
Zusammenfassung
Dieses Briefing-Dokument fasst die zentralen Erkenntnisse einer tiefgehenden Analyse historischer Mythen in deutschsprachigen Schulbüchern zusammen. Historische Mythen sind keine schlichten Falschaussagen, sondern komplexe, sinnstiftende Erzählungen, die in Gesellschaften Identität stiften, Orientierung bieten und politische Ordnungen legitimieren. Sie appellieren stärker an Emotionen als an rationale Beweise und reduzieren komplexe historische Sachverhalte auf eingängige Narrative. Geschichtsschulbücher fungieren seit dem 19. Jahrhundert als zentrale Vermittlungsinstanzen und oft auch als „Mythengeneratoren“, insbesondere zur Stützung nationaler Meistererzählungen. Während moderne Lehrwerke bisweilen den Anspruch haben, Mythen zu dekonstruieren, perpetuieren sie diese häufig – bewusst oder unbewusst – durch unkritische Darstellungen, die Auswahl von Bildmaterial und suggestive Aufgabenstellungen.
Die theoretische Auseinandersetzung, insbesondere nach Jörn Rüsen, zeigt, dass ein Mythos durch mangelnde Plausibilität (Triftigkeit) in mindestens einem von drei Bereichen gekennzeichnet ist: dem empirischen (Quellenbasis), dem normativen (Wertehorizont) oder dem narrativen (Kohärenz der Erzählung). Mythen entstehen oft, wenn die ästhetische (Faszinationskraft) oder politische (Machtlegitimation) Dimension der Geschichte die kognitive (Wahrheitsanspruch) dominiert.
Die Analyse ausgewählter Fallstudien offenbart die Persistenz und Wandlungsfähigkeit von Mythen in Schulbüchern:
- Europäische „Rettungsmythen“ (Marathon, Tours/Poitiers) haben in modernen Lehrplänen an Bedeutung verloren, leben aber latent in Bildern und unkritischen Darstellungen fort.
- Der Hermannsmythos, ein Kernnarrativ des deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts, wurde seit den 1960er Jahren weitgehend dekonstruiert.
- Der Mythos um Martin Behaim als Erfinder des Globus in einer an eine Erdscheibe glaubenden mittelalterlichen Welt hält sich hartnäckig als Teil einer fortschrittsgläubigen Meistererzählung der Neuzeit.
- Der Kolonialmythos von der zivilisatorischen Mission Europas in einem geschichtslosen Afrika wird zwar kritisch hinterfragt, seine dichotomen Denkfiguren wirken aber nach.
- Die Darstellung des Ersten Kreuzzugs ist oft von Vereinfachungen und der unkritischen Übernahme übertriebener Quellenangaben (z. B. Opferzahlen in Jerusalem) geprägt, was ein klares Täter-Opfer-Schema erzeugt.
- Der Hitler-Mythos, der den Nationalsozialismus extrem auf die Person Hitlers zuspitzt, wird in österreichischen Schulbüchern vor allem in Kapiteln zur „Machtergreifung“ reproduziert, während die Darstellung des Holocausts stärker entpersonalisiert ist.
- Der Mythos der Reichsautobahn als Hitlers geniale Idee zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit wird zwar auf ökonomischer Ebene oft widerlegt, aber durch den unkritischen Einsatz ikonischer Propagandabilder visuell aufrechterhalten.
- Die Mythen der Schweiz im Kalten Krieg (Neutralität, Wehrhaftigkeit, Antikommunismus) zeigen, wie bestehende nationale Narrative zur inneren Stabilisierung in einer neuen Bedrohungslage fortgeschrieben wurden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Umgang mit Mythen in Schulbüchern ein Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Dekonstruktion und der Reproduktion verfestigter Geschichtsbilder darstellt. Eine wirksame historische Bildung erfordert daher die gezielte Förderung einer „geschichtskulturellen Kompetenz“, die Lernende befähigt, Mythen als solche zu erkennen, ihre Funktion zu analysieren und ihre Plausibilität kritisch zu hinterfragen.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Definition und Funktion historischer Mythen
Was ist ein historischer Mythos?
Ein historischer Mythos ist ein „narratives Symbolgebilde“, das von größeren sozialen Gruppen als identitätsbildende und orientierungsstiftende Erzählung rezipiert wird. Es handelt sich um ein kollektiv verankertes, komplexitätsreduziertes Narrativ, das für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Gemeinschaft entscheidende Relevanz beansprucht.
Wesentliche Merkmale sind:
- Appell an Emotionen: Mythen überzeugen nicht durch rationale oder empirische Beweise, sondern appellieren an Emotionen und erwecken den Glauben an die Wahrheit des Erzählten.
- Sinnstiftung und Orientierung: Sie geben Auskunft darüber, wie Gesellschaften wissenschaftliche Erkenntnisse verdichten und popularisieren, um Orientierung in einer komplexen Welt zu schaffen.
- Abgrenzung von Falschaussagen: Ein Mythos ist nicht zwangsläufig eine Lüge oder reine Fiktion. Er basiert oft auf einem historischen Kern, übersteigert diesen jedoch durch selektive Interpretation, Überhöhung und Auslassung. Er ist eine Geschichte, „denen es nicht um historische Wahrheit, sondern politische Bedeutsamkeit geht“ (Herfried Münkler).
- Instrumentalisierung: Mythen sind kein Synonym für Propaganda, können aber propagandistisch und ideologisch instrumentalisiert werden, um politische Ziele zu erreichen.
Theoretische Perspektiven auf den Mythos
Die moderne Mythenforschung bietet verschiedene Analyseinstrumente, um die Struktur und Wirkungsweise von Mythen zu verstehen.
Jörn Rüsens Kriterien der Plausibilität (Triftigkeit)
Aus geschichtsdidaktischer Perspektive lässt sich ein Mythos als historische Narration definieren, deren Plausibilität bei näherer Betrachtung problematisch erscheint. Jörn Rüsen bietet drei Kriterien zur Beurteilung der Plausibilität („Triftigkeit“) einer historischen Erzählung:
| Triftigkeitskriterium | Beschreibung | Kennzeichen eines Mythos |
| Empirische Triftigkeit | Die Erzählung darf bekannten Quellenaussagen nicht widersprechen. | Die Aussagen stehen im Widerspruch zu Quellen oder füllen Lücken rein fiktiv. |
| Normative Triftigkeit | Die angebotene Sinnbildung und Identitätsstiftung muss für die Rezipienten zustimmungsfähig sein. | Die angebotene Sinnbildung wird als nicht mehr nachvollziehbar oder akzeptabel empfunden (z. B. aufgrund gewandelter Werte). |
| Narrative Triftigkeit | Der Sinnzusammenhang zwischen vergangenen Einzelereignissen und der daraus abgeleiteten Bedeutung für die Zukunft muss plausibel sein. | Vergangene Ereignisse werden retrospektiv überhöht und ihre Bedeutung für langfristige Entwicklungen wird unangemessen zugeschrieben (z. B. Ursprungsmythen). |
Rüsens Dimensionen des Geschichtsbewusstseins
Jede historische Erzählung bewegt sich in einem Spannungsfeld dreier Dimensionen. Mythen entstehen oft durch die Dominanz einer Dimension über die anderen.
- Kognitive Dimension („Wahrheit“): Fragt nach der Plausibilität und Begründbarkeit von Aussagen. Eine Dominanz dieser Dimension kann zur Ideologisierung der Erinnerung führen.
- Ästhetische Dimension („Schönheit“): Betrifft die Faszinationskraft, formale Stimmigkeit und pragmatische Eingängigkeit einer Erzählung. Eine Dominanz führt zur Ästhetisierung der Erinnerung.
- Politische Dimension („Macht“): Bezieht sich auf die Legitimation von Herrschaft und die Vermittlung von Werten. Eine Dominanz führt zur Politisierung der Erinnerung.
Weitere theoretische Ansätze
- Roland Barthes: Betrachtete den Mythos als ein semiotisches System, das historische Gegebenheiten durch Sprache enthistorisiert und ihnen so den Anschein von etwas Natürlichem und Unantastbarem verleiht.
- Claude Lévi-Strauss: Analysierte die strukturelle Verfasstheit von Mythen und stellte fest, dass sie oft auf grundlegenden Antagonismen (z. B. Natur vs. Kultur, Gut vs. Böse) basieren.
- Jan Assmann: Prägte den Begriff der „Mythomotorik“, der die mobilisierende, handlungsorientierende Kraft von Mythen beschreibt, die im kulturellen Gedächtnis einer Gesellschaft verankert sind.
- Herfried Münkler: Betont den legitimierenden Charakter von Mythen, die bestehende politische Ordnungen bekräftigen und Gemeinschaften eine Identität verleihen.
Die gesellschaftliche Funktion von Mythen
Mythen sind keine reinen Relikte der Vergangenheit, sondern erfüllen wichtige soziale und politische Funktionen in der Gegenwart.
- Identitätsstiftung: Sie schaffen den narrativen Zusammenhalt einer Gemeinschaft (Nation, Gruppe) und binden die Gegenwart an eine sinngebende Vergangenheit.
- Legitimation: Sie bekräftigen politische Ordnungen und verleihen ihnen eine historische Tiefendimension.
- Mobilisierung: Sie mobilisieren Kräfte, um politische Ziele zu erreichen.
- Verstärkung durch Rituale: Die Macht von Mythen entfaltet sich besonders stark im Zusammenspiel mit visueller Verdichtung (Denkmäler) und ritueller Inszenierung (Gedenkfeiern), die den Mythos vergegenwärtigen und emotional verankern.
- Orientierung: Sie nähren sich vom Orientierungsbedürfnis der Menschen in einer zunehmend unübersichtlichen und komplexen Welt.
- Ökonomie: Die mediale Aufbereitung von Mythen in Form von Literatur, Filmen oder Tourismus kann erheblichen finanziellen Gewinn bringen.
2. Mythen in Geschichtsschulbüchern
Geschichtsschulbücher stehen im Zentrum der Weitergabe und Auseinandersetzung mit historischen Mythen. Ihre Rolle ist dabei ambivalent und hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Das Schulbuch als „Mythengenerator“
Seit seiner Etablierung im 19. Jahrhundert wurde dem Geschichtsschulbuch neben der Wissensvermittlung auch eine sinnstiftende Aufgabe zugewiesen. Es entwickelte sich zu einem idealen Medium, um:
- die Ergebnisse der Geschichtswissenschaft zu popularisieren,
- die Bildung europäischer Nationalstaaten durch entsprechende Meistererzählungen zu unterstützen,
- nationale Mythen zu etablieren und eine nationalistische „Mythomotorik“ zu betreiben.
Durch den Ausbau des öffentlichen Schulwesens erlangten Schulbücher eine hohe Autorität und Verbreitung. Aktuelle Geschichtsschulbücher stehen teilweise immer noch in dieser Tradition, da der Nationalstaat als Orientierungsrahmen fortbesteht oder Renationalisierungsprozesse an Dynamik gewinnen.
Der didaktische Umgang mit Mythen
Der moderne Geschichtsunterricht sieht in Mythen nicht mehr nur zu entlarvende „Lügengeschichten“, sondern erkennt ihr Potenzial für die Entwicklung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins und einer „geschichtskulturellen Kompetenz“. Anstatt Mythen einfach zu dekonstruieren, geht es darum, sie als historische Phänomene zu analysieren.
Ein pragmatischer Ansatz für den Unterricht umfasst eine getrennte Untersuchung folgender Fragen:
- Funktion und Relevanz: Inwiefern war/ist die Geschichte gesellschaftlich relevant? Welche Bedürfnisse bediente sie? Welche historische Sinnbildung wird angeboten und für wen?
- Plausibilitätsprüfung: Inwiefern ist die erzählte Geschichte als empirisch, normativ und narrativ triftig einzuschätzen?
- Analyse der Orientierungsbedürfnisse: Inwiefern war/ist die Erzählung Ausdruck politischer oder ästhetischer Bedürfnisse? Wie entstehen, verändern sich und sterben politische Mythen?
Ein methodisches Problem bleibt, dass der lebendige, vieldeutige (polyvalente) Mythos sich nicht fixieren lässt. Schulbücher können immer nur einzelne, fixierte Manifestationen (Texte, Bilder) behandeln, die nicht mit dem Mythos selbst verwechselt werden dürfen.
3. Fallstudien ausgewählter Mythen in Schulbüchern
Die Analyse spezifischer Mythen in Schulbüchern zeigt deren Struktur, Langlebigkeit und die Herausforderungen bei ihrer didaktischen Aufarbeitung.
Europäische „Rettungsmythen“: Marathon/Salamis und Tours/Poitiers
- Der Mythos: In den Schlachten von Marathon/Salamis (490/480 v. Chr.) und Tours/Poitiers (732 n. Chr.) wurde die europäische „Freiheit“ und „Zivilisation“ gegen die asiatische „Knechtschaft“ und „Barbarei“ (Perser, Araber) verteidigt. Eine Niederlage hätte das Ende Europas bedeutet.
- Dekonstruktion: Die Griechen der Antike verstanden sich nicht als „Europäer“ im modernen Sinne. Die Bedeutung der Schlachten wurde retrospektiv massiv überhöht, um ein teleologisches Geschichtsbild eines sich stets verteidigenden, überlegenen Europas zu konstruieren. Der Begriff „Europenses“ in einer Quelle zur Schlacht von Tours und Poitiers bezog sich wahrscheinlich nur auf Franken und Burgunder.
- Darstellung im Wandel: Schulbücher des 19. Jahrhunderts stellten diese Mythen als historische Wahrheit dar und nutzten sie für nationalistische Narrative. Nach dem Zweiten Weltkrieg wich die Heroisierung einer wertneutraleren Darstellung. In aktuellen Lehrplänen (z. B. G8 in NRW) sind diese Ereignisse oft nicht mehr obligatorisch, wodurch der Mythos an expliziter Präsenz verliert. Dennoch wird er bisweilen „in Reserve gehalten“, indem er durch eindrucksvolle Bilder oder unkritische Quellenarbeit latent weiterwirkt.
Der Hermannsmythos (Varusschlacht)
- Der Mythos: Arminius, eingedeutscht zu „Hermann“, einte die „Deutschen“ (Germanen) und errang in der Varusschlacht (9 n. Chr.) einen entscheidenden Sieg, der „Deutschland“ vor der römischen Herrschaft bewahrte und dessen Freiheit sowie kulturelle Eigenständigkeit sicherte.
- Dekonstruktion: Der Sieg war nicht kriegsentscheidend; die Römer unternahmen unter Germanicus weitere Feldzüge. Die von Cäsar als „Germani“ bezeichneten Stämme waren keine Einheit und schon gar keine „Deutschen“. Die Gleichsetzung ist eine Konstruktion des Humanismus und vor allem des Nationalismus des 19. Jahrhunderts, um eine ruhmreiche, weit zurückreichende nationale Vergangenheit zu schaffen.
- Darstellung im Wandel: Im frühen 19. Jahrhundert wurde der Mythos als Vorbild im Kampf gegen Napoleon popularisiert (z. B. durch den Schulbuchautor Gabriel Bredow). Im Kaiserreich wurde er trotz der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Geschichtsschreibung weiter tradiert. In der NS-Zeit war er nützlich, stand aber nicht im Zentrum der Propaganda. In der Bundesrepublik hielt sich der Mythos zunächst, wurde aber ab den späten 1960er Jahren im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalismus zunehmend dekonstruiert oder aus den Lehrplänen verdrängt. Die archäologischen Funde in Kalkriese führten zu einem erneuten Interesse, das aber meist wissenschaftlich-kritisch begleitet wird.
Der Behaim-Mythos
- Der Mythos: Der Nürnberger Martin Behaim, überzeugt von der Kugelgestalt der Erde, baute 1492 den ersten Globus und inspirierte damit Christoph Kolumbus. Dies geschah vor dem Hintergrund eines Mittelalters, in dem die Gelehrten an eine flache Erde glaubten.
- Dekonstruktion: Dieser Mythos ist in allen wesentlichen Punkten empirisch nicht triftig. Die Kugelgestalt der Erde war den Gelehrten des Mittelalters bekannt. Behaims Globus war nicht der erste, sondern nur der älteste erhaltene. Es gibt keine Belege für einen Kontakt oder eine Inspiration von Kolumbus. Der Mythos ist Teil einer größeren Meistererzählung vom „finsteren Mittelalter“ und der „wissenschaftlichen Revolution“ der Neuzeit.
- Funktion und Darstellung: Der Mythos entstand im 17. Jahrhundert (Johann Christoph Wagenseil), um einen „deutschen Helden“ der Entdeckungszeit zu kreieren. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde er genutzt, um deutschnationale und koloniale Ansprüche zu untermauern. In Schulbüchern hält sich das Narrativ hartnäckig, da es eine einfache, eingängige Geschichte („Monomythos“) im Sinne eines klaren Fortschrittsnarrativs bietet.
Der Kolonialmythos (Europäische Expansion in Afrika)
- Der Mythos: Europa brachte Fortschritt, Zivilisation und Moderne in einen als geschichtslos, statisch und rückständig imaginierten afrikanischen Kontinent. Die koloniale Eroberung wird als Schöpfungsakt und Zivilisierungsmission dargestellt, bei der europäische Überlegenheit als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
- Strukturelemente: Der Mythos operiert mit der Fiktion des „leeren Raumes“ (terra nullius), einem dichotomen Narrativ (aktiv/passiv, fortschrittlich/rückständig) und stereotypen Bildern des „Anderen“ (exotisiert oder als barbarischer Gegner dämonisiert, um Gewalt zu legitimieren).
- Funktion und Darstellung: Der Kolonialmythos diente der Legitimation imperialer Herrschaft. Historische Schulbücher der Kolonialmächte reproduzierten dieses Narrativ. Obwohl die postkoloniale Forschung diese Meistererzählung dekonstruiert hat, wirken ihre Denkfiguren in aktuellen Darstellungen fort, etwa wenn die Probleme postkolonialer afrikanischer Staaten auf eine vermeintliche „Rückständigkeit“ zurückgeführt werden, anstatt die komplexen Verflechtungsgeschichten zu analysieren.
Der Mythos des Ersten Kreuzzugs
- Der Mythos: Je nach Perspektive existieren unterschiedliche Mythen. In der westlichen Welt werden die Kreuzzüge oft als Ausdruck mittelalterlichen religiösen Fanatismus gesehen. In der arabisch-islamischen Welt sind sie Teil eines wirkmächtigen Narrativs fortwährender westlicher Aggression, in dem Saladin als mythischer Befreier Jerusalems fungiert.
- Dekonstruktion in Schulbüchern: Die Analyse von Schulbüchern für die Realschule in NRW zeigt, dass zentrale Ereignisse oft mythisch aufgeladen und vereinfacht dargestellt werden:
- Eroberung Jerusalems (1099): Das Massaker wird oft mit übertriebenen Opferzahlen (z.B. 70.000 Tote aus einer viel späteren Quelle) als Faktum präsentiert, um die Brutalität der Kreuzfahrer zu betonen. Die komplexen Regeln mittelalterlicher Belagerungskriege werden ignoriert.
- Kultureller Austausch: Das angebliche „friedliche Zusammenleben“ und die „Orientalisierung“ der Franken werden durch Fehlinterpretationen von Quellen (z.B. Fulcher von Chartres) als Beleg für eine kulturelle Annäherung postuliert, die es in dieser Form nicht gab.
- Zeitgenössische Kritik: Kritische Stimmen wie die von Radulfus Niger werden oft anachronistisch als Ausdruck eines modernen Humanismus interpretiert, obwohl ihre Argumentation tief in der mittelalterlichen Theologie verwurzelt war.
Der Hitler-Mythos in österreichischen Schulbüchern
- Der politische Mythos (NS-Zeit): Eine gezielte Propaganda-Konstruktion, die Hitler als quasireligiösen „Führer“ und Erlöser der deutschen Nation stilisierte. Er diente der Integration der Bewegung und der Stabilisierung der Herrschaft.
- Der historische Mythos (Nachkriegszeit): Die Tendenz, den Nationalsozialismus, seine Verbrechen und den Zweiten Weltkrieg primär durch die Person, die Ideologie und den Willen Adolf Hitlers zu erklären („Hitlerismus“). Dies führt zu einer extremen Personalisierung komplexer historischer Prozesse und blendet gesellschaftliche, strukturelelle und soziale Faktoren aus.
- Darstellung in Schulbüchern: Eine quantitative und qualitative Analyse aktueller österreichischer Schulbücher ergibt ein differenziertes Bild:
- Hohe Personalisierung: In den Kapiteln zum Nationalsozialismus wird Hitler sehr häufig als handelndes Subjekt (Agens) genannt, insbesondere bei der Darstellung der „Machtergreifung“ und der Außenpolitik.
- Entpersonalisierung des Holocaust: In den Abschnitten über Judenverfolgung und Holocaust wird Hitlers Name signifikant seltener genannt. Die Verantwortung wird hier stärker dem „NS-Regime“ oder den „Nationalsozialisten“ zugeschrieben. Dies deutet darauf hin, dass die geschichtsdidaktische Kritik an der alleinigen Fokussierung auf Hitler als Täter hier Wirkung gezeigt hat.
- Visuelle Dominanz: Hitler ist auf Bildern sehr präsent, oft in Porträts oder als zentrale Figur in Massenveranstaltungen, was seine mythische Rolle als alleiniger Handlungsträger visuell verstärkt.
Der Mythos der Reichsautobahn
- Der Mythos: Die Reichsautobahn war eine originäre Erfindung Hitlers, die maßgeblich zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit beitrug. Sie war zudem ein strategisch wichtiges Militärprojekt und ein Symbol für die Modernität und Leistungsfähigkeit des NS-Regimes.
- Dekonstruktion: Alle Kernelemente des Mythos sind widerlegbar:
- Urheberschaft: Pläne für ein Autobahnnetz existierten bereits in der Weimarer Republik (z.B. HAFRABA).
- Arbeitslosigkeit: Der Beitrag des Autobahnbaus zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit war marginal. Entscheidend waren die massive Aufrüstung und andere konjunkturpolitische Maßnahmen.
- Militärischer Nutzen: Der strategische Wert war gering; die Reichsbahn blieb das wichtigste Transportmittel.
- Arbeitsbedingungen: Die Arbeit war extrem hart, schlecht bezahlt und gefährlich. Es gab zahlreiche Proteste, Streiks und ab 1940 den massiven Einsatz von Zwangsarbeitern.
- Propaganda: Das Projekt war vor allem eine gigantische, propagandistisch inszenierte „Arbeitsschlacht“, die den Mythos einer funktionierenden „Volksgemeinschaft“ und eines zupackenden „Führers“ schaffen sollte.
- Darstellung in Schulbüchern: Eine Analyse hessischer Lehrwerke zeigt, dass der Mythos oft nur unzureichend dekonstruiert wird. Während der ökonomische Aspekt meist durch Statistiken zur Rüstungswirtschaft widerlegt wird, bleiben andere Aspekte (Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit, militärischer Nutzen) unterbelichtet. Ein Hauptproblem ist der unkritische Einsatz ikonischer Propagandabilder (z. B. Hitlers erster Spatenstich, Werbeplakate), die oft nur illustrativ verwendet werden und so die visuelle Kraft des Mythos reproduzieren, anstatt sie als Quelle für Propagandaanalyse zu nutzen.
Mythen der Schweiz im Kalten Krieg
- Kontext und Funktion: Der Kalte Krieg fungierte als Katalysator zur Festigung des schweizerischen Selbstbildes, das sich in der Zwischenkriegszeit im Rahmen der „Geistigen Landesverteidigung“ herausgebildet hatte. Der Antikommunismus bot ein neues Feindbild, das die innergesellschaftliche Kohäsion stärkte und bestehende nationale Mythen fortschrieb.
- Fortgeschriebene Mythen:
- Freiheitsmythos: Gestützt auf Figuren wie Wilhelm Tell, symbolisierte er den unbedingten Willen zur Unabhängigkeit.
- Neutralitätsmythos: Die Vorstellung einer besonderen, historisch tief verwurzelten und wehrhaften Neutralität wurde zum zentralen Dogma.
- Wehrhaftigkeitsmythos: Das Bild der „Igel-Schweiz“ und des wehrhaften Bürgersoldaten wurde durch die Konzeption der „totalen Landesverteidigung“ und den massiven Ausbau von Zivilschutzbunkern untermauert.
- Neue Geschichtsbilder: Neben den klassischen Mythen entstanden spezifische Narrative des Kalten Krieges: Der Antikommunismus selbst wurde zu einem quasi-mythischen Deutungsrahmen. Die politische Konkordanz und der Konsens wurden als spezifisch schweizerische Tugenden mythologisiert, die das Land vor inneren Konflikten bewahrten.
- Darstellung in Schulbüchern: Ältere Lehrmittel aus der Zeit des Kalten Krieges reproduzierten diese Mythen weitgehend. Neuere Lehrmittel hingegen neigen dazu, diese Narrative zu dekonstruieren, indem sie z.B. den Antikommunismus selbst zum Gegenstand historischer Analyse machen.
Der Élysée-Vertrag von 1963 als Gründungsmythos
- Der Mythos: Der Élysée-Vertrag von 1963 markiert den Wendepunkt von einer „jahrhundertealten Erbfeindschaft“ zur deutsch-französischen Freundschaft und Partnerschaft. Er wird als Gründungsakt dargestellt, der durch die persönliche Vision der beiden Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle ermöglicht wurde und den Grundstein für die europäische Einigung legte.
- Strukturelemente eines Gründungsmythos: Die Darstellung in Schulbüchern weist Merkmale mythischen Erzählens auf:
- Ursprungsgeschichte: Die „jahrhundertelange Rivalität“ wird als quasi mythische Vorgeschichte inszeniert, die durch den Vertrag beendet wird.
- Heroische Gründerfiguren: Adenauer und de Gaulle werden als Dioskurenpaar dargestellt, deren persönliches Einvernehmen die historische Wende herbeiführte.
- Sakralisierung: Symbolische Akte wie die Versöhnungsmesse in Reims werden visuell eingesetzt, um dem Ereignis eine quasi-heilige Dimension zu verleihen.
- Mobilisierung für die Zukunft: Der Vertrag und insbesondere der Jugendaustausch werden als normative Aufträge für zukünftige Generationen dargestellt.
- Darstellung im Wandel („Arbeit am Mythos“):
- 1970er/80er Jahre: Starke Personalisierung auf Adenauer und de Gaulle; der Vertrag wird als Gegenmodell zur Ostpolitik (Brandt) oder als Hindernis für die atlantische Partnerschaft dargestellt.
- 1990er Jahre: Das Narrativ „von der Erbfeindschaft zur Freundschaft“ etabliert sich. Der Vertrag wird nun als „Motor der europäischen Integration“ in eine größere Meistererzählung der europäischen Einigung eingebettet.
- 2000er Jahre: Neuere und insbesondere das deutsch-französische Geschichtsbuch verfolgen einen kulturwissenschaftlichen Ansatz, thematisieren Erinnerungsorte und Symbolik und regen zur Dekonstruktion an. Der Mythos wird transformiert: Die Gründungserzählung der deutsch-französischen Freundschaft wird zunehmend zur Gründungserzählung der europäischen Integration, mit dem „couple franco-allemand“ als wiederkehrendem mythischen Element.
Erstellt: 25.10.2025 - 16:55 | Geändert: 26.10.2025 - 04:25