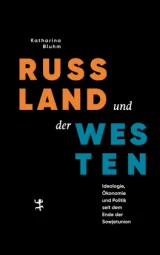Russland und der Westen
Ideologie, Ökonomie und Politik seit dem Ende der Sowjetunion
Seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 wird sehr viel über die Gedankenwelt des mächtigsten Mannes Russlands gerätselt. Der früher als geschickter Pragmatiker anerkannte Putin wirkt nun als entrückter alter Mann, der als neuer Peter I. oder Nikolai I. in die Geschichte eingehen möchte.
Es wird gerätselt, was er liest, wem er sein Ohr leiht, wer sich seines Hirns bemächtigt hat. Jeder kann Putins geschichtsversessene Reden auf Deutsch lesen. Also alles bekannt?
Katharina Bluhms grundlegendes Buch wendet sich gegen den verkürzten Blick auf die Machtspitze Russlands und die Putinologie. Sie analysiert, wie sich seit dem Ende der 1990er-Jahre eine illiberal-konservative, intellektuelle Gegenbewegung zur Schocktherapie und Westintegration formiert hat, wie sie in den 2000er-Jahren versucht, sich im neuen Parteiensystem Russlands zu etablieren, und wie deren Motive, Ideen und Konzepte ab 2012 in das konservativ-repressive Staatsprojekt Putins einfließen.
Bluhm lenkt die Aufmerksamkeit auf jene gesellschaftlichen Kräfte, die das Putin-Regime tragen und seinen Staatskapitalismus beeinflusst haben, zugleich aber in permanenter Spannung zu ihm stehen. Ohne sie lässt sich die Rückkehr Russlands als eine revisionistische Macht auf die Weltbühne nicht verstehen.
Grenzen einer These: Stalin war 26 Jahre an der Macht. Putin wird am Ende seiner nächsten „Amtszeit“ 30 Jahre geherrscht haben. Dass es so kommen wird, daran bestehen keine Zweifel. (...) Den Stalinismus hätte es ohne Stalin nicht gegeben. Auch der Putinismus ist von Vladimir Putin nicht zu trennen. (...) Doch worin bestehen die Wurzeln dieses Denkens, in dem Traditionalismus, Nationalismus, Antiliberalismus, Antiamerikanismus und russisches imperiales Denken verschmelzen und das zur antiwestlichen Staatsideologie in Russland geworden ist? Mit dieser Frage beschäftigt sich Katharina Bluhm in ihrer Monografie Russland und der Westen. Ideologie, Ökonomie und Politik seit dem Ende der Sowjetunion. Bluhm, Soziologin am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, gibt sich mit einem „It’s Putin, stupid!“ nicht zufrieden. Für sie ist die Konzentration auf die Führerfigur reduktionistisch. Stattdessen nimmt sie die sozioökonomische Entwicklung seit der späten Sowjetunion in den Blick. (...) Trotz (...) Einwände gilt: Katharina Bluhms Buch ist lesenswert. Es bietet eine fundierte Analyse der politischen Ökonomie Russlands seit Mitte der 1980er-Jahre, es führt kenntnisreich in das konservative, antiliberale und antidemokratische Denken in Russland ein, mit dem der Krieg gegen die Ukraine und die Frontstellung gegen den Westen legitimiert wird. Und es zeigt, wie dieses Denken Teil der russländischen Staatsideologie von heute geworden ist. Das Buch ist eine intellektuelle Herausforderung. Trotz dieser Einwände gilt: Katharina Bluhms Buch ist lesenswert. Es bietet eine fundierte Analyse der politischen Ökonomie Russlands seit Mitte der 1980er-Jahre, es führt kenntnisreich in das konservative, antiliberale und antidemokratische Denken in Russland ein, mit dem der Krieg gegen die Ukraine und die Frontstellung gegen den Westen legitimiert wird. Und es zeigt, wie dieses Denken Teil der russländischen Staatsideologie von heute geworden ist. Das Buch ist eine intellektuelle Herausforderung. Von Manfred Sapper Soziopolis 14.03.2024
Putins Idee einer neuen Weltordnung: Katharina Bluhm analysiert brillant, wie sich in Moskau über Jahrzehnte ein "illiberaler Konservatismus" etablierte und worum es dem kriegsführenden Präsidenten wirklich geht - jedenfalls nicht um ein bisschen Landgewinn und alte russische Herrlichkeit. [hinter der Bezahlschranke] Von Florian Keisinger Süddeutsche Zeitung 07.01.2024
Pressenotizen Perlentaucher
Die Autorin
Katharina Bluhm, Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Osteuropa ist in Ostberlin aufgewachsen und hat an der Humboldt-Universität Philosophie und der Lomonossow-Universität in Moskau studiert. Nach 1989/90 wechselte sie von der Philosophie in die Soziologie und von der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin an die Georg-August-Universität Göttingen. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen gehören die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Harvard-Universität in Cambridge (USA) sowie die Universität in Osnabrück. Ihre aktuellen Forschungsfelder sind die illiberal-konservative Wende in Russland und Ostmitteleuropa, Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie die Rolle von Eliten.
Erstellt: 26.02.2025 - 06:39 | Geändert: 14.03.2025 - 12:46