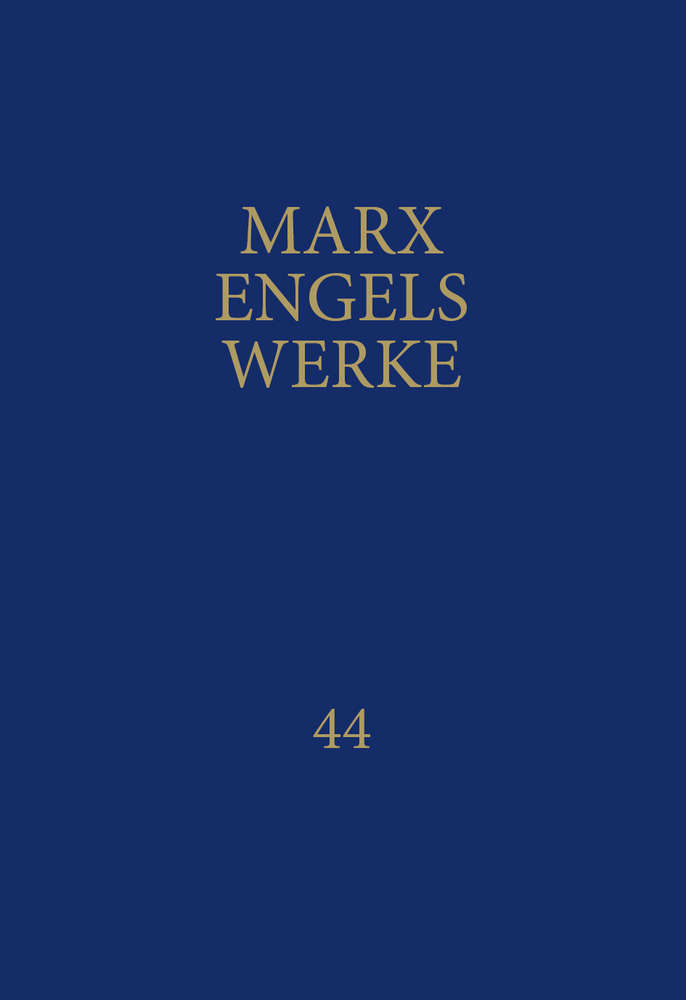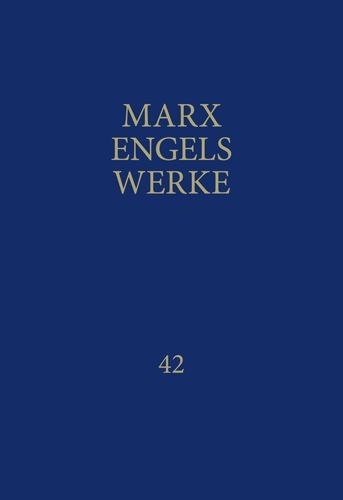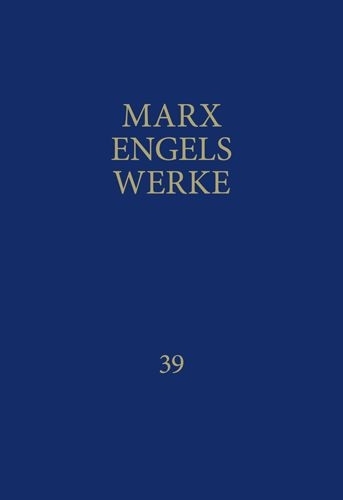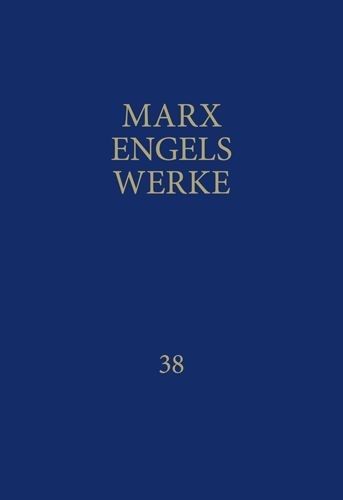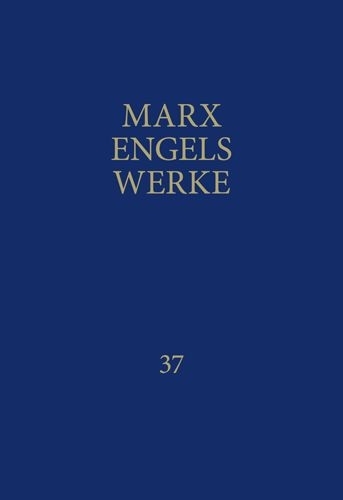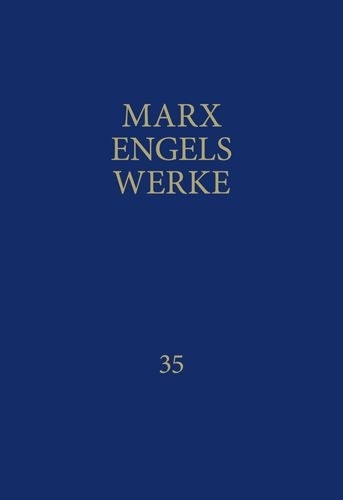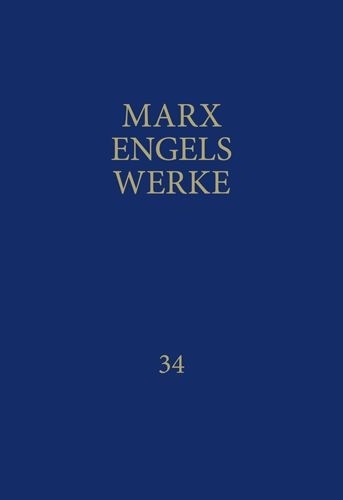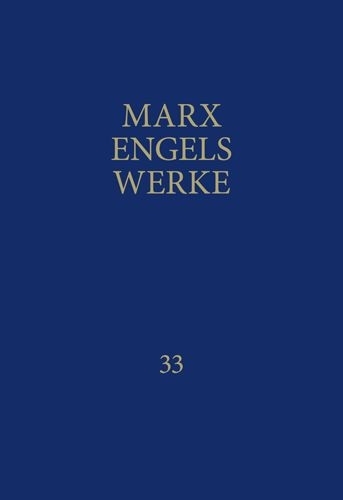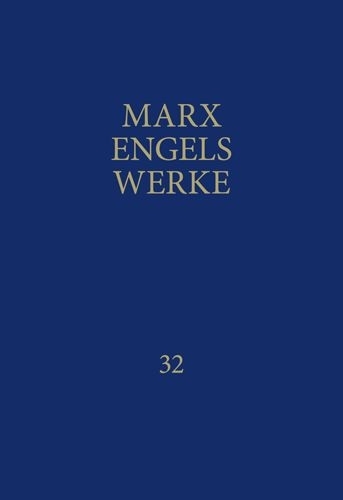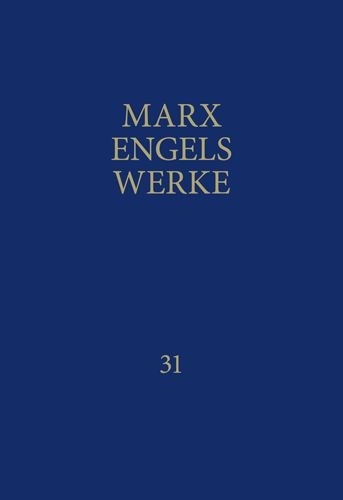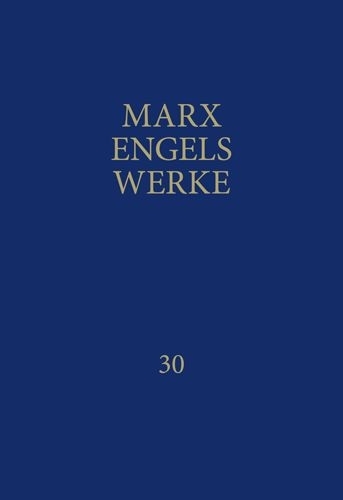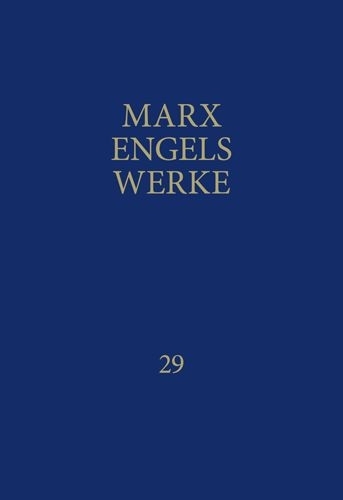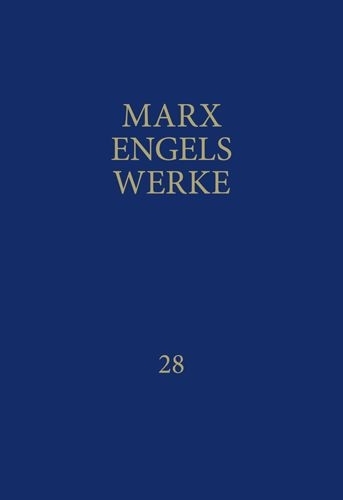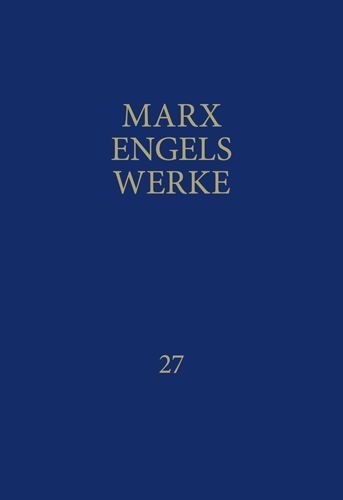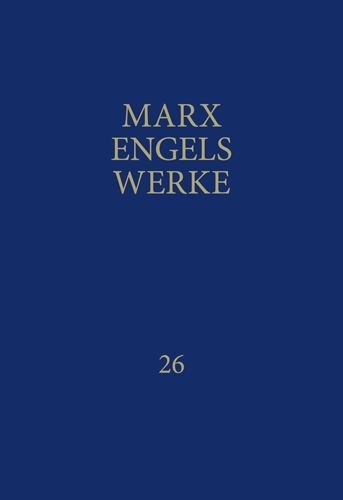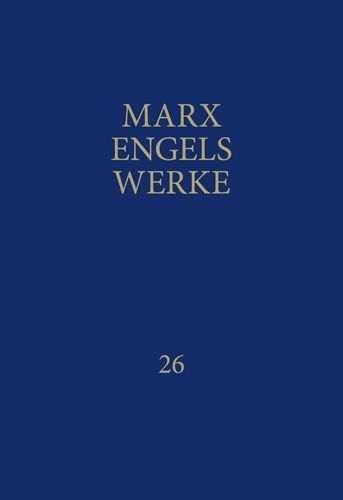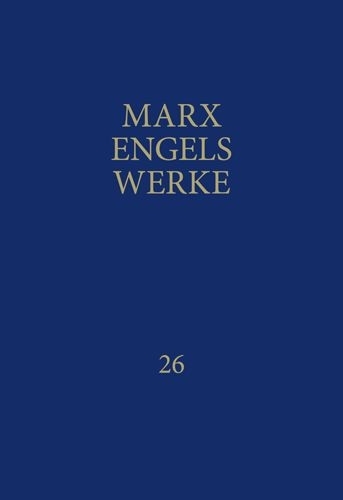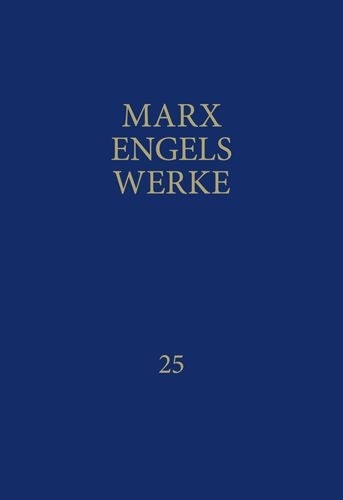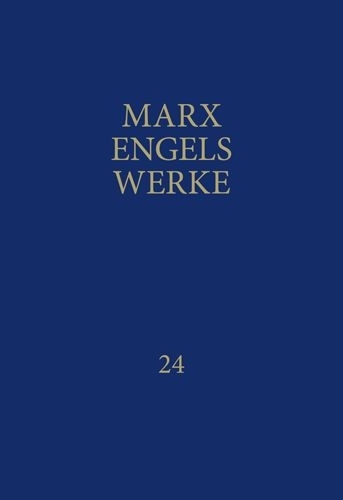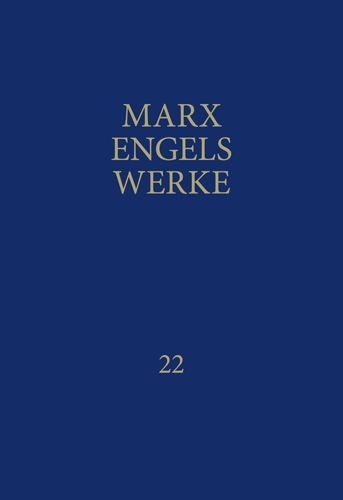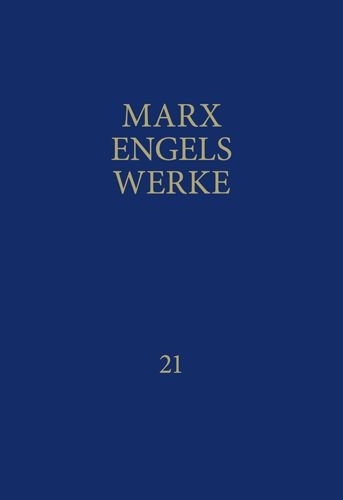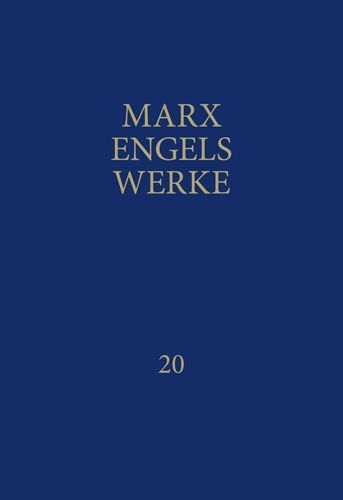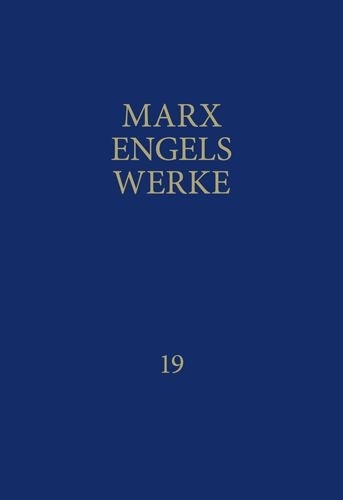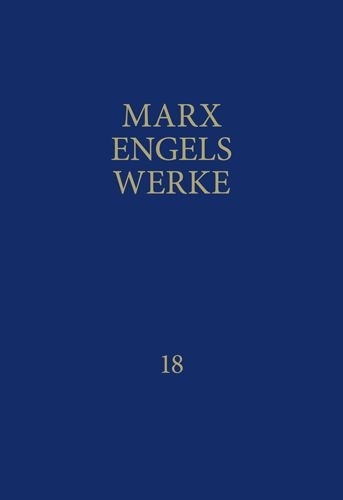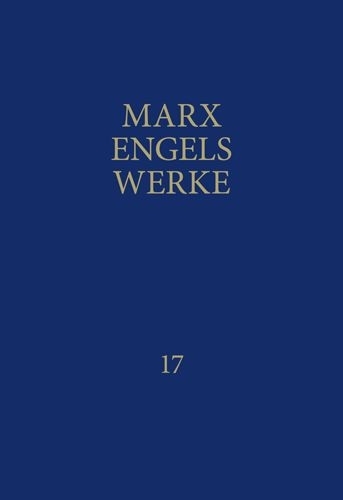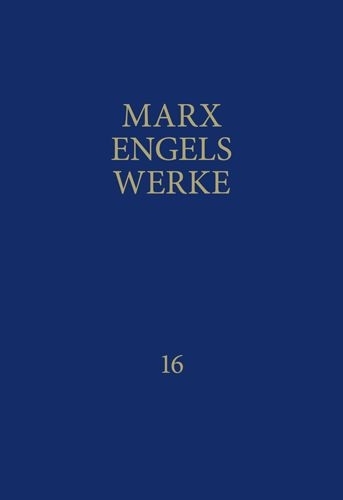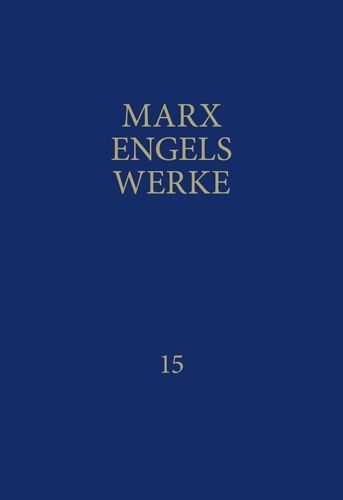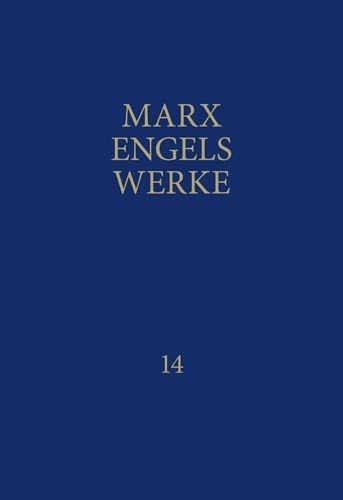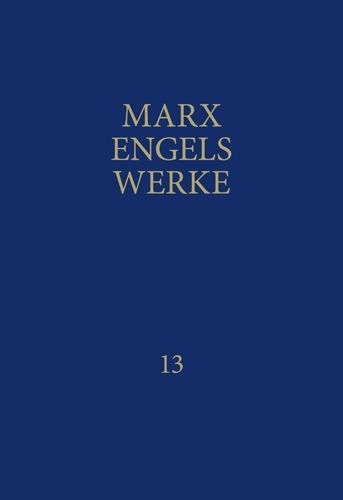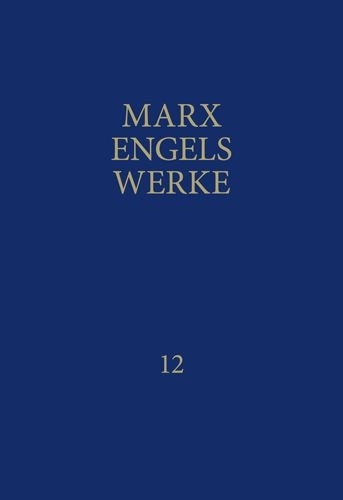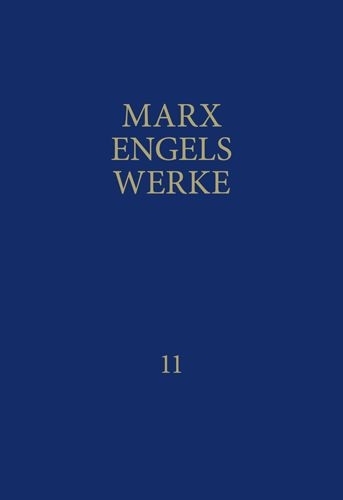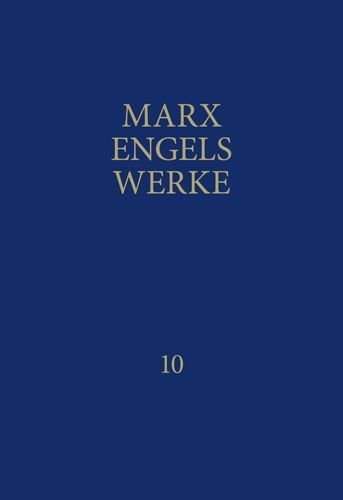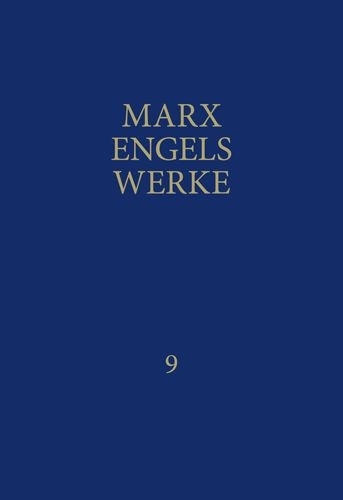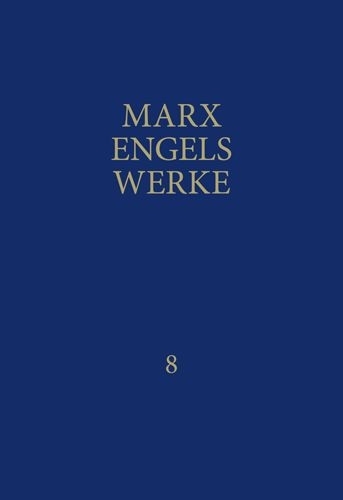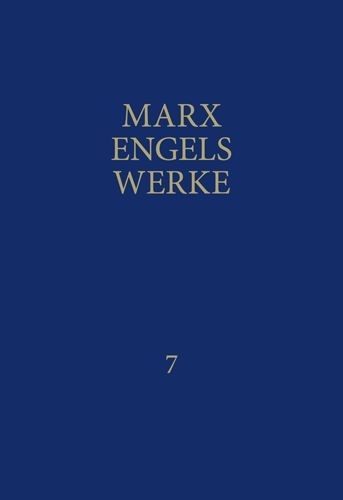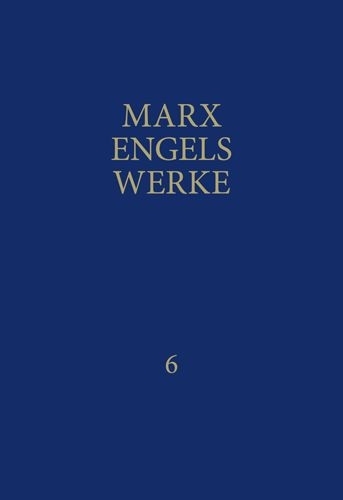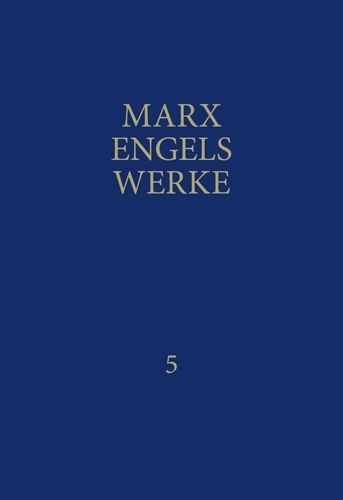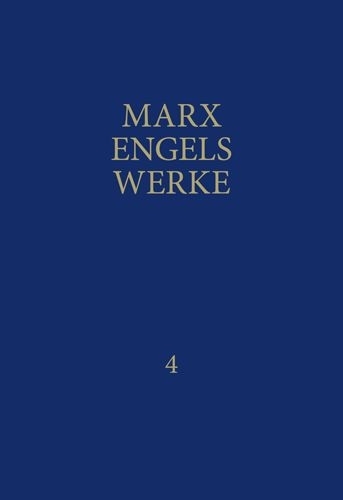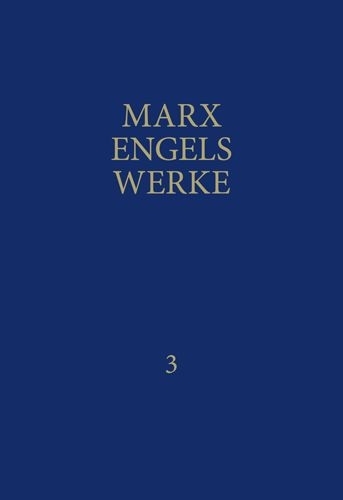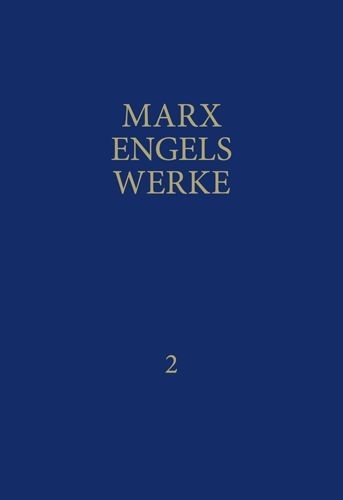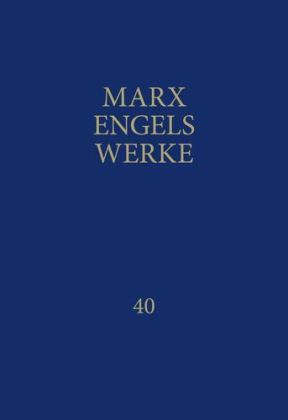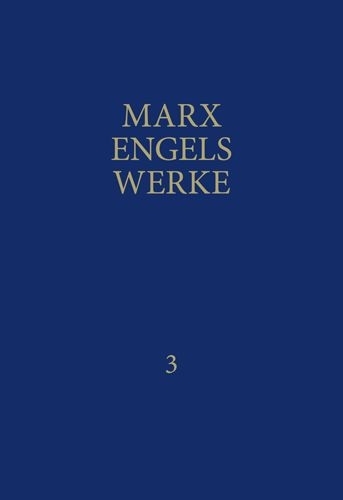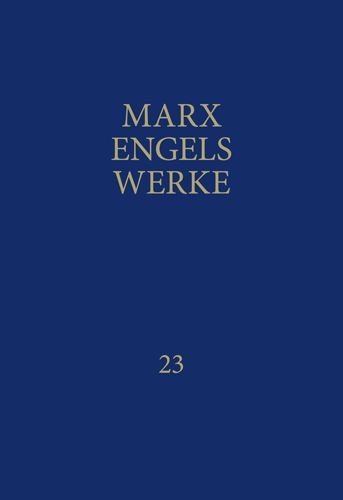Marx-Engels-Werke (MEW) Band 1
Von 1839 bis 1844

Aus dem Inhalt: Zur Judenfrage; Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie; Artikel aus "Telegraph für Deutschland", "Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst", "Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe", "Schweizerischer Republikaner", "The New Moral World", "Deutsch-Französische Jahrbücher", "Vorwärts".
Synthese der frühen Schriften von Marx und Engels: Eine thematische Analyse
Auf der Grundlage der Ausgabe von 1981
Zusammenfassung
Dieses Briefing-Dokument fasst die zentralen Themen und Argumente aus den frühen Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels zusammen, wie sie im bereitgestellten Kontext dargestellt werden. Die Analyse offenbart die intellektuelle Entwicklung beider Denker von einer radikaldemokratischen Kritik am preußischen Staat hin zur Formulierung der grundlegenden Thesen des wissenschaftlichen Kommunismus.
Die zentralen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Die Rolle der Philosophie und Theorie: Marx begreift die Philosophie als die „geistige Quintessenz ihrer Zeit“, die bei Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstadiums mit der Wirklichkeit in Wechselwirkung treten und diese verändern muss. Eine fortschrittliche Theorie wird zur „geistigen Waffe“ im Kampf der Massen, während das Proletariat die „materielle Waffe“ der Philosophie darstellt.
- Kritik am preußischen Staat und Recht: Marx unterzieht die Institutionen des preußischen Staates einer scharfen Kritik. Er entlarvt die Zensurgesetze als „Gesetze des Terrorismus“ und „Gesinnungsgesetze“, die auf Willkür basieren. Anhand der Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz zeigt er auf, wie Privatinteressen der besitzenden Klassen zum Gesetz erhoben werden und traditionelle Gewohnheitsrechte der Armen kriminalisiert werden.
- Entdeckung der materiellen Interessen: Sowohl Marx in seiner Analyse der Landtagsdebatten als auch Engels in seinen Studien über England erkennen, dass die soziale Stellung und die ökonomischen Interessen die politische Haltung und die Parteikämpfe bestimmen. Engels identifiziert in England die Spaltung der Gesellschaft in Landaristokratie, Bourgeoisie und Proletariat und bezeichnet den Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat als den Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft.
- Die historische Mission des Proletariats: Beide Denker identifizieren das Proletariat als die revolutionäre Kraft, die in der Lage ist, die Gesellschaft umzugestalten. Marx sieht im Schlesischen Weberaufstand einen Ausdruck des wachsenden Klassenbewusstseins der deutschen Arbeiter. Engels schließt aus seiner Analyse der englischen Verhältnisse, dass das Proletariat die Kraft ist, die eine soziale Umwälzung vollziehen wird.
- Kritik am Kapitalismus und seinen Ideologen: Engels übt eine umfassende Kritik am Kapitalismus. Er prangert die unmenschliche Bevölkerungstheorie von Malthus als „infame, niederträchtige Doktrin“ an und entlarvt den Klassencharakter der bürgerlichen Demokratie und der englischen Verfassung, indem er die Eigentumsverhältnisse als Grundlage des Staates identifiziert.
- Die Notwendigkeit der Revolution: Die Schriften betonen, dass der Übergang zu einer neuen Gesellschaft ohne revolutionäre Aktionen der Massen, angeführt vom Proletariat, unmöglich ist. Eine soziale Revolution hat eine untrennbare politische Seite (Sturz der Macht) und soziale Seite (Zerstörung der alten Verhältnisse).
--------------------------------------------------------------------------------
Detaillierte Analyse
1. Die Rolle von Philosophie, Presse und Kritik
Die Texte heben die zentrale Bedeutung hervor, die Marx der Philosophie als treibende Kraft gesellschaftlicher Veränderung zumaß. Sie wird als die „geistige Quintessenz ihrer Zeit“ definiert, die in einen notwendigen Gegensatz zur realen Wirklichkeit gerät und diese schließlich verändern muss.
1.1. Philosophie als Waffe der Veränderung
- Historische Aufgabe: Die Philosophie nimmt die gesellschaftliche Veränderung geistig vorweg. Wenn der Widerspruch zwischen der philosophischen Erkenntnis und der realen Welt eine bestimmte Stufe erreicht, muss die Philosophie „mit der Wirklichkeit in Wechselwirkung treten“.
- Theorie und Praxis: Marx formuliert die grundlegende These von der Rolle einer fortschrittlichen Theorie als „geistige Waffe“ der Massen und der Massen als „materieller Kraft“, die die Gesellschaft umgestaltet.
- Lenins Einschätzung: Lenin wird zitiert, der Marx in dieser Phase bereits als Revolutionär sieht, der die „rücksichtslose Kritik alles Bestehenden“ verkündet und an die „Massen und an das Proletariat appelliert“.
1.2. Die Kritik der Zensur und der Mangel an Pressefreiheit
Marx' Auseinandersetzung mit der preußischen Zensur bildet einen Schwerpunkt. Er kritisiert sie nicht nur als Einschränkung, sondern als Ausdruck eines reaktionären und willkürlichen Staatswesens.
- Gesetze des Verdachts: Zensurgesetze, die nicht die Handlung, sondern die Gesinnung zum Kriterium machen, werden als „Gesetze des Terrorismus“ und „positive Sanktionen der Gesetzlosigkeit“ bezeichnet. Sie heben die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz auf und sind „Gesetze der Scheidung, nicht der Einung“.
- Die Natur des Geistes: Die Zensur widerspricht dem Wesen des Geistes, dessen Form „Heiterkeit, Licht“ ist, während die Zensur „den Schatten zu seiner einzigen entsprechenden Erscheinung“ macht.
- Willkür als System: Die Zensur basiert auf der „hochmütigen Einbildung des Polizeistaates auf seine Beamten“. Das System traut dem Publikum nichts zu, während es den Beamten das Unmögliche zutraut. Der Zensor wird an „Gottes Statt zum Richter des Herzens“ gemacht.
2. Analyse des Preußischen Staates und des Klassenrechts
Marx' Untersuchung der Verhandlungen des Rheinischen Landtags dient ihm als Material, um das Wesen des Staates, der sozialen Gliederung und des Rechts zu durchdringen.
2.1. Das Holzdiebstahlsgesetz als Exempel für Klassenjustiz
Die Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz werden als Paradebeispiel dafür analysiert, wie die Privatinteressen der Waldeigentümer, die im Landtag die Gesetzgeber sind, zu allgemeinem Recht erhoben werden.
- Kriminalisierung der Armut: Das Gesetz verwandelt das Sammeln von Raffholz, ein traditionelles Gewohnheitsrecht der Armen, in Diebstahl. Marx argumentiert, dass der Staat eine Handlung, die erst durch die Umstände zu einem Vergehen wird, nicht als Verbrechen bestrafen dürfe.
- Verlust des Rechtsbewusstseins: Indem der Staat bestraft, wo das Volk kein Verbrechen sieht, untergräbt er das Rechtsbewusstsein. „Das Volk sieht die Strafe, aber es sieht nicht das Verbrechen, und weil es die Strafe sieht, wo kein Verbrechen ist, wird es schon darum kein Verbrechen sehen, wo die Strafe ist.“
- Privatinteresse als Gesetzgeber: Das Interesse der Waldeigentümer wird als „kleine, hölzerne, geistlose und selbstsüchtige Seele“ beschrieben, die unfähig ist, einen allgemeinen Standpunkt einzunehmen. Es macht das Gesetz zum „Rattenfänger“, der nur das Ungeziefer vertilgen will. Das Privatinteresse ist „immer feig“, und die von ihm diktierten Gesetze sind von Grausamkeit geprägt.
- Das Gewohnheitsrecht der Armut: Marx vindiziert für die Armut ein universelles Gewohnheitsrecht, das im Gegensatz zu den „Gewohnheiten wider das Recht“ der privilegierten Stände steht. Diese Gewohnheitsrechte der Armen besitzen einen „instinktmäßigen Rechtssinn“ und ihre Wurzel sei „positiv und legitim“.
2.2. Kritik der Historischen Rechtsschule
Marx' Auseinandersetzung mit Hugo, einem Vertreter der historischen Rechtsschule, entlarvt deren reaktionären Kern.
- Rechtfertigung des Unvernünftigen: Die Schule versucht zu beweisen, dass das Positive nicht vernünftig sei, um zu begründen, dass das Positive gelten solle, weil es positiv ist. Hugo „entheiligt daher alles, was dem rechtlichen, dem sittlichen, dem politischen Menschen heilig ist, aber er zerschlägt diese Heiligen nur, um ihnen den historischen Reliquiendienst erweisen zu können“.
- Tierisches Recht: Das zentrale Zitat von Hugo, das Marx hervorhebt, lautet: „Das einzige juristische Unterscheidungsmerkmal des Menschen ist seine tierische Natur.“ Marx schließt daraus, dass das Recht für diese Schule „tierisches Recht“ sei.
- Theorie des Ancien Régime: Hugos Rechtsphilosophie wird als die „deutsche Theorie des französischen ancien regime“ charakterisiert. Sie zeichnet sich durch eine „liederliche Frivolität“ und eine „frech gegen Ideen, allerdevotest gegen Handgreiflichkeiten“ auftretende Skepsis aus.
2.3. Der „Christliche Staat“ und seine Widersprüche
Marx analysiert die offizielle Ideologie des „christlichen Staates“ und deckt ihre inneren Widersprüche auf.
- Konfusion von Religion und Politik: Der Staat gerät in eine „Konfusion des politischen und christlich-religiösen Prinzips“. Wenn er sich als lutherisch-christlich definiert, wird er für den Katholiken zu einer fremden Kirche. Definiert er sich als „allgemein christlich“, so wird er „unchristlich“, da er das Dogma als unwesentlich verwirft.
- Irreligiöse Anmaßung: Zieht man die Religion in die Politik, so ist es eine „irreligiöse Anmaßung, weltlich bestimmen zu wollen, wie die Religion innerhalb der Politik aufzutreten habe“. Wer sich aus Religiosität mit der Religion verbünden will, muss ihr in allen Fragen die entscheidende Stimme einräumen.
3. Die Entstehung der materialistischen Geschichtsauffassung in England
Die Schriften von Engels, die während seines Aufenthalts in England entstanden, sind zentral für die Entwicklung einer materialistischen Analyse der Gesellschaft. Er konzentriert sich auf die wirtschaftliche Entwicklung und soziale Struktur Englands.
3.1. Die Klassenstruktur der kapitalistischen Gesellschaft
- Drei Hauptklassen: Engels analysiert die Spaltung der Gesellschaft in die Landaristokratie, die Bourgeoisie und das Proletariat.
- Grundwiderspruch: Er kennzeichnet den Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat als den „Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft“.
- Klassenkampf: Die Auseinandersetzungen zwischen den politischen Parteien werden als Ausdruck des Klassenkampfes interpretiert.
3.2. Die industrielle Revolution und ihre Folgen
- Basis der Politik: Engels erkennt die Eigentumsverhältnisse als die Grundlage des Staates und dessen Zusammenhang mit der Wirtschaftsordnung.
- Kritik der bürgerlichen Demokratie: Er entlarvt die „Heuchelei der englischen Verfassung“ und deckt den Klassencharakter und die Begrenztheit der bürgerlichen Demokratie auf.
- Pauperismus als Systemfolge: Im Gegensatz zur preußischen Sichtweise, die Pauperismus als Verwaltungs- oder Wohltätigkeitsmangel betrachtet, zeigt die Analyse Englands, dass er eine notwendige Folge des Systems ist. Das englische Parlament selbst erklärt den Pauperismus zum „selbstverschuldeten Elend der Arbeiter“, das als Verbrechen zu bestrafen sei.
3.3. Kritik der bürgerlichen Ökonomie
Engels greift die Apologeten des kapitalistischen Systems direkt an.
- Malthus' Bevölkerungstheorie: Er prangert Malthus’ Lehre als „infame, niederträchtige Doktrin“ und „scheußliche Blasphemie gegen die Natur und Menschheit“ an. Die „überzählige Bevölkerung“ sei nicht durch Naturgesetze, sondern durch den „unbändigen Bereicherungsdrang der Bourgeoisie bedingt“.
- Die Natur der Konkurrenz: Die Konkurrenz wird als die Vollendung der „Unsittlichkeit des bisherigen Zustandes der Menschheit“ beschrieben. Sie führt zu einem steten Schwanken, Handelskrisen, Überspannung auf der einen und Erschlaffung auf der anderen Seite.
4. Die Entwicklung der revolutionären Theorie
Aus der Kritik der bestehenden Verhältnisse entwickeln Marx und Engels die Theorie einer sozialen Revolution, die vom Proletariat getragen wird.
4.1. Die Rolle des Proletariats
- Schlesischer Weberaufstand: Marx hebt die Bedeutung des Aufstandes hervor und widerspricht der Ansicht, er sei ein fruchtloser Aufruhr ohne „politische Seele“ gewesen. Er sieht darin einen Ausdruck des gewachsenen Klassenbewusstseins und des „erwachenden Verständnisses ihres grundlegenden Gegensatzes zur Gesellschaft des Privateigentums“. Der Aufstand sei theoretischer und bewusster als französische oder englische Aufstände gewesen, wie das „Weberlied“ zeige.
- Das Proletariat als universelle Klasse: Deutschland findet seine „positive Möglichkeit der Emanzipation“ in der „Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten“, dem Proletariat. Diese Sphäre kann sich nicht emanzipieren, ohne alle anderen Sphären zu emanzipieren, da sie der „völlige Verlust des Menschen“ ist und sich nur durch die „völlige Wiedergewinnung des Menschen“ selbst gewinnen kann.
4.2. Sozialismus und Kommunismus
- Frühe Haltung: Marx reagiert anfangs zurückhaltend auf den französischen Sozialismus und Kommunismus wegen ihrer „utopischen Züge“. Er wendet sich aber entschieden dagegen, ihn als Phantasterei abzutun, und fordert ein „eingehendes Studium“.
- Kritik als Ausgangspunkt: In späteren Schriften wird betont, dass die neue Richtung nicht dogmatisch die Welt antizipiert, sondern „erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden“ will. Es geht um die „rücksichtslose Kritik alles Bestehenden“.
- Notwendigkeit des Kommunismus: Engels schließt aus seinen Untersuchungen, dass eine „durchgreifende Revolution der sozialen Verhältnisse auf der Grundlage des Gemeineigentums jetzt zu einer dringenden und unvermeidlichen Notwendigkeit geworden ist“, und zwar nicht nur für eine Nation, sondern als „notwendige Folgerung, die aus den Voraussetzungen, wie sie in den allgemeinen Bedingungen der modernen Zivilisation gegeben sind, unvermeidlich gezogen werden muß“.
4.3. Die Natur der sozialen Revolution
- Politische und soziale Seite: Marx entwickelt die These, dass der Übergang zur neuen Gesellschaft eine Revolution erfordert. In dieser sind ihre politische Seite (Sturz der Macht) und ihre soziale Seite (Zerstörung der alten gesellschaftlichen Verhältnisse) untrennbar verbunden.
- Soziale Revolution mit politischer Seele: Marx kritisiert die Vorstellung einer rein politischen Revolution. Eine soziale Revolution hat den Standpunkt des Ganzen, weil sie eine „Protestation des Menschen gegen das entmenschte Leben“ ist. Eine Revolution von „politischer Seele“ dagegen organisiert nur einen neuen „herrschenden Kreis in der Gesellschaft, auf Kosten der Gesellschaft“. Der Sozialismus bedarf des politischen Aktes der Zerstörung, doch wo seine „organisierende Tätigkeit beginnt“, da „schleudert der Sozialismus die politische Hülle weg“.
Erstellt: 07.05.2014 - 17:29 | Geändert: 07.11.2025 - 00:06