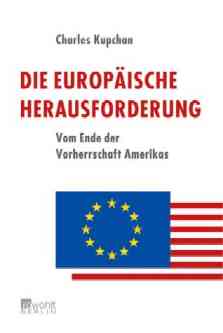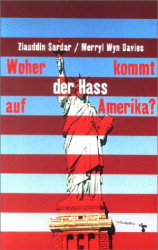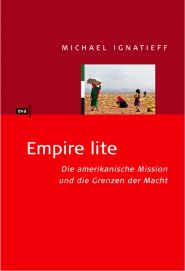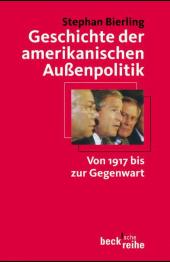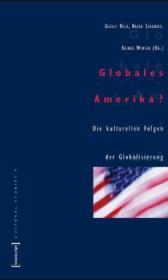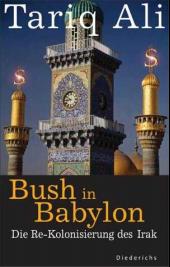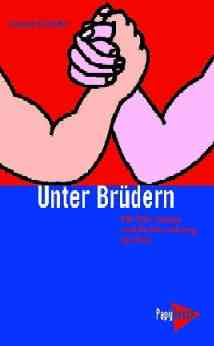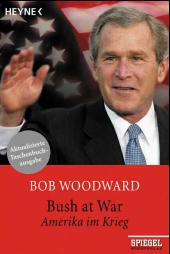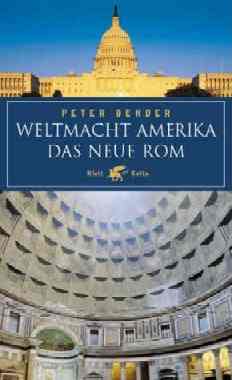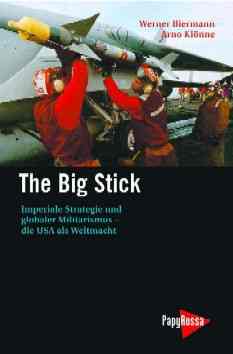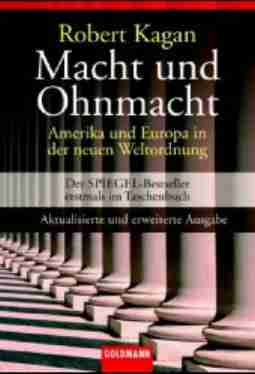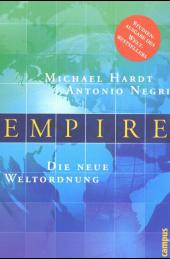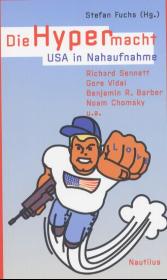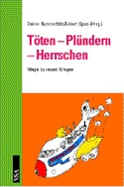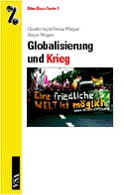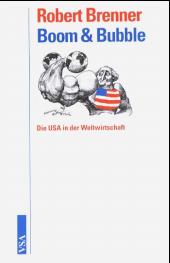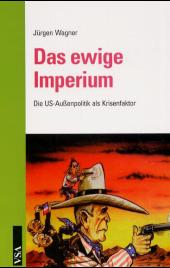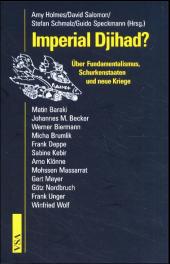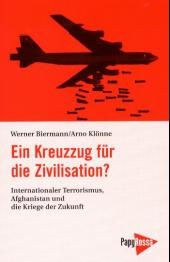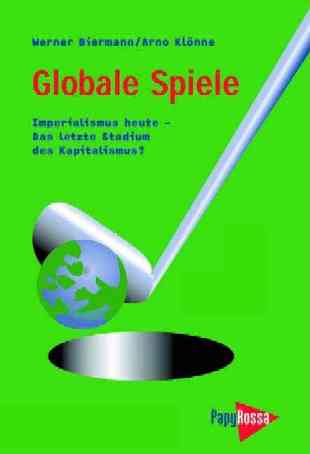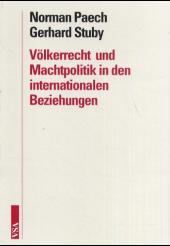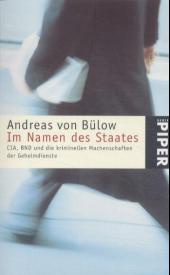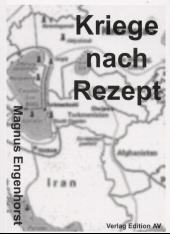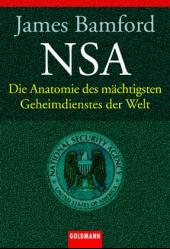|
Ältere Toptitel
(2000-2003) |
|
|
|
Charles A. Kupchan: Die europäische Herausforderung. Vom Ende der
Vorherrschaft Amerikas. Rowohlt-Verlag 2003. ISBN: 3-87134-483-4.
|
|
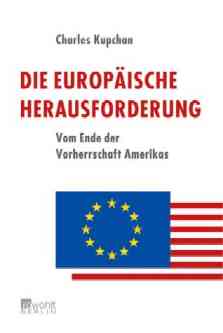
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der Krieg im Irak hat deutlich gemacht, dass die USA jederzeit
nach Gutdünken handeln werden, um ihre Interessen wahrzunehmen.
Zur Not auch gegen die Weltmeinung. Doch damit verspielen die USA
ihr kostbarstes Gut: die internationale Legitimität. Washington
hat einen Kurs eingeschlagen, der das Ende des US-amerikanischen
Zeitalters heraufbeschwört – allein Europa ist in der Lage, ein
wirksames Gegengewicht zu bilden.
"Ein packendes und provokantes Buch über die Herausforderungen,
denen die USA sich in Zukunft stellen müsse." (Henry Kissinger)
Zum Autor
Charles Kupchan ist Professor für Internationale Politik an der
Georgetown University, Washington D.C. Er war in der
Clinton-Regierung Europaexperte im Nationalen Sicherheitsrat der
USA.
Verlagsinformation |
|
|
Michael Hahn (Hrsg.): Nichts gegen Amerika.
Linker Antiamerikanismus und seine lange Geschichte.
Konkret-Literatur-Verlag 2003. ISBN: 3-89458-225-1. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Antiamerikanismus verbindet man in erster Linie mit dumpfen
rechten Ressentiments gegenüber den USA, die sich häufig als
Spätfolgen der NS-Propaganda entpuppen. Doch es gibt auch einen
linken Antiamerikanismus, der über die radikale Kritik am
kapitalistischen System und der imperialistischen Politik der USA
weit hinausgeht und seit dem Irakkrieg wieder Konjunktur hat. Auch
in linken Bewegungen tauchen immer wieder die üblichen Klischees
über Politik, Kultur und Gesellschaft der USA auf. Dazu gehören
Cowboy-Assoziationen und die Rede von der "Oberflächlichkeit"
ebenso wie der Vorwurf, die Bush-Regierung folge nur materiellen –
oder, wahlweise, missionarischen – Interessen. In den sechziger
Jahren lauteten die Schlagworte "USA-SA-SS", heute "Bush gleich
Hitler".
Einige dieser Ressentiments reichen zurück bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts. Häufig handelt es sich dabei um Projektionen, die
weitaus mehr über ihre Urheber aussagen als über ihr Objekt – die
USA. Antikapitalismus gerinnt in seiner Vereinfachung zu
Antiamerikanismus. Der Sammelband untersucht das Verhältnis
deutscher Linker zu den USA: Parteikommunisten und RAF-Aktivisten,
Achtundsechziger und Hip-Hopper,
Friedensbewegte und Globalisierungskritiker und soll zu einer
nicht-antiamerikanischen Kritik an den USA beitragen. Mit
Beiträgen von Bernhard Schmid, Christian Storz, Frank Illing,
Oliver Tolmein.
Rezension
"Für Michael Hahn gibt es eine Prämisse bei der Kritik des linken
Antiamerikanismus, die von vielen 'Anti-Amerikanern' gerade nicht
geteilt wird: 'Eine linke Kritik an der US-Außenpolitik und an den
gesellschaftlichen Verhältnissen in der kapitalistischen
Führungsmacht ist berechtigt und notwendig.' Nur wie wird
Antiamerikanismus definiert? Michael Hahn untersucht die
Brauchbarkeit diverser Ansätze, von Dan Diner, Gesine Schwan,
Günter Moltmann, Wolfgang Pohrt bis hin zu dem 'pro-westlichen'
ZEIT-Redakteur Richard Herzinger oder Hannes Stein, 'mittlerweile
bei der WELT und den Berliner Antideutschen gelandet', und der
antideutschen Gruppe 'Les Croquembouches'. Aus dieser Untersuchung
formuliert Michael Hahn seine Arbeitshypothese: 'Linker
Antiamerikanismus will einen bestimmten Nationalstaat (die USA)
für das Elend verantwortlich machen, das der Kapitalismus als
gesamtgesellschaftliches – und weltweites – Verhältnis anrichtet.'
... Das Hauptanliegen dieses Buches ist es, (selbst-)kritischer
auf antiamerikanische Stereotypen zu achten, um nicht zum
Steigbügelhalter eines sich formierenden europäischen Machtblocks
zu werden." (analyse + kritik)
Zum Herausgeber
Michael Hahn, geboren 1961, hat mehrere Jahre in
den USA gelebt und arbeitet als Journalist in Tübingen. Über
US-Politik schreibt er unter anderem für KONKRET, "jungle world"
sowie "analyse und kritik".
Verlagsinformation |
|
|
Ziauddin Sardar/Meryl
Wyn Davies: Woher kommt der Haß auf
Amerika? Zu Klampen-Verlag 2003. ISBN:
3-934920-28-4. |
|
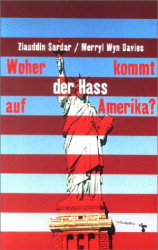
mehr Infos
bestellen |
Wir dürfen, so tönt es spätestens seit dem
Angriff der USA auf den Irak von überall her, nicht in
Amerikafeindlichkeit verfallen. Auch der artigste Appell aber
schafft die Tatsachen nicht aus der Welt. Und Tatsache ist, dass
viele Menschen Amerika hassen: nicht nur im Nahen Osten, sondern
auch in den Entwicklungsländern und Europa.
Speist sich der allgegenwärtige Hass auf
Amerika nur aus dem Ressentiment der Dummen, Unfähigen und
Zurückgebliebenen dieser Welt? Oder wird er durch die ungezügelte
Dominanz der ersten Hypermacht der Geschichte geradezu
herausgefordert? Sardar und Davies untersuchen die globalen
Auswirkungen der militärgestützten Außenpolitik, der neoliberalen
Wirtschaftsmacht und der populärkulturellen Hegemonie der USA. Sie
kontrastieren diese Auswirkungen mit dem US-amerikanischen
Selbstbild.
Deutschland hat den Vereinigten Staaten von Amerika viel zu
verdanken. Nicht nur die Befreiung vom Faschismus, sondern auch
eine stabile Demokratie, Rechtsstaat und Wohlstand. Dennoch müssen
die dramatischen Auswirkungen der amerikanischen Hegemonie auch in
Deutschland reflektiert werden. Der Band "Woher
kommt der Hass auf Amerika?"
trägt mit seiner nüchternen Analyse dazu bei, dass der Hass nicht angestachelt wird, sondern
dass es zu einem Verständigungsprozess
zwischen den Völkern kommt –
der Bedingung für einen vernünftigen Interessenausgleich.
Verlagsinformation |
| |
|
Michael
Ignatieff: Empire lite. Die amerikanische Mission und die
Grenzen der Macht. Europäische Verlagsanstalt 2003. ISBN:
3-434-50567-9. |
|
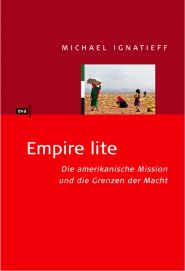
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was kommt nach dem Krieg? Wie lange dauert Demokratisierung?
"Imperialismus, der in Ländern, die von Bürgerkriegen
zerrissen sind, eingreift und diesen die Rückkehr zu Normalität
und Selbstbestimmung ermöglicht, ist für mich guter Imperialismus.
[...] Das Imperium des 21. Jahrhunderts ist ein Neuankömmling in
den Annalen der politischen Wissenschaft. Es ist ein Empire lite –
eine globale Hegemonie, deren Merkmale freie Märkte,
Menschenrechte und Demokratie sind, durchgesetzt mit Hilfe der
abschreckendsten Militärmacht, die es jemals gegeben hat. Es ist
der Imperialismus eines Volkes, dem immer vor Augen steht, dass es
die Unabhängigkeit seines Landes erwarb, indem es gegen ein Empire
revoltierte, eines Volkes, das sich als Freund der Freiheit in
aller Welt versteht. Es ist ein Empire, das sich nicht als solches
begreift – und das wieder und wieder erschüttert darüber ist, dass
seine guten Absichten andernorts auf Abwehr stoßen."
Seit den 80er
Jahren verfolgt Ignatieff das Schicksal zerfallender Staaten im
ehemaligen Jugoslawien und nun in Afghanistan. Seine
Fronterfahrungen
in Gebieten, wo Warlords das Sagen haben,
wo Hilfsorganisationen und Blauhelme im Ernstfall kapitulieren
müssen, ist ernüchternd: Ja, es braucht eine machtvolle
Drohkulisse. Doch wer, wie die USA, meint, mit einigen gezielten
Luftschlägen lasse sich die Demokratie herbeibomben, macht es sich
zu leicht. Zum nationalen Wiederaufbau, zur "Befreiung
der Völker" von Tyrannen und Bürgerkrieg gehört ungleich
mehr: eine stabile Regierung, Gesetze und Ordnung, die auch in den
Provinzen beachtet werden. Die USA wollen heute Demokratie und
Wohlstand verbreiten. Michael Ignatieff fragt: Sind sie für einen
weichen Imperialismus der Selbstbestimmung tatsächlich
vorbereitet?
Rezensionen
"Ein intellektuelles Vergnügen" (DIE ZEIT)
"Ignatieff erweist sich als engagierter Zeitgenosse."
(Frankfurter Rundschau)
Zum Autor
Michael Ignatieff, 1947 in Toronto/Kanada
geboren, ist Historiker und Philosoph
lebt heute in London. Nach einigen Jahren Forschungstätigkeit
als Historiker am King's College in Cambridge/Großbritannien
widmete er sich in den letzten Jahren mit großem Erfolg sowohl dem
Roman als auch der politischen Reportage. Durch zahlreiche
Arbeiten für die BBC und das kanadische Fernsehen sowie eine
eigene Talkshow ist er mittlerweile ein international gefragter
Journalist und politischer Kommentator.
Seit 2000 ist er Professor für Menschenrechtspolitik in Harvard, 2003 erhielt er den
Hannah-Arendt-Preis. Mehrere
Buchveröffentlichungen, darunter "Virtueller
Krieg" (dt. Ausgabe: 2001) und "Die
Politik der Menschenrechte" (dt. Ausgabe: 2002).
Verlagsinformation |
|
|
Stephan G. Bierling: Geschichte der
amerikanischen Außenpolitik. Von 1917
bis zur Gegenwart. C.H. Beck-Verlag 2003.
ISBN: 3-406-49428-5. |
|
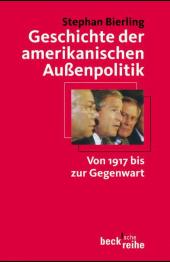
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Keine
Macht hat die internationale Politik seit 1917 stärker geprägt
als die Vereinigten Staaten von Amerika. Ihre Initiativen und
Leistungen, aber auch ihre Fehler und Versäumnisse beeinflussen
das Schicksal fast aller Nationen dieser Erde.
Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die Vereinigten
Staaten von Amerika die einzig verbliebene Supermacht. Diese
einzigartige Stellung, die es ihnen heute erlaubt, ihre Macht
praktisch in jedem Winkel der Erde geltend zu machen, ist das
Resultat einer historischen Entwicklung, die sich durch das ganze
20. Jahrhundert hindurchzieht.
Stephan Bierling
bietet in seinem Buch
eine fundierte Darstellung der
US-Außenpolitik vom Ersten Weltkrieg bis
zur Gegenwart. Dabei werden auch die
weltanschaulichen und institutionellen Grundlagen der
US-Außenpolitik in den Blick genommen: Bierling stellt die
wichtigsten Konzepte und Akteure der US-Außenpolitik vor. Ein
besonderer Vorzug seiner ausgewogenen Darstellung liegt in der
genauen Beschreibung
der
komplexen Mechanismen
des außenpolitischen Entscheidungsprozesses,
dessen Grundlagen in einem einführenden Kapitel
erläutert
werden.
Gerade in der nach den Terroranschlägen des 11. September 2001
veränderten Weltlage ist diese kritische,
fundierte Analyse
eine wichtige Hilfe zum besseren Verständnis der US-amerikanischen
Außenpolitik.
Zum Autor
Stephan Bierling ist Professor für Internationale und
Transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Er
hat zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen und
US-amerikanischen Außenpolitik vorgelegt.
Verlagsinformation |
| |
|
Ulrich Beck/Natan Sznaider/Rainer
Winter (Hrsg.): Globales Amerika? Die kulturellen Folgen der
Globalisierung. Cultural Studies Vol. 4. Transcript-Verlag 2003.
ISBN: 3-89942-172-8. |
|
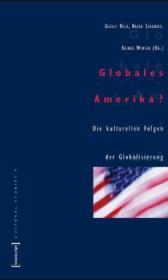
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Seit einigen Jahren wird in den Sozial- und Kulturwissenschaften
international kaum ein Phänomen so lebhaft diskutiert wie das der
Globalisierung. Nachdem die zu Anfang vorherrschende Sichtweise
von Globalisierung als Entwicklung einer homogenen Weltkultur
zunehmend an Evidenz verlor, rücken die lokal unterschiedlichen
kulturellen Praktiken und Perspektiven als Teil von Globalisierung
ins Zentrum des Interesses. Diese Neujustierung des Fokus erlaubt
auch längst überfällige neue Lesarten des vermeintlich einfachen
Verhältnisses von "Amerikanisierung" und Globalisierung.
Dabei wird deutlich, dass die oft als "Amerikanisierung"
wahrgenommene Globalisierung weltweit heterogene Resonanzen
erzeugt, hybride Kulturen, Fluchtlinien und Gegenbewegungen treten
gleichermaßen hervor. Der Band "Globales Amerika?", in dem sich
einige der prominentesten Denker der Globalisierung zu Wort
melden, präsentiert anregende Lektüren dieser bislang wenig
beleuchteten Seite der Globalisierung und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zum Verständnis des Problems insgesamt. Für das
21. Jahrhundert erweist sich die Perspektive eines
"methodologischen Kosmopolitismus" (Ulrich Beck) als
richtungweisend.
Zu den Herausgebern
Ulrich Beck ist Professor für Soziologie an der Universität
München und Visiting Centennial Professor an der London School of
Economics and Political Science.
Natan Sznaider lehrt Soziologie am Academic College in Tel-Aviv.
Rainer Winter ist Professor für Medientheorie und Cultural Studies
sowie Direktor des Instituts für Medien und Kommunikationsstudien
an der Universität Klagenfurt.
Verlagsinformation |
| |
|
Tariq Ali: Bush in
Babylon. Die Re-Kolonisierung des Irak.
Diederichs-Verlag 2003. ISBN: 3-7205-2480-9. |
|
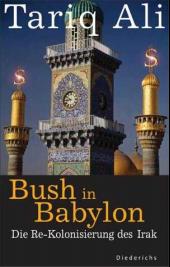
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die Iraker haben die Geschichte ihres Landes als Spielball
der Weltreiche nicht vergessen und ordnen sich den neuen Besatzern
nicht widerstandslos als Kolonie unter. In diesem Buch beschreibt
der Autor und politische Publizist Tariq Ali die Geschichte des
irakischen Widerstandes gegen alte und neue Kolonisatoren.
Vehement widerspricht Ali der Ansicht, eine Besetzung sei der
einzige Weg zu einem Regimewechsel in einem korrupten oder
diktatorischen Staat, und belegt, welch verhängnisvollen Einfluss
die Interventionen der Weltreiche in der Geschichte des Landes
bislang hatten. Alis Buch ist eine provokante Streitschrift gegen
den Krieg als Mittel der Politik, eine faszinierende Darstellung
der Politik und Kultur des Irak – und eine Hommage an die Menschen
im Irak und an die unbeugsamen Dichter und Denker der arabischen
Welt.
Zum Autor
Tariq Ali wurde 1943 in Lahore (Pakistan) geboren. Als
20-Jähriger emigrierte er nach London, wo er Politik und
Philosophie studierte und Ende der sechziger Jahre zu einem der
wichtigsten Führer und Vordenker der internationalen
Studentenbewegung wurde. Heute arbeitet Tariq Ali als Schriftsteller,
Filmemacher und Journalist. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher
zur Weltgeschichte und -politik, Bühnenstücke, Drehbücher und
Romane.
Verlagsinformation |
| |
|
Conrad Schuhler: Unter Brüdern. Die USA, Europa und die Neuordnung der Welt. PapyRossa-Verlag
2003. ISBN: 3-89438-268-6. |
|
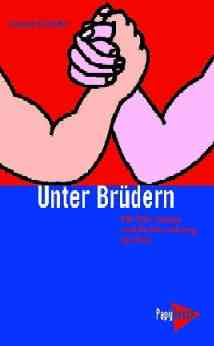
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die Wogen schlugen hoch, als sich nicht nur Russland
und China, sondern auch Deutschland und Frankreich gegen den
Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf den Irak wandten. Dies
war zugleich eine Absage an den Anspruch Washingtons, nach eigenem
Gutdünken, ohne Rücksicht auf das Völkerrecht und wo auch immer
präventiv zuzuschlagen und die Welt mithilfe des lang
dauernden Krieges gegen den Terror militärisch unter
Kuratel zu stellen. Die Aufregung hat sich vorerst gelegt, doch
der Konflikt schwelt weiter. Was liegt ihm zugrunde und woraus
speist sich die sichtbar gewordene Rivalität? Wer verfolgt dabei
welche Absichten, Ziele und Interessen? Welche Rolle spielt die
Bundesrepublik und was ist die Friedensliebe der rotgrünen
Bundesregierung wert? Muss Europa
aufrüsten, um mit den USA mithalten zu können? Um welches Europa
geht es überhaupt? Wie könnte der viel
beschworene eigenständige europäische Weg aussehen?
Zum Autor
Conrad Schuhler, geboren 1940,
ist Diplom-Volkswirt. Sein
Studium absolvierte er an den Universitäten München,
Manchester/GB, Yale/USA
und Berkeley/USA. Momentan
ist er tätig als Mitarbeiter beim Institut für
sozial-ökologische Wirtschaftsforschung (ISW) in München. Schuhler
schreibt u.a. für die Süddeutsche Zeitung,
DIE ZEIT, GEO und Konkret.
Verlagsinformation |
| |
|
Bob Woodward: Bush at War. Amerika
im Krieg. Zusammen mit Mark Malseed. Heyne-Verlag
2003. ISBN: 3-453-87447-1. |
|
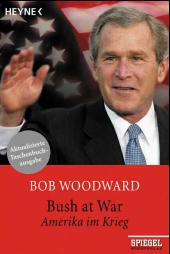
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Am
11.09. lenken Terroristen Flugzeuge in das World Trade Center und
das Pentagon. Dieser Anschlag trifft die Regierung Bush weitgehend
unvorbereitet. Noch am selben Abend tritt der Nationale
Sicherheitsrat, ein kleiner Kreis von Regierungs-, CIA- und
Militärangehörigen, im Bunker des Weißen Hauses zusammen, um
über das weitere Vorgehen zu beraten. Bush sieht das Land im
Krieg gegen den Terror, der außergewöhnliche Maßnahmen
erfordert.
Wenig später gibt er den Befehl, in Afghanistan gegen Bin Laden,
al-Qaida und die Taliban vorzugehen, und auch ein Angriff auf
Saddam Hussein wird im Kriegskabinett immer wieder erwogen. Aus
den Protokollen des Nationalen Sicherheitsrats, Aufzeichnungen und
zahlreichen Gesprächen mit Beteiligten, darunter Präsident Bush,
rekonstruiert Bob Woodward die dramatischen Ereignisse seit dem
11. September. Dabei gibt der Star-Reporter ein ungewöhnlich
intimes Bild der prominenten Berater und Mitarbeiter des
Präsidenten und zeigt, wie die Mächtigen in Washington in der
Krise zu Entscheidungen über den Krieg finden.
Bob Woodward, einer der beiden Watergate-Journalisten und
Pulitzer-Preisträger, zeichnet ein dramatisches Bild der
Krisenstäbe, der Entscheidungen über internationale Allianzen,
Waffeneinsätze und Bombardierungen. Die Öffentlichkeit erfährt
hier zum ersten Mal von den persönlichen Eitelkeiten, Antipathien
und Grabenkämpfen der amerikanischen Entscheidungsträger.
Rezensionen
"Wer Woodward gelesen hat, wird glauben, bei Bush und den Seinen
dabei gewesen zu sein." (DIE ZEIT)
"Um zu verstehen, wie die Bush-Administration ihre weltpolitische
Bedeutung und ihre geopolitischen Möglichkeiten einschätzt, ist
das Buch von fundamentaler Wichtigkeit." (Süddeutsche
Zeitung)
"Woodward gelang ein Coup: Er konnte die Sitzungsprotokolle des
Nationalen Sicherheitsrats an Land ziehen. Aus ihnen ergab sich
die einzigartige Perspektive seines Buches." (SPIEGEL)
Klappentext
Zum Autor
Bob Woodward, geboren 1943 in
Geneva/Illinois, zählt zu den einflussreichsten investigativen
Journalisten der Welt. 1974 deckten er und Carl Bernstein als
Reporter der Washington Post den Watergate-Skandal auf. Heute
ist Woodward
leitender Redakteur dieser Zeitung. Zahlreiche
Buchveröffentlichungen zur amerikanischen Innenpolitik,
Auszeichnung mit dem Pulitzer-Preis.
Mark Malseed, der sein Architekturstudium an der
Lehigh-Universität in Bethlehem/Pennsylvania 1997 mit Auszeichnung abschloss, war Bob
Woodward ab Mai 2002 bei der Erstellung dieses Buchs in allen
Phasen als Vollzeitassistent behilflich. "Jeder Tag, an dem ich
mit Mark arbeitete, war mir eine Freude. Dieses Buch ist ein
Gemeinschaftswerk, an dem er gleichen Anteil hat wie ich." (Bob
Woodward)
Weitere Informationen:
Project for a new
american century |
|
|
Peter
Bender: Weltmacht Amerika – Das Neue Rom. Klett-Cotta-Verlag 2003.
ISBN: 3-608-96002-3. |
|
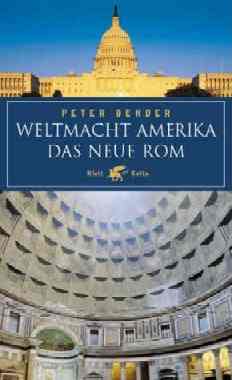
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Politisch und strategisch waren Italien und Nordamerika Inseln, auf denen Römer und Amerikaner eine ungeheure Macht ansammelten. Innerhalb von 75 Jahren
(264–190 v. Chr. und 1917–1991) wurden beide in Kriegen, in die sie teilweise ungewollt gerieten, zu den beherrschenden Mächten der Welt ihrer Zeit. Neben gewaltigen Unterschieden beobachtet der Autor erstaunliche Ähnlichkeiten.
Sind die US-Amerikaner die Römer unserer Zeit? Peter Bender spekuliert nicht, sondern befragt die Geschichte vom Altertum bis ins Jahr 2003. Römer und Amerikaner wuchsen auf ihren »Inseln« Italien und Nordamerika zu militärischer oder wirtschaftlicher Macht, die sie stärker machte als alle anderen Staaten. Da die Meere sie nicht mehr zu schützen schienen, wurden sie expansiv in defensiver Absicht und fanden sich schließlich in Regionen und Positionen wieder, die sie nicht angestrebt hatten. Aus ihrer Sicherheitspolitik wurde Machtpolitik, die sie zu den einzigen Weltmächten ihrer Zeit werden ließ. Was dann weiter kam, liegt bei Rom zutage: Die aristokratische Republik verwandelte sich in ein monarchisch regiertes Imperium. Die USA diskutieren und müssen entscheiden: Wollen sie – wie Rom – ein Empire schaffen? Werden sie angesichts großer Herausforderungen die Demokratie gefährden? Werden wir Europäer zu Vasallen einer einzigen Macht?
Ein grundlegendes, klug geschriebenes Buch zu einer Gefahr, die uns noch auf Jahre beschäftigen wird.
"Peter Bender stellt künftigen Jahrzehnten die Frage, was es heißen wird, unter der Hegemonie
'einer' Macht zu leben."
(Ivan Nagel, Literaturen)
Zum Autor
Peter Bender, geboren 1923 in Berlin. Dr. phil. in Alter
Geschichte, seit 1954 Journalist. 1961 bis 1970 Redakteur und Kommentator beim WDR, 1970 bis 1988
Berlin-Korrespondent des WDR. 1973 bis 1975 ARD-Korrespondent (Hörfunk) in Warschau. Seit 1963 Autor der ZEIT, seit 1966 des MERKUR. 1968/69 Senior Assistant beim International Institute for Strategic Studies (IISS). Wichtige Publikationen:
"Das Ende des ideologischen Zeitalters" (1981), "Episode oder Epoche? Zur Geschichte des geteilten Deutschland" (1996).
Verlagsinformation
|
|
|
Joseph
S. Nye: Das Paradox der amerikanischen Macht. Warum die
einzige Supermacht der Welt Verbündete braucht. Europäische
Verlagsanstalt 2003. ISBN: 3-434-50552-0. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Am
Beginn des 21. Jahrhunderts ist Amerika scheinbar zu stark
geworden, um von einer anderen Macht wirksam herausgefordert
werden zu können. In Washington brüstet man sich mit Unipolarität
und Hegemonie, tatsächlich aber haben die Gewichte sich
verschoben: die Supermacht sieht sich nicht nur mit globalen
Problemen konfrontiert, sondern auch potentiellen Herausforderern
wie China, Russland, Indien und
Europa.
So komplex ist die Frage der Machtverteilung und der
Interessengegensätze, dass Amerika allein das Gleichgewicht nicht
garantieren kann. Die amerikanische Vorherrschaft – so Nye –
wird nicht nur auf militärischer und ökonomischer Stärke
beruhen, sondern braucht die "Soft
Power" von Kultur und Werten, nämlich Glaubwürdigkeit,
moralische Autorität und Achtung gegenüber Geschichte und
Tradition – ihrer eigenen und der anderer Völker. Anders
ausgedrückt: die Supermacht muss kooperieren, andernfalls wird sie
– paradoxerweise –
unterliegen.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
Die "neue Weltgewaltkriegsordnung" wird in Washington D.C.
entschieden
(Telepolis, 04.05.2003)
|
|
|
Werner
Biermann/Arno Klönne: The Big Stick. Imperiale Strategie und
globaler Militarismus – die USA als Weltmacht. PapyRossa-Verlagsgesellschaft 2003.
ISBN: 3-89438-256-2. |
|
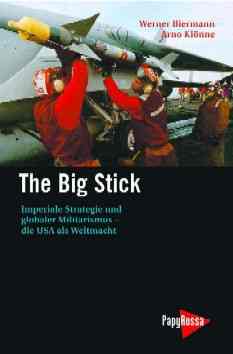
mehr
Infos
bestellen
|
Auf welche Ressourcen stützt sich die kriegerische Schlagkraft der
USA
–
und wo liegen ihre inneren Schwächen? Werner Biermann/Arno Klönne informieren über die Struktur der US-Streitkräfte, über
deren Personal, Einsatzfelder und strategische Konzepte. Sie geben
Einblick in Geschichte und Geographie militärischer
US-Interventionen, zeichnen die Verflechtung von militärischen und
wirtschaftlichen Interessen nach und fragen, welche Resultate die
gewaltförmigen Eingriffe der Vereinigten Staaten in die globale
Entwicklung zeitigen.
Biermann/Klönne setzen sich auch mit dem weltweiten "Gewaltmarkt"
auseinander, den Verbindungen zwischen öffentlichen und privaten
militärischen Systemen. "The Big Stick"
legt offen, welche
dramatischen Konsequenzen die derzeit herrschende "Enttabuisierung
des Militärischen" hat, hegemonial betrieben von der
US-amerikanischen Regierungspolitik
–
und nachvollzogen von deren
konkurrierenden Mitspielern.
Verlagsinformation
|
|
|
Robert
Kagan: Macht und Ohnmacht. Amerika gegen Europa in der neuen
Weltordnung. Goldmann-Verlag 2004 (Aktualisierte und erweiterte
Ausgabe). ISBN: 3-442-15276-3. |
|
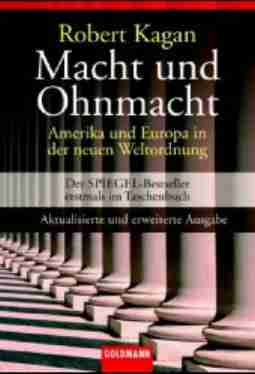
mehr Infos
bestellen
|
Europäische
Politiker, die von der globalen Strategie der USA zunehmend
irritiert sind, glauben, dass die USA und Europa auf einen "Moment
der Wahrheit" (New
York Times) zusteuern. Nach Jahren wechselseitigen Ressentiments
und zunehmender Spannung ist die Erkenntnis unausweichlich, dass
die realen Interessen Amerikas und Europas längst nicht mehr
identisch sind und dass die Beziehung zwischen den USA und den
Staaten Europas, besonders Deutschland, sich verändert hat -
vielleicht unwiderruflich. Europa sieht die Vereinigten Staaten
als arrogant, kriegerisch, undiplomatisch; die Vereinigten Staaten
betrachten Europa als erschöpft, unernst und schwach. Der Ärger
und das Misstrauen auf beiden Seiten verhärten sich und führen
zu Entfremdung und Unverständnis.
Schon mit seinem Artikel in der Policy Review und nun mit seinem
Buch unternimmt Robert Kagan den Versuch, die Standpunkte beider
Seiten zu verstehen und darzulegen. Er verfolgt die
unterschiedlichen historischen Entwicklungen von Amerika und
Europa seit dem Zweiten Weltkrieg: Für Europa stand die
Notwendigkeit, der blutigen Vergangenheit zu entkommen und der
Gewalt zu entsagen, im Vordergrund, während die USA sich
zunehmend als einzige Garantiemacht einer demokratischen
Weltordnung sehen. Diese
bemerkenswerte Analyse wird in Washington und Berlin ebenso
diskutiert wie in Tokio. Kagans Buch ist politische Pflichtlektüre.
"Wie immer
man auch zu dieser Perspektive steht
–
in diesem intelligenten, bestechend klaren Essay findet sich
jedenfalls jene neokonservative Herausforderung konzentriert, auf
die Europa eine Antwort finden muss." (Frankfurter Rundschau)
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
Die "neue Weltgewaltkriegsordnung" wird in Washington D.C.
entschieden
(Telepolis, 04.05.2003) |
|
|
Michael
Hardt/Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung.
Campus-Verlag 2003 (Durchgesehene Studienausgabe). ISBN:
3-593-37230-4. |
|
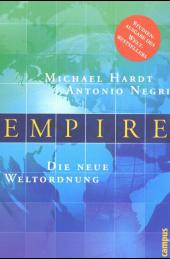
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Nach einem
Vierteljahrhundert politischer Theoriemüdigkeit haben Hardt und
Negri mit ihrer brillanten, provokanten und heiß diskutierten
Analyse des postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der
Globalisierung das Denken wieder in Bewegung gebracht. Der
Hoffnung auf die politische Gestaltbarkeit einer neuen,
gerechteren Weltordnung haben sie damit ein anspruchsvolles
theoretisches Fundament gegeben. Die nun erschienene, günstige
Studienausgabe des Buches macht Empire auch für den kleineren
Geldbeutel interessant.
Zu den Autoren
Antonio Negri
war Professor für Philosophie in Padua und Paris und Abgeordneter
im italienischen Parlament. Er ist seit den sechziger Jahren einer
der führenden Theoretiker der italienischen Linken und lebt heute
in Rom.
Michael Hardt
ist Professor für Literaturwissenschaft an der Duke University
Durham.
Verlagsinformation
Rezensionen
"Die
Autoren wollen nichts weniger als Marx' Erzählung der
Weltgeschichte fortsetzen und auf den neuesten Stand ... bringen.
Das ist ihnen so gut gelungen, dass es auch einen überzeugten
Nichtmarxisten ... erfreut, zumal der Versuch handwerklich
hervorragend gearbeitet ist." (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
"Empire (ist) eine grandiose Gesellschaftsanalyse ..., die
unser Unbehagen bündelt und ihm eine Richtung gibt, für die in
der Geschichte
der Philosophie das Wort vom 'guten Leben' steht." (DIE ZEIT)
"Das Jahrzehnt linker Melancholie ist vorüber." (NZZ)
"The next big theory. Empire füllt eine Lücke in den
Humanwissenschaften." (New York Times)
"... ein probates Mittel gegen die neoliberale Depression
..." (literaturen)
"Empire bringt die Geschichte der humanistischen Philosophie,
des Marxismus und der Moderne in einem großartigen politischen
Entwurf zusammen." (The Observer)
-
Empire: die neue Weltordnung oder der alte Imperialismus? Eine
Rezension
(Conne Island, Leipzig)
-
Ein Reich komme
(jungle world Nr. 37/2002 vom 04.09.2002)
-
Multitude, rüste dich! (jungle world Nr. 33/2002 vom
07.08.2002)
-
Klassenkampf der Engel (jungle world Nr. 25/2002 vom
12.06.2002)
-
Mehr von der Welt (jungle world Nr. 19/2002 vom 30.04.2002)
-
Hier kommt der Masterplan (jungle world Nr. 13/2002 vom
20.03.2002)
Weitere Informationen
-
Leseprobe
aus dem 1. Kapitel (Campus-Verlag)
-
"Empire"
oder "American Empire" oder...: Weiterführende
Links (Rosa-Luxemburg-Stiftung)
- Kritische Bücher zu "Empire":
Kritik der Weltordnung (2003) /
"Empire" – linkes Ticket für die Reise nach rechts (2003) |
|
|
Robert
Kurz: Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränität und die
Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung.
Horlemann-Verlag 2003. ISBN: 3-89502-149-0. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der
Kampf um die kapitalistische Weltherrschaft ist längst
entschieden. Unter dem Dach der Pax Americana hat sich seit dem
Zweiten Weltkrieg ein neues, nach dem Untergang des östlichen
Staatskapitalismus vereinheitlichtes Weltsystem entwickelt. Die
betriebswirtschaftliche Globalisierung macht den alten
national-imperialen Kampf um territoriale Einflusszonen
gegenstandslos. Auf der Ebene staatlicher Gewalt bildet die
Militärmaschine der letzten Weltmacht USA den konkurrenzlosen und
uneinholbaren Garanten dieser herrschenden planetarischen Ordnung.
Aber durch den Quantensprung der dritten industriellen Revolution
wird gleichzeitig die Mehrzahl der Menschheit außer Kurs gesetzt;
eine Weltregion nach der anderen erweist sich als kapitalistisch
reproduktionsunfähig. Wie ein Schatten folgt der Globalisierung
des Kapitals ein Prozess sozialer Zerrüttung, moralischer
Verwilderung und gesellschaftlicher Paranoia, der in eine
substaatliche Terror- und Plünderungsökonomie mündet. Diese
anwachsende Systemkrise wird von den westlichen Funktionseliten
stur geleugnet. An die Stelle des einstigen Machtkampfs zwischen
Nationalstaaten tritt der perspektivlose Weltordnungskrieg des in
der NATO vereinigten "ideellen Gesamtimperialismus"
gegen seine eigenen Krisengespenster in der Gestalt von
Schurkenstaaten, Gotteskriegern und Ethnobanditen. Dieser Krieg
wird verloren in demselben Maße, wie die gesellschaftliche
Zersetzung auch in den westlichen Zentren selbst fortschreitet und
das Gesamtsystem an seinen inneren Widersprüchen erstickt.
Zum Autor
Robert Kurz, 1943 geboren, lebt als
freier Publizist, Journalist und Referent im Kultur- und
Wirtschaftsbereich in Nürnberg. Er ist Mitherausgeber der
gesellschaftskritischen Theoriezeitschrift 'Krisis'.
Weitere Buchveröffentlichung: "Die
antideutsche Ideologie" (2004).
Verlagsinformation
Weitere
Informationen:
-
Robert Kurz: Irakinvasion
– der Krieg gegen die Krise (Folha de Sao Paulo Nr. 97, November 2002)
-
Robert Kurz: Ein Schisma des Westens? Der Irakkrieg und die
Struktur der imperialen Macht (Folha de Sao Paulo Nr. 83)
-
Ernst Lohoff: Bomben aus tausend und einer Nacht (Krisis-Texte) |
|
|
Stefan Fuchs (Hrsg.): Die Hypermacht: USA in Nahaufnahme.
Mit Beiträgen von
Richard Sennett, Gore Vidal, Benjamin R. Barber, Noam Chomsky u.a.
Verlag Edition Nautilus 2003. ISBN: 3-89401-412-1. |
|
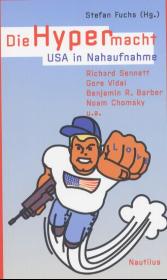
mehr Infos
bestellen
|
"Wenn ich die amerikanische Kultur auf
einen Begriff bringen sollte, würde ich sagen, es ist der Begriff
der Leere! Die Angst vor der Leere …"
(Richard Sennett)
"Von den USA lernen, heißt siegen
lernen!":
Das glatte Credo aller überzeugten Transatlantiker birgt einen
tieferen Sinn. Tatsächlich sind die USA uns Europäern voraus.
Jenseits des Atlantiks findet sich eine Art Labor, in dem eine
Lebens- und Gesellschaftsform getestet wird, die trotz
fortgeschrittener Globalisierung für den alten Kontinent immer
noch Zukunft ist. Die USA experimentieren mit einer zukünftigen
Kultur universeller Verfügung. Verfügung über sich, über
andere. Verfügung über Sprache, über Natur. Der ungezügelte
Drang nach Steigerung der Macht über Waren, Geld, Bilder,
Körper, über den Tod selbst bildet die Triebfeder der US-Kultur
und garantiert zugleich ihre Universalität. Nur wer in diese
Tiefenzonen des amerikanischen Selbstverständnisses vordringt,
begreift, was die Rede vom "Modell"
Amerika wirklich bedeutet und erahnt die Dimensionen der
traumatischen Erfahrung des 11. September als "Pearl
Harbour der industriellen Zivilisation".
Stefan Fuchs hat markante Fragen gestellt an Richard Sennett, Gore
Vidal, Noam Chomsky, Benjamin R. Barber, Joshua Meyrowitz, Thomas
Frank, Morris Berman, Dan Clawson, Eduardo Lourenco.
"Die politischen, wirtschaftlichen,
geostrategischen und kulturellen Interessen der Vereinigten
Staaten erstrecken sich rund um den Erdball und erreichen im
Hinblick auf die Totalität der hegemonialen Ansprüche zweifellos
eine neue Dimension. Unter diesen Umständen kann es dem Rest der
Welt nicht schaden, einen Blick hinter die Kulissen der
'Hypermacht' zu werfen. Eben den gewährt Stefan Fuchs’ absolut
lesenswerte Zusammenstellung von neuen Interviews."
(Thorsten Stegemann, Telepolis, 26.02.2003)
"Weil notwendige und gerechtfertigte Kritik
an der US-Politik und plumper Anti-Amerikanismus oft dicht
beieinander liegen, kommt die Interviewsammlung 'Die
Hypermacht' zur richtigen Zeit."
(Martin Büsser, junge Welt, 20.03.2003)
Verlagsinformation |
|
|
Rainer
Butenschön/Eckart Spoo (Hrsg.): Töten – Plündern –
Herrschen. Wege zu neuen Kriegen. VSA-Verlag 2003. ISBN:
3-89965-010-7. |
|
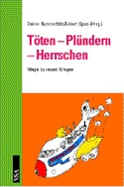
mehr
Infos
bestellen
|
Das
Buch dokumentiert unterschiedliche konzeptionelle Zugänge zu den
ökonomischen, militärischen und ethnischen Konfliktpotenzialen
der Globalisierung. Die Folgen des 11. September, der weiterhin
propagierte "Krieg gegen den Terror", die imperiale
Rolle der USA, ihre Kriegsdrohung gegen den Irak, die Aushöhlung
des internationalen Völkerrechts – all dies erfordert
differenzierte Analysen dieser "neuen Welt(un)ordnung".
Auch die Friedensbewegung muss sich diesen neuen Herausforderungen
und Fragenkomplexen stellen. Die AutorInnen dieses Buches
analysieren sie unter folgenden Aspekten:
– außenpolitische Konstellationen der neuen Weltordnung.
Weltmacht USA und Konkurrent EU
– Krisenregionen: Irak – ein belagertes Land; Algerien –
Feindbild Islam; Fundamentalismen in der kapitalistischen Moderne
– Vom Imperialismus zum "Empire", vom globalen
Freihandel zur Re-Kolonisierung, neue Formen des globalen
Widerstands
– Krieg und Ökonomie: das Militärpotenzial der USA, neue
Kriegsökonomien
– Auswirkungen auf die bundesrepublikanische Innen-,
Sicherheits- und Medienpolitik.
Die vielen renommierten AutorInnen machen diesen Sammelbands zu
einer Grundlagenlektüre über die "Neue Weltordnung"
der USA und ihrer verbündeten Konkurrenten.
Verlagsinformation |
|
|
Claudia Haydt/Tobias Pflüger/Jürgen Wagner:
Globalisierung und Krieg. AttacBasisTexte 5. VSA-Verlag
2003. ISBN: 3-89965-004-2. |
|
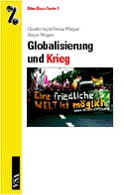
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der von der US-Regierung ausgerufene "Kreuzzug gegen den Terror" ist ein "permanenter Krieg", der im Wesentlichen geführt wird, um eine weltweite (Wirtschafts-) Ordnung militärisch durchzusetzen und abzusichern: Ein "doppelter Krieg" mit militärischen Mitteln und mit Marktmechanismen.
Ökonomische und militärische Facetten westlicher Hegemonialpolitik bedingen sich gegenseitig: "Der Imperativ der Globalisierung ist Krieg".
Am Beispiel des Irakkriegs werden die ökonomischen Interessen,
die meist hinter Kriegen stehen, besonders deutlich.
Westliche Politik führt z.B. in Somalia zu einer massiven Verarmung,
die Verteilungskämpfe nach sich zieht. Wenn westliche Interessen tangiert werden, folgen direkte (militärische) Interventionen mit dem Ziel der Herstellung ökonomischer und machtpolitischer "Ordnungen".
Mit dem Europäischen Sozialforum in Florenz sind globalisierungskritische und Antikriegs-Bewegung eins geworden. Protest und Widerstand sollten sich nicht nur gegen die USA richten, sondern ebenso gegen die Militarisierung der EU und den weltpolitischen Aufstieg Deutschlands mit militärischen Mitteln.
Zu den AutorInnen
Claudia Haydt ist Religionssoziologin und IMI-Beirätin.
Tobias Pflüger, Politikwissenschaftler und
(Mit-)Autor der Bücher
"Jugoslawien"
(1993), "Die neue Bundeswehr"
(1998), "Deutsche
Waffen in alle Welt" (2001) und "...
denn der Menschheit drohen Kriege" (2002), arbeitet ehrenamtlich im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. und im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC
Deutschland mit.
Jürgen Wagner, geboren 1974,
studierte von 1997 bis 2002
Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Tübingen. Er ist
Vorstandsmitglied der Informationsstelle Militarisierung (IMI) mit
dem Schwerpunkt US-Außen- und Sicherheitspolitik. Von ihm erschien
der Titel "Das ewige Imperium – Die US-Außenpolitik als
Krisenfaktor".
Verlagsinformation |
|
|
Robert
Brenner: Boom & Bubble. Die USA in der Weltwirtschaft.
VSA-Verlag 2002 (Durchgesehene Ausgabe). ISBN: 3-87975-886-7. |
|
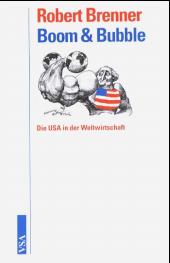
mehr
Infos
bestellen
|
"1998
entschlossen sich die Herausgeber von New Left zu einem ungewöhnlichen
Schritt: Als Nummer 229 wurde eine einzige, über 260 Seiten lange
Abhandlung des marxistischen Wirtschaftshistorikers Brenner
publiziert – "The Economics of Global Turbulence". Brenners
Versuch einer Gesamtdarstellung der Entwicklung der
kapitalistischen Zentren in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurde in Deutschland wenig beachtet, erregte aber im
englischen Sprachraum großes Aufsehen.
Die an der London School
of Economics erscheinende Zeitschrift Historical Materialism
publizierte 1999 zwei umfangreiche Ausgaben mit Beiträgen, die
sich kritisch damit auseinandersetzen. Das Interesse war zwei Umständen
geschuldet: Zum einen sind große Würfe auch in der marxistischen
Literatur relativ selten. Empirisch und theoretisch gehaltvolle
Darstellungen der neueren Entwicklung des globalen Kapitalismus
lassen sich an den Fingern abzählen. Zum anderen provozierte
Brenner durch einen originellen krisentheoretischen Ansatz."
(Argument,
Heft 248)
Verlagsinformation |
|
|
Jürgen Wagner: Das ewige
Imperium. Die US-Außenpolitik als
Krisenfaktor. VSA-Verlag 2002. ISBN: 3-87975-884-0. |
|
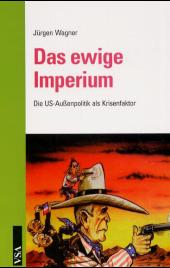
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die
außenpolitischen Eliten der USA behaupten, das Ziel der
US-Politik sei die Sicherung des Weltfriedens. Jürgen Wagner
untersucht deren Konzepte und kommt zu dem Schluss: In der Praxis
ist die Außenpolitik der USA auf Maximierung ihres politischen
Einflusses gerichtet.
Seit dem Ende des Kalten Krieges stellt die Festigung der eigenen
Position als einzig verbliebene Supermacht das überragende Ziel
der US-Außenpolitik dar. Diese ist in der Praxis bereits vor,
insbesondere aber auch nach den Terroranschlägen des 11.
September ausschließlich als Politik zur Wahrung der US-Hegemonie
zu begreifen. Die außenpolitischen Eliten der USA haben sich
hierfür ein theoretisches Legitimationskonstrukt zurechtgelegt,
das die rigorose Wahrung der US-Interessen und damit ihrer
hegemonialen Stellung als ein befriedendes Element der
Weltpolitik begreift.
Dieses Votum für die Machtpolitik nimmt einerseits weiten Teilen
der Weltbevölkerung jegliche Möglichkeit auf eine menschenwürdige
Existenz, was eine der Hauptursachen für die zu beobachtende
Zunahme des Terrorismus ist. Andererseits verschärft sie auch
zahlreiche Konflikte im zwischenstaatlichen Bereich und birgt
damit eine ständige Eskalationsgefahr in sich. Damit erreicht die
US-Außenpolitik das genaue Gegenteil dessen, was sie propagiert,
und erweist sich als permanenter Krisenfaktor.
Die theoretischen Grundlagen der US-Außenpolitik, das weist die
Analyse nach, basieren deshalb auf falschen Voraussetzungen oder
bilden lediglich einen Deckmantel für egoistische Interessen.
Nimmt Washington seine propagierten Ziele ernst, Konflikte im
internationalen System verringern zu wollen, bleibt nur die
radikale Abkehr von der bisherigen Ausrichtung auf eine
machtmaximierende Politik.
Zum Autor
Jürgen Wagner, geboren 1974,
studierte von 1997 bis 2002 Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Tübingen. Er
ist Vorstandsmitglied der Informationsstelle Militarisierung (IMI)
mit dem Schwerpunkt US-Außen- und Sicherheitspolitik. Zahlreiche
Veröffentlichungen von Artikeln zum Thema, u.a. in
FREITAG, Neues
Deutschland, antimilitarismusinformation, analyse und kritik,
Graswurzelrevolution, Zeitung gegen den Krieg. Mehrere Studien
für die Informationsstelle Militarisierung (IMI), das Berliner
Informationszentrum für transatlantische Sicherheit (BITS), das
Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsordnung
in München (isw) und die
PDS-Bundestagsfraktion. Mitautor von "Globalisierung
und Krieg" (2003).
Verlagsinformation
|
|
|
Zbigniew
Brzezinski: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der
Vorherrschaft. Mit einem Vorwort von Hans-Dietrich Genscher.
Fischer-Taschenbuch-Verlag 1999. ISBN: 3-596-14358-6. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion existiert nur noch eine
Supermacht auf dieser Erde: die Vereinigten Staaten von Amerika.
Und noch nie in der Geschichte der Menschheit hat eine Nation
über so große wirtschaftliche, politische und militärische
Mittel verfügt, um ihre Interessen durchzusetzen. Noch nie gelang
es einer Demokratie, zur ersten und einzigen
Weltmacht aufzusteigen.
Was bedeutet dieses Faktum für Amerika und den Rest der Welt,
insbesondere für Deutschland, Europa und den europäischen
Einigungsprozess? In einer brillanten strategischen Analyse legt
Zbigniew Brzezinski dar, warum die Vorherrschaft der USA die
Voraussetzung für Frieden, Wohlstand und Demokratie in der Welt
ist, und wie Amerika sich verhalten muss, um seine
Weltmachtstellung zu erhalten.
Verlagsinformation
Dieses Buch ist ein Standardwerk für alle, die sich mit der
Rechtfertigung der globalen US-Vorherrschaft auseinandersetzen wollen.
Fruchtbar wird die Lektüre dieses grundlegenden geopolitischen
Werks von Brzezinski vor allem durch kritisches Querlesen. Dabei
gilt es den Orwell'schen "Newspeak" der gemäßigten
Imperialismus-Fraktion um Brzezinski zu decodieren.
So bezeichnet
der Autor z.B. solche Regierungen und Entwicklungsländer als
"demokratisch" oder "stabil", welche eine
US-freundliche Regierung haben – sei es eine Diktatur oder eine
(meist nur formale) Demokratie. "Stabilität" nach
imperialer Lesart kann demnach gerade dort herrschen, wo Terror
und Chaos am größten sind; solange sich die Regierung durch
derartige Maßnahmen im Sattel halten kann, gilt das Land als
"stabil", d.h. im Klartext: seine Regierung steht auf
"unserer" Seite.
Und wenn Brzezinski von "Freiheit" spricht, so ist vor
allem die Freiheit des Kapitals gemeint. Der interessante Ausdruck
"Glaubwürdigkeit" wiederum bezeichnet die
Abschreckungsfähigkeit eines Machtgebildes. Die
"Glaubwürdigkeit" der NATO in der Kosovokrise wurde
z.B. dadurch gewahrt, dass sie ihre Kriegsdrohung wahr machte und
Jugoslawien angriff. Ähnlich wurde in der Irakkrise von
Kriegsbefürwortern argumentiert: Die NATO müsse ihre "Glaubwürdigkeit" gegenüber dem Irak durch einen
völkerrechtswidrigen "Präventiv"krieg sichern.
Mit einer solchen ideologiekritischen Lesebrille versehen, sind
die geopolitischen Ausführungen Zbigniew Brzezinskis und seine
konkreten Handlungsempfehlungen für die US-Regierung höchst
informativ und anregend.
Michael
Kraus
Weitere Informationen:
"Weltordnung durch US-Leadership? Die
Konzeption Zbigniew K. Brzezinskis" (2000) |
|
|
Amy Holmes/David
Salomon/Stefan Schmalz (Hrsg.): Imperial Djihad? Über
Terrorismus, Schurkenstaaten und neue Kriege. VSA-Verlag 2002.
ISBN: 3-87975-879-4. |
|
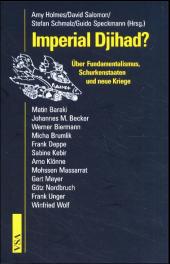
mehr Infos
bestellen
|
Die Kriege sind intelligenter geworden. Hochtechnologische
Waffensysteme garantieren den kriegsführenden Mächten bei einer
gezielten Gegnerauswahl angeblich "null
Tote" in den eigenen Reihen, wenn sie
"chirurgisch"
eingreifen. Raffiniert sind auch die propagierten Kriegsziele: Wer
hat schon etwas dagegen, dass die "zivilisierte
Welt" für Menschenrechte gegen
"skrupellose Schurkenstaaten"
vorgeht?
Kein Wunder also, dass viele der ehemals Friedensbewegten entweder
schweigen oder in einem Pazifismus verharren, dessen
Argumentationsnot sich kaum kaschieren lässt. Ein Friedenskonzept,
das diesen neuen Herausforderungen gewachsen ist, muss sich daher
neu begründen. Hierzu ist eine grundlegende Analyse der
"neuen Weltordnung"
notwendig, insbesondere nach den Ereignissen des 11. Septembers.
War dieser ein Zeichen der Schwäche der US-amerikanischen
Hegemonie in der Weltpolitik oder gehen die Vereinigten Staaten
gestärkt ins neue Jahrtausend? Kann die Globalisierung der Gewalt
überhaupt noch verhindert werden? Werden die europäischen Staaten
in "uneingeschränkter Solidarität"
zu ihrem amerikanischen Bündnispartner verharren oder wird ein
neuer europäischer Imperialismus den Einfluss der USA zunehmend
eindämmen?
Verlagsinformation |
|
|
Werner Biermann/Arno Klönne:
Ein
Kreuzzug für die Zivilisation? Internationaler Terrorismus,
Afghanistan und die Kriege der Zukunft. PapyRossa-Verlagsgesellschaft 2002.
ISBN: 3-89438-239-2. |
|
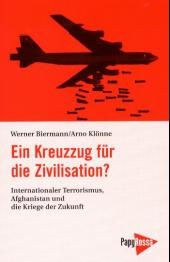
mehr
Infos
bestellen
|
Seit
dem 11. September sei, so heißt es, nichts mehr wie es war.
Demgegenüber legen die Autoren dar, dass für die Politik der USA
von einem "Paradigmenwechsel" als Reaktion auf die
Terroranschläge nicht die Rede sein kann. Vielmehr stellen sich
unbequeme Fragen: Was hat speziell die US-amerikanische Strategie
mit dem Terrorismus zu tun? Kamen im Afghanistankrieg
geopolitische Ambitionen zum Zuge, die längst vorbereitet waren?
Hätte bin Laden als "Stargegner" nicht womöglich
erfunden werden müssen, um von der realen Konfliktlage
abzulenken? Um welche Ziele ging es somit in diesem Krieg? Wie
weiter in Afghanistan und in der Region? Und wer ist als nächster
dran? Sodann: Welche Rolle spielt eigentlich Deutschland dabei?
Ist es wirklich der Musterschüler, als der es sich so
demonstrativ geriert? Was verbirgt sich hinter seiner
"uneingeschränkten Solidarität mit Amerika" an eigenen
Interessen? Und wo sind Ansätze wirksamer Antikriegsopposition?
Verlagsinformation
|
|
|
Werner Biermann/Arno Klönne: Globale Spiele. Imperialismus heute
– Das letzte Stadium des Kapitalismus? PapyRossa-Verlagsgesellschaft 2001.
ISBN: 3-89438-227-9.
|
|
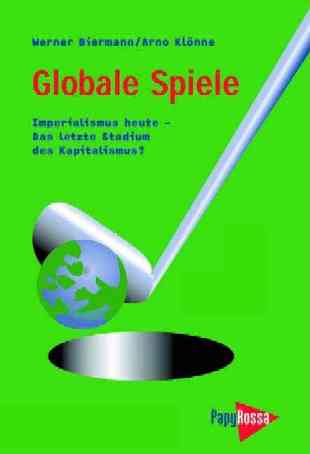
mehr
Infos
bestellen
|
Das
angekündigte goldene Zeitalter nach dem weltweiten Triumph des
kapitalistischen Modells ist nicht in Sicht. Tatsächlich ist
dieses immer weniger in der Lage, seine Glücksverheißungen für
die Mehrheit der Weltgesellschaft einzulösen.
Zivilisationsbrüche sind unverkennbar, die Gräben zwischen Arm
und Reich reißen weiter auf. Die Autoren charakterisieren das
neue Stadium, in das der Kapitalismus nach seinem Sieg eingetreten
ist. Sie zeichnen seine Machtstrukturen nach und belegen, wer die
Früchte des Sieges erntet und wer dessen Kosten trägt. Sie
beschreiben die Folgen der US-amerikanischen Leitökonomie und
diskutieren, wie sich der Vorrang der Finanzmärkte global
auswirkt. Ist die überall postulierte "nachhaltige
Entwicklung" unter solchen Bedingungen realistisch? Verträgt
sich der siegreiche Kapitalismus noch mit dem Ideal einer
Zivilgesellschaft? Mit welchen Risiken müssen die "globalen
Spiele" rechnen? Über welche Alternativen müssen wir
nachdenken?
Verlagsinformation |
|
|
Norman
Paech/Gerhard Stuby:
Völkerrecht und Machtpolitik in den internationalen Beziehungen.
Ein Studienbuch. VSA-Verlag 2001. ISBN: 3-87975-759-3. |
|
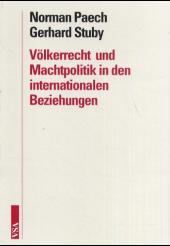
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Für die Konflikte in den internationalen Beziehungen scheint das Völkerrecht derzeit kaum eine Rolle zu spielen, wie nicht zuletzt der Kosovo-Krieg gelehrt hat. Wo es hemmend auf die einseitige Durchsetzung von Interessen wirken soll, wird es beiseite geschoben. Andererseits: völlig negieren können die Machtpolitiker das Völkerrecht auch nicht. Sie benötigen es zumindest als Legitimierungsinstrument.
Diesem Widerspruch gehen die Autoren in der Genese als auch in der historischen Entfaltung des modernen Völkerrechts nach.
Sie zeichnen einen Querschnitt durch seine Epochen seit Beginn der Neuzeit, dem eine Darstellung des geltenden Völkerrechts mit seinen neuesten Entwicklungstendenzen folgt. Die übliche eurozentristische Beschränkung der herrschenden Völkerrechtslehre wird sowohl im historischen Aufriss wie in der Dogmatik des aktuellen Völkerrechts zugunsten einer Perspektive überwunden, die insbesondere die Kräfte und Auswirkungen der Dekolonisation berücksichtigt.
Diese kritische Auseinandersetzung mit Völkerrecht und Machtpolitik richtet sich nicht nur an Juristen und Spezialisten, sondern auch an Studierende und Tätige in anderen Disziplinen. Im Jurastudium ist es ebenso verwendbar wie im Bereich Theorie und Geschichte der internationalen Beziehungen des Geschichts- und Politikstudiums. Dank eines umfangreichen Sach- und Personenregisters eignet sich das Buch für alle die Praxis und Theorie der internationalen Beziehungen betreffenden Fragen.
Zu den Autoren
Norman Paech und Gerhard Stuby sind Professoren für Öffentliches Recht und wissenschaftliche Politik. Sie lehren und forschen an der Hochschule für Wirtschaft und Politik Hamburg sowie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bremen. Ihr Werk ist aus langjähriger Lehrpraxis und Arbeitszusammenhängen in internationalen
Organisationen – vornehmlich Nichtregierungsorganisationen – entstanden.
Verlagsinformation |
|
|
Andreas
von Bülow: Im Namen des Staates. CIA, BND und die kriminellen
Machenschaften der Geheimdienste. Piper-Verlag 2000. ISBN:
3-492-23050-4. |
|
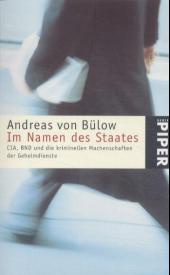
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die
östlichen Geheimdienste waren böse, die westlichen – BND, CIA
und Mossad - hingegen "sauber". Diese weitverbreitete
Ansicht machte den Bundestagsabgeordneten von Bülow misstrauisch,
und er begann auf eigene Faust zu ermitteln. Das Ergebnis seiner
Recherchen war alarmierend: Die westlichen Geheimdienste, so seine
Behauptung, haben in den vergangenen Jahren kräftig mitgemischt –
beim Drogenhandel, im Terrorismus und in Kreisen der organisierten
Kriminalität.
Verlagsinformation
Bülows Buch erschien bereits im Jahr 2000, ist aber seit den
Anschlägen vom 11. September 2001 aktueller denn je. Angesichts
des Versagens der US-Geheimdienste vor den
Terroranschlägen und in Anbetracht der haarsträubenden
Ungereimtheiten in der offiziellen Verschwörungstheorie der
Bush-Administration kann ein Blick in die Vergangenheit der
Geheimdienste sehr hilfreich sein.
Die US-Regierung verglich die Wirkung der Anschläge vom 11.09.
mit dem japanischen Angriff auf den US-Stützpunkt "Pearl
Harbor" im Zweiten Weltkrieg, der in den USA die politische
Voraussetzung für den offiziellen Kriegseintritt schuf. Nach
heutigem Wissensstand wäre das Desaster von "Pearl Harbor"
vermeidbar gewesen, wenn die Roosevelt-Administration dies nur
gewollt hätte. Doch der Angriff schien opportun für die eigenen
Pläne, folglich unterließ die US-Regierung vorbeugendes Handeln. Ähnliches
könnte sich auch im Vorfeld des 11. September 2001 abgespielt
haben, wie Andreas von Bülow in zahlreichen Interviews nach 09-11
darlegte (siehe Interviews).
Michael
Kraus
Zum Autor
Dr. Andreas von Bülow, 1937 geboren in Dresden, 1945 mit der Familie nach
Heidelberg umgesiedelt. Jurastudium in Heidelberg und München, 1969 Promotion zum Dr. jur.
Seit 1960 SPD-Mitglied, 1969-1994 Mitglied des Bundestags (u. a. in der Parlamentarischen
Kontrollkommission für die Geheimdienste), 1976-1980 Parlamentarischer
Staatssekretär im Verteidigungsministerium, 1980-1982 Bundesminister für
Forschung und Technologie, seit 1994 Rechtsanwalt in Bonn.
Veröffentlichungen: "Im
Namen des Staates" (2000), "Die
CIA und der 11. September" (2004).
Verlagsinformation
Interviews:
-
"Die amerikanische Darstellung ist falsch" (Oberhessische
Presse, 05.04.2002)
-
"Da sind Spuren wie von einer trampelnden Elefantenherde"
(Tagesspiegel, 13.01.2002)
-
Was weiß die CIA über den 11. September? Was wussten die Insider?
(KONKRET Nr. 12/2001)
-
Ein
Gespräch mit Andreas von Bülow (Der Europäer
Nr. 9/10, Juli/August 2002)
Veranstaltung:
Die CIA und der 11. September": Vortrag am 12.09.2003
im Buchladen Neuer Weg |
|
|
Magnus Engenhorst: Kriege nach Rezept.
Geheimdienste und die NATO in aller Welt. Verlag Edition AV 2002.
ISBN: 3-936049-06-8. |
|
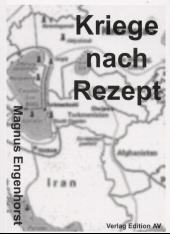
mehr Infos
bestellen
|
Nach
dem Ende des Kalten Krieges und dem Verlust des gemeinsamen
Feindes im Osten begannen die transatlantischen Bande langsam zu
bröckeln. Der Aufbau einer eigenen Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungsidentität (ESVI) zeugt davon. Konflikte zwischen dem
alten und dem neuen Kontinent scheinen sich derzeit auf die
wirtschaftliche Ebene zu beschränken. Magnus Engenhorst zeigt
dagegen in seinem Buch "Kriege nach Rezept" auf, inwiefern bereits
heute Konflikte zwischen der EU und den USA ausgefochten werden.
"Die unterschiedlichen Machtinteressen zwischen den Vereinigten
Staaten und der EU treten immer mehr zu Tage. Diese neue Qualität
im Kampf um Macht kündigte sich bereits bei den Konflikten auf dem
Balkan und im Kaukasus an."
Washington hat im Windschatten der Ereignisse nach dem 11.
September Militärstützpunkte in Zentralasien aufgeschlagen.
Zähneknirschend musste Moskau mit ansehen, wie US-Militärberater
in Georgien ankamen, um die dortige Armee im Kampf gegen den
Terrorismus zu schulen. Dabei ist das Land ein NATO-Kandidat und
wurde schon lange vor dem 11. September von den USA aufgerüstet.
Im Gegensatz zu manchen Verlautbarungen habe Berlin durchaus harte
Interessen im Kampf um die Energieressourcen um das Kaspische
Meer. Strategischer Bündnispartner dabei seien nicht etwa die USA,
sondern viel mehr Moskau. Die USA versuchten derzeit Afghanistan
zu stabilisieren, um endlich die Pipeline-Route durch Afghanistan
zum Indischen Ozean zu realisieren. Doch vor allem der Iran funke
Washington dabei hinein.
Der Kosovo-Krieg habe unter anderem den Zweck gehabt, eine
Pipeline-Route vom Kaspischen Meer zum europäischen Markt zu
sichern. Mittel zum Zweck wären dabei die UCK-Rebellen gewesen.
Nachdem der Bundesnachrichtendienst (BND) versucht habe, sich
anstelle der CIA an deren Spitze zu setzen, sei es zum Bruch
gekommen. Der Konflikt um Mazedonien diene ebenfalls lediglich
strategischen Interessen. Unterstützt von den USA und indirekt von
der EU hätten die UCK-Derivate die Aufgabe gehabt, das Land zu
destabilisieren, um militärische Optionen offen zu halten. Im
Kosovo an der Grenze zu Mazedonien befindet sich in der Tat die
größte US-Militärbasis außerhalb der USA. Gestützt werden diese
Thesen durch Aussagen des CDU-Verteidigungsexperten Willy Wimmer.
Entgegen dem Gerede von "humanitären Interventionen" und dem
"Kreuzzug gegen den Terrorismus" ständen hinter dem
Wildwest-Cowboy Bush knallharte ökonomische und strategische
Interessen. Bereits heute zeichneten sich dabei die zukünftigen
Konfliktlinien zwischen den USA und der EU ab. Wieder wurde Krieg
bis an die Grenzen Zentralasiens getragen. Die Region um das
Kaspische Meer scheint das "Schlachtfeld der Zukunft" zu werden,
wie Peter Scholl-Latour meint. Welche Interessen es gibt und wie
die derzeitige Situation aussieht, analysiert Engenhorst mit
Schwerpunkt auf den Kaukasus und Zentralasien. Damit hat der Autor
des Kölner geheimdienstkritischen Fachmagazins "GEHEIM" eine
wichtige Studie vorgelegt. Wer an einem tiefergehenden Einstieg in
die Hintergründe der Kriege des 21. Jahrhunderts interessiert ist,
wird durch dieses Buch kenntnisreich und verständlich informiert.
Quelle:
Graswurzelrevolution Nr. 272, Oktober 2002 |
|
|
James
Bamford: NSA. Die Anatomie des mächtigsten Geheimdienstes der
Welt. Goldmann-Taschenbuch-Verlag 2002. ISBN: 3-442-15151-1. |
|
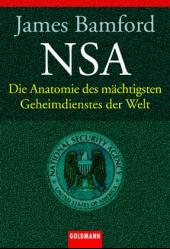
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der Geheimdienstexperte James Bamford bringt Licht in das Dunkel
der NSA, einer Art "Big-Brother-Organisation". Er
berichtet unter anderem über die Gründung der NSA, ihre internen
Strukturen sowie den Informationswettlauf vom Kalten Krieg bis
heute. Ein Glanzstück investigativen Journalismus' - ein nie da
gewesener Einblick in eine Welt, die für demokratische Kontrolle
nur ein kaltes Lächeln übrig hat.
Zum Autor
Der US-amerikanische Journalist James Bamford gilt weltweit als
DER Experte in Fragen der Geheimdienstszene, speziell der NSA. Er
schreibt u. a. für renommierte Zeitschriften wie "New York
Times", "Washington Post" und "Los Angeles
Times". Bereits das 1982 veröffentlichte NSA-Buch "The
Puzzle Palace" wurde in den USA zum Bestseller.
Verlagsinformation
Rezension
Dem Großen Bruder in den Topf geschaut (Confidenz-Depesche) |
|
|