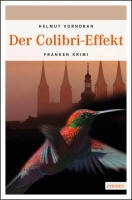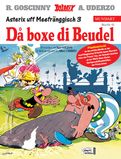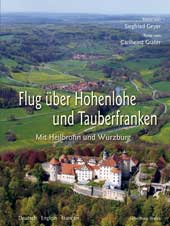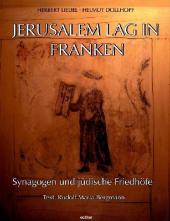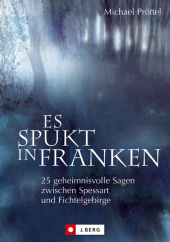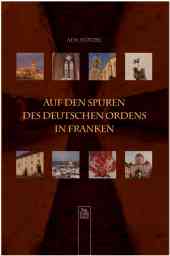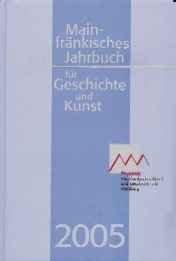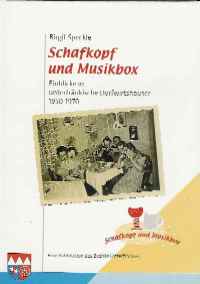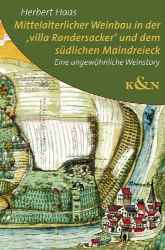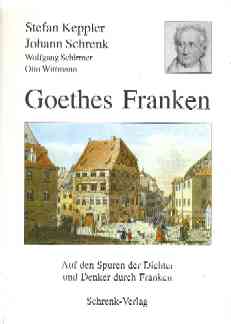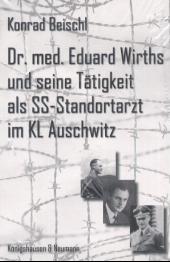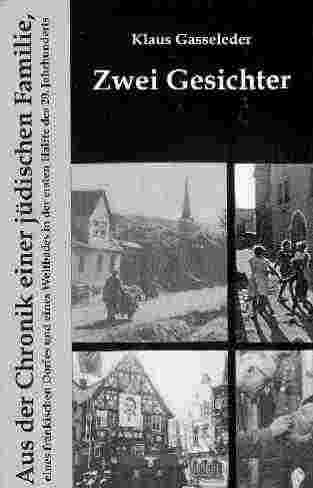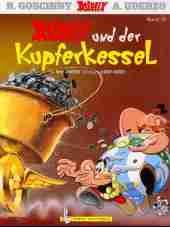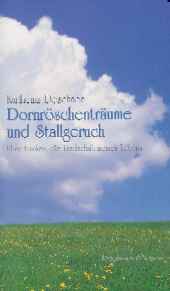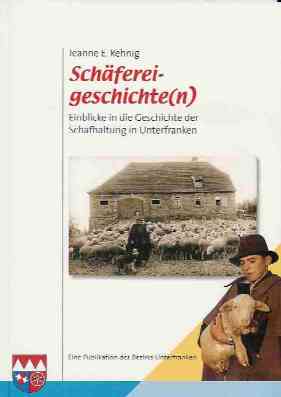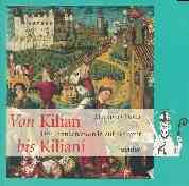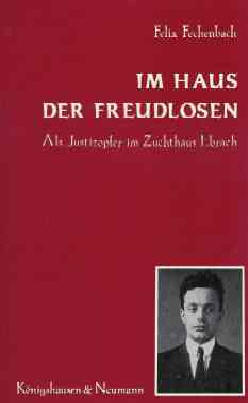|
Franken |
|
|
|
Tatort
Franken . Bd.3 |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zusatztext
Abermals schwebt der
Landstrich von Aschaffenburg bis Altdorf, vom Fichtelgebirge bis
zum Altmühltal in höchster Gefahr, und die Furcht geht um:
Kaltblütige Verbrecher versetzen Stadt und Land in Unruhe. Zum
Glück treten raffinierte Ermittlerinnen, clevere Kommissare und
findige Detektive auf den Plan, um ihnen Einhalt zu gebieten.
Sie nehmen die Spuren auf, und beweisen auf Neue, dass Mord in
Franken auf Scharfsinn trifft. Zur Freude aller Krimileser ...
So versammelt der dritte Band der beliebten
Frankenkrimi-Anthologien wieder neue Kriminalgeschichten voller
Spannung, Witz und schwarzem Humor aus der Feder der
bekanntesten Autoren der Region. Doch auch zwei Newcomer sorgen
diesmal für unterhaltsames Krimivergnügen: die Gewinner des 1.
Fränkischen Krimipreises mit ihren von Jury und Publikum
gekürten Siegerbeiträgen! |
|
|
Vorndran,
Helmut; Der Colibri-Effekt |
|
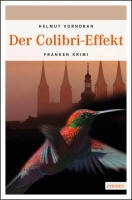
mehr Infos
bestellen
|
Zusatztext
Ein Mann wacht neben
einem brennenden Fahrzeug auf. Er weiß nicht, wo er ist, er weiß
nicht, wer er ist, und sein Instinkt rät ihm, möglichst schnell
zu verschwinden. Kurz darauf bemerkt er, dass er verfolgt wird.
Er schlägt sich auf abenteuerliche Weise bis in seine
Geburtsstadt Bamberg durch. Hier kommt es zur endgültigen
Eskalation der Ereignisse. Und mittendrin - die Ermittler
Haderlein, Lagerfeld und Riemenschneider.
Autorenportrait
Helmut Vorndran,
geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als
Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als
überzeugter Franke
hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger
Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für
Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen. |
|
|
Magirius,
Georg ; Westphal, Regina : Mystische Orte; Wanderungen durch
Unterfranken |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zusatztext
Unheimlich, abgeschieden, sagenumwittert, spektakulär und schön:
In Unterfranken lassen sich zahlreiche geheimnisvoll-mystische
Orte entdecken. Die Wanderungen führen durch Steigerwald,
Spessart, Odenwald, Rhön, Haßberge und Fränkisches Weinland zu
14 außergewöhnlichen Orten. So klettern die Autoren auf den
Teufelstein und tauchen auf der Weininsel bei Volkach in
schwindelerregende Genüsse ein. Sie schwimmen im Naturparksee
bei Arnstein dem Licht entgegen und erleben auf dem Würzburger
Käppele eine sagenhafte Ruhe über den Dächern der Stadt. Dann
rätseln sie über riesenhafte Heunesäulen, spazieren durch den
nebelverhangenen Schlosspark am Schönbusch und spüren
unvergängliche Kräfte auf der Felsruine Rotenhan. Die
persönlichen Schilderungen der Autoren laden ein, sich selber
auf den Weg zu machen. Die Touren sind genau beschrieben, in
wenigen Stunden zu bewältigen und können leicht nachgewandert
werden.
Autorenportrait
Georg Magirius, geboren 1968, ist evangelischer Theologe, freier
Schriftsteller und Hörfunkjournalist für verschiedene
ARD-Sender. |
|
|
Scheele,
Paul-Werner; Begegung mit Tilman Riemenschneider . |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zusatztext
Jede Begegnung, die unsere Seele berührt, hinterlässt einen
tiefen Eindruck. Gute Begegnungen können zu heilsamen
Lebenshilfen werden. In diesem Sinne laden Autor und Fotograf zu
einer persönlichen Begegnung mit den Werken des Bildhauers
Tilman Riemenschneiders wie mit dem Meister selbst ein.
Autorenportrait
Paul-Werner Scheele, geb. 1928, Dr. theol., Professor, 1979-2003
Bischof von Würzburg em., Mitglied des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Einheit der Christen, Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Beirates des Johann-Adam-Möhler-Instituts für
Ökumenik. |
|
|
Albert Uderzo/Rene Goscinny: Då
boxe di Beudel. (Der Kampf
der Häuptlinge, Asterix Mundart, Bd.61 Mainfränkisch/Asterix uff Meefränggisch Bd.3) Ehapa Comic Collection – Egmont Manga &
Anime 2006. ISBN: 3-7704-3055-7. |
|
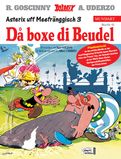
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Es is fuchzich vor Christus. In ganz Frångn führn die Besatzer des
Rechiment. In ganz Frångn?
Nää – ä glens Völkle in Unnerfrångn wärd zwar schon lång
underdrüggd vo der Kapidåle in Südn. Aber unbeuchsam wie se sin,
dun se alleweil emål aufbegehr. Un für die Besatzer is des Lebm
nit eifach in ihre Låcher Silvanum, Scheurebrum, Rieslania un
Müllrum-Thurgia...
Zu den Autoren
Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem
Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung
eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten
Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich
abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René
Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als
Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".
René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos
Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als
Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem
Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ
Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur
einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf
sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für
Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky
Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und
"Asterix" (mit Uderzo).
Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.
November 1977.
Verlagsinformation |
|
|
Siegfried Geyer/Carlheinz Gräter:
Flug über Hohenlohe und Tauberfranken.
Mit Heilbronn und Würzburg. Deutsch, English, Français. 176
Seiten, 189 Farbaufnahmen.
Einführungspreis bis 31. Januar
2007: 29,90 Euro, danach 32,90 Euro.
ISBN: 3-87407-708-X. |
|
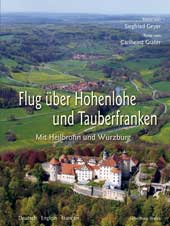
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Von Bad Wimpfen bis Schillingsfürst und Rothenburg ob der Tauber,
von Gaildorf und Schwäbisch Hall bis Wertheim und Würzburg: In
einmaligen Luftaufnahmen porträtiert der Fotograf Siegfried Geyer
die Region Hohenlohe-Franken. Die einzigartigen Fotos
dokumentieren, dass die Landschaft an Jagst, Kocher und Tauber
reich an schmucken Städtchen und Dörfern ist – an beeindruckenden
Schlössern und Burgen, an pittoresken Kirchen und Klöstern.
Dazwischen sieht man fast unberührte Winkel mit einsamen Gehöften,
Mühlen oder den typischen Holzbrücken. Doch auch die beiden, für
diese Region wichtigen Großstädte, Heilbronn und Würzburg, sind in
diesem Band mit brillanten Fotografien aus der Vogelperspektive
enthalten. Der Hohenlohe- und Franken-Kenner Carlheinz Gräter hat
die fantastischen Bilder detailreich und profund beschrieben. Alle
Texte sind dreisprachig abgedruckt.
Das Buch ist ein wunderbares Geschenk für alle Liebhaber der
Region Hohenlohe-Franken, für Besucher, Geschäftskunden und
Freunde im Ausland.
Zu Autor und Fotograf
Dr. Carlheinz Gräter, geboren 1937 in Bad Mergentheim, studierte
Geschichte und Literatur, arbeitete anschließend als
Zeitungsredakteur und ist seit 1972 freier Schriftsteller. Er lebt
heute in Würzburg. Für sein Werk, das mehr als 60
Buchveröffentlichungen umfasst, wurde er mit dem Kulturpreis des
Frankenbundes ausgezeichnet.
Siegfried Geyer, geboren 1954, ist in Heidenheim an der Brenz zu
Hause. Er ist ausgebildeter Fotograf und seit über 25 Jahren auf
Luftbilder spezialisiert.
Verlagsinformation |
|
|
Herbert Liedel/Helmut Dollhopf/Rudolf
M. Bergmann: Jerusalem lag in Franken. Synagogen und jüdische
Friedhöfe. Echter-Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 3-429-02826-4. |
|
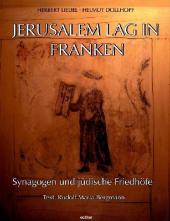
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Bei der Beschäftigung mit den Folgen der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft waren die Fotografen Herbert Liedel und Helmut
Dollhopf auf die noch erhaltenen Synagogen und Friedhöfe
aufmerksam geworden. Nicht wenige präsentierten sich
zweckentfremdet oder verwahrlost. In jüngster Zeit sind viele
dieser Friedhöfe wiederhergerichtet. Synagogen restauriert, und
einer neuen, würdigen Bestimmung zugeführt worden. So finden dort
nicht nur Mahn- und Gedenkgottesdienste, sondern auch kulturelle
Veranstaltungen statt.
"Jerusalem lag in Franken – Synagogen und jüdische Friedhöfe"
dokumentiert die tragische Geschichte jüdischer Gotteshäuser und
-acker repräsentativ über diesen Zeitabschnitt. Gegenübergestellt
werden der Zustand nach dem Ende des Dritten Reiches und das
jetzige Antlitz – teilweise ergänzt durch Schwarzweiß-Aufnahmen
aus der Zeit vor der "Reichskristallnacht" im Jahr 1938.
Der Text liefert den nötigen Hintergrund zu den abgebildeten
Objekten, informiert über Zerstörung. Zweckentfremdung, aber auch
über Erhaltung und neue Bestimmung. So ist dieser Band ein Projekt
gegen das Vergessen und eine Aufforderung, zur Verhinderung neuer
Unmenschlichkeit beizutragen.
Zu den Autoren
Herbert Liedel lebt als Fotograf in Nürnberg. Der Bildautor
zahlreicher Landschaftsbände und anderer Bücher engagiert sich
auch als Filmemacher. Als passionierter Fußball-Anhänger
fotografiert er seit langem für das Kicker Sport-Magazin. Auch
Helmut Dollhopf arbeitet als Fotograf.
Rudolf Maria Bergmann, der Textautor, studierte Kunstgeschichte,
Germanistik und Philosophie. Er arbeitet als freier Journalist und
Publizist, schreibt über Architektur, Kunst und Reisen. Zahlreiche
Veröffentlichung, u.a. in: Baumeister, Bauwelt, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Goethe-Institut Inter
Nationes, Neue Zürcher Zeitung, Rheinischer Merkur, Der
Tagesspiegel, Der Standard, Zeitschrift für Gottesdienst und
Predigt. Verfasser von Baumonografien; Beiträge in Anthologien und
Jahrbüchern. Buchautor. Bergmann lebt in Eichstätt und Wien.
Verlagsinformation |
|
|
Michael Pröttel: Es spukt in
Franken.
25 geheimnisvolle Sagen zwischen Spessart und Fichtelgebirge. J.
Berg-Verlag 2006. ISBN: 3-7658-4175-7. |
|
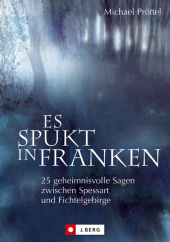
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die spannendsten Sagen aus Bayern in einem Band. Sagen und Fantasy
liegen im Trend bei Jung und Alt. Erstklassige Illustrationen
untermalen die mysteriösen Geschichten. In dieser Sagensammlung
wird Geschichte in ihrer fantasievollsten Form lebendig. Denn es
geht in den Geschichten ja nicht nur um die Protagonisten. Darüber
hinaus erfährt der Leser viel über das tägliche Leben der
"einfachen und edlen Leut" in den guten alten Zeiten. Machen wir
uns also auf die Suche nach den Geheimnissen in den Schluchten,
auf den Bergen und an den Bächen in Bayern! Ob der "Herr der
Ringe" oder "Harry Potter" ... Fantasy ist mega-in!
Zum Autor
Michael Pröttel, geboren 1965, studierte Geografie und
Landschaftsökologie. Er ist heute tätig als Journalist und
Fotograf, u.a. für die Zeitschrift "Bergsteiger". Die historischen
und geografischen Besonderheiten europäischer Gebirgslandschaften
sind seine Leidenschaft. Außerdem befasst er sich intensiv mit
natur- und sozialverträglichen Tourismuskonzepten. Er ist
Vorsitzender der Alpenschutzorganisation "Mountain Wilderness"
Deutschland.
Verlagsinformation |
|
|
Ada Stützel: Auf den Spuren des
Deutschen Ordens in Franken.
Mit zahlreichen zum Teil farbige Abbildungen. Sutton Verlag 2006.
ISBN: 3-89702-990-1. |
|
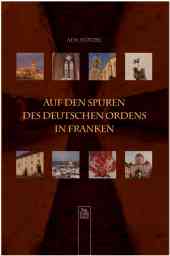
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Über 600 Jahre hat der einst mächtige Deutsche Orden die
Geschichte Frankens mitgeprägt. Er war Herr über Städte, Dörfer
und Burgen und entfaltete seine Macht vor allem in ländlich
geprägten Gebieten. In vielen Orten stellte der Ritterorden einen
beutenden Wirtschaftsfaktor dar. Langfristig prägte er das
religiöse Empfinden der Menschen ganzer Regionen und entwickelte
sich schließlich zu einem festen Bestandteil der fränkischen
Kulturlandschaft. Dennoch sind die historischen Hintergründe
seines Einflusses in Franken heute nahezu in Vergessenheit
geraten.
Die Journalistin Ada Stützel hat sich nun auf Spurensuche begeben
und die bekannten und weniger bekannten fränkischen
Wirkungsstätten des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch,
das sich vor allem auf das heutige Mittel- und Unterfranken
konzentriert, behandelt sie die Zeit von der Niederlassung des
Deutschen Ordens in Franken um 1200 bis zu seiner Auflösung durch
Napoleon im Jahre 1809.
Anhand heute noch sichtbarer Überreste macht dieses reich
illustrierte Buch die Geschichte des Deutschen Ordens wieder
lebendig. Unterhaltsam und kenntnisreich erzählt die Autorin,
welche Ereignisse, Machtkämpfe und Traditionen sich hinter den
immer noch präsenten Spuren des Ordens verbergen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der Deutsche Orden: Ein Abriss seiner Geschichte
- I. Der Deutsche Orden als Herr über Stadt, Dorf oder Burg:
Ellingen, Stopfenheim, Absberg, Virnsberg, Wolframs-Eschenbach,
Gelchsheim, Hüttenheim, Stadtprozelten, Obermässing
- II. Der Deutsche Orden in den freien Reichsstädten: Nürnberg,
Rothenburg ob der Tauber, Detwang, Dinkelsbühl, Schweinfurt
- III. Der Deutsche Orden in Residenz- und Landstädten: Würzburg,
Münnerstadt
- IV. Wissenswertes und Impressionen
- Bildnachweis
- Literaturhinweise
Aus dem Vorwort
Franken ist ein altes Kulturland, Seine Einwohner blicken stolz
auf ihre Geschichte und Traditionen. Stolz sind sie auch auf den
Ort, in dem sie leben - ganz gleich, ob er für den Verlauf der
großen Geschichte von Bedeutung war oder nicht. Zwischen zwei
Orten, die vielleicht nur wenige Kilometer voneinander entfernt
sind, können Welten liegen: sprachliche, traditionelle, religiöse.
Meist wortkarg und zurückhaltend agieren die Franken gegenüber
Fremden. Franken sind bodenständig. Sie bleiben gern zu Hause,
denn dort wissen sie, woran sie sind. Außerhalb ihrer Heimat gibt
es für den Franken in Deutschland nur noch Bayern und Preußen.
Wandert ein Bayer oder Preuße ein, muss er sich bewähren. Bis er
ein Freund wird, kann es eine ganze Generation dauern. Bis er als
Franke akzeptiert ist, muss er schon ein paar Ahnen auf dem
örtlichen Friedhof zu Grabe getragen haben.
Auch in der Geschichte des Deutschen Ordens auf dem Boden des
heutigen Frankens lässt sich ein Schlüssel finden - zum
Verständnis all jener Eigenschaften, die den Franken so
unverwechselbar charakterisieren. Fast 600 Jahre war der Deutsche
Orden Teil des fränkischen Alltags. Er baute Städte, Burgen und
Schlösser, etablierte sich als Wirtschaftsfaktor des Ortes, in dem
er sich niederließ, prägte das religiöse Empfinden der Menschen
ganzer Regionen und wurde schließlich ein fester Bestandteil der
fränkischen Kulturlandschaft. Vieles von dem ist heute leider in
Vergessenheit geraten. Zu Unrecht.
Dieses Buch möchte Sie auf die Spuren führen, die der einst so
mächtige Orden im heutigen Franken hinterlassen hat. Manchmal ist
es nur ein unscheinbarer Gemarkungsstein am Wegesrand, ein anderes
Mal sind es mächtige himmelwärts strebende Sakralbauten. An einem
Ort ist es ein schlichter Verwaltungsbau und an einem anderen eine
beeindruckende Stadtbefestigung oder ein imposantes Barockschloss.
Zur Autorin
Die Journalistin Ada Stützel hat sich auf Spurensuche begeben und
die bekannten und weniger bekannten fränkischen Wirkungsstätten
des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch, das sich vor allem
auf das heutige Mittel- und Unterfranken konzentriert, behandelt
sie die Zeit von der Niederlassung des Deutschen Ordens in Franken
um 1200 bis zu seiner Auflösung durch Napoleon im Jahre 1809.
Verlagsinformation |
|
|
Mainfränkisches
Jahrbuch für Geschichte und Kunst, 2005. Herausgegeben von den
Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg.
Gesamtherstellung: HartDruck GmbH, Volkach 2005. ISSN: 0076-2725. |
|
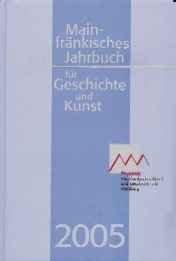
|
Aus dem Vorwort
Das vorliegende Jahrbuch ist sehr umfangreich, es enthält einige
längere Aufsätze. Die Publikation dieses Jahrbuchs war nur durch
einen finanziellen Kraftakt möglich. Ich bin froh, dass es
gelungen ist, das ganze Spektrum der unterfränkischen Geschichte
vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit zu berücksichtigen. Im
Jahre 2005 gedachte man in Deutschland dem 60. Jahrestag des
Kriegsendes. Den letzten Kriegsjahren sind einige Aufsätze
gewidmet, die interessante neue Aspekte der unterfränkischen
Geschichte beleuchten. Gemäß dem Auftrag der Vereinssatzung werden
auch kunstgeschichtliche Themen gebührend berücksichtigt.
Herbert Schott, Schriftleiter
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Gerhard Wagner: Der fränkische Königshof Herlheim
- Thomas Steinmetz: Neues zu den Maintalburgen Ravensburg,
Falkenberg und Neuenburg
- Ludwig Reusch: Die vierherrische Zent Mittelsinn - Zweiter Teil
- Hubert Emmerig: Münzen der Stadt Hammelburg im 16. Jahrhundert?
- Markus Josef Maier: Jost Ammann (1539-1591) als Portraitist
zweier Würzburger Persönlichkeiten
- Matthias Löffelmann: Balthasar Neumanns Würzburger
Dominikanerkirche (heutige Augustinerkirche)
- Victor Metzner: Franz Erwein von Schönborn und seine Bedeutung
- Hans-Bernd Spies: Ein Brief Friedrich Ludwig Heinrich Rumpachs
an Heinrich Stephani (1796)
- Oliver Weinreich und Helge Clausen: Ein Däne an der
Universitätsbibliothek Würzburg
- Walter M. Brod: Eine Würzburg-Ansicht in der Presse des 19.
Jahrhunderts
- Hanns-Helmut Schnebel: Johann Reiter, Hammelburgs letzter Türmer
(1804-1886)
- Jörg Seiler: Ungeliebte Würzburger zwischen Ausgrenzung,
Auswanderung, Ausbürgerung und Deportation (1933-1944)
- Astrid Freyeisen: Verbohrt bis zuletzt – Gauleiter Dr. Otto
Hellmuth
- Herbert Schott: Würzburg zwischen Stalingrad und dem Kriegsende
- Ellen Latzin: Begegnung mit Tiepolo in New York
- Gottfried Mälzer: Die Universitätsbibliothek Würzburg als
Regionalbibliothek
- Bibliographie Dr. Gottfried Mälzer, Leiter der
Universitätsbibliothek
- Anzeigen und Besprechungen
- Geschäftsbericht
- Mitarbeiterverzeichnis
Verlagsinformation
Exemplare des "Mainfränkischen Jahrbuchs" können für
43,50
Euro
direkt im
Buchladen Neuer Weg
gekauft oder bestellt werden.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Birgit Speckle: Schafkopf und
Musikbox.
Einblicke in unterfränkische Dorfwirtshäuser 1950-1970. Verlag:
Bezirk Unterfranken 2005. ISBN: 3-9809330-0-8. |
|
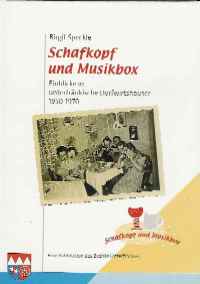
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Im Dorfwirtshaus der 1950er/1960er Jahre herrschte reges Treiben:
Am Sonntagnachmittag füllten die Schafkopf-Runden die ganze
Wirtsstube. Im Wirtshaus saß man nicht nur gemütlich zusammen,
sondern hier wurden Geschäfte gemacht, Aufträge vergeben und
politische Debatten geführt, aber auch Vorträge und
Lehrveranstaltungen abgehalten. Viele Wirtshäuser hatten im
Obergeschoss auch einen Tanzsaal, der als Vorläufer der Mehrzweck-
und Sporthalle bezeichnet werden kann. Hier machte das Wanderkino
Station und hier wurden sämtliche Vereinsfeiern abgehalten.
Gesellschaftliches Großereignis aber war die alljährliche
Kirchweih.
Das Dorfwirtshaus stand häufig auch für Innovationen. Die
Wirtsleute hatten Geräte angeschafft, die sich noch nicht
jedermann im heimischen Haushalt leisten konnte, nämlich Telefon
und Fernseher. Darüber hinaus galten in einer Zeit ohne
Diskotheken oder Spielhallen auch Musikbox, Geldspiel- oder
Unterhaltungsautomaten als echte Attraktionen. Dorfwirtshäuser
waren in den 1950er/1960er Jahren für alle gesellschaftlichen
Schichten und für Jung und Alt der Treffpunkt schlechthin.
Die goldene Zeit der Dorfwirtshäuser ist seit etwa den 1970er
Jahren vorbei und damit auch ihre Funktion als wichtiger Teil
öffentlicher Dorfkultur. Für den Niedergang der Dorfwirtshäuser
gibt es mehrere Gründe: Der Fernseher, den sich in den 1970er
Jahren bald jedermann leisten konnte, förderte den Rückzug ins
heimische Wohnzimmer. Die nach und nach entstehenden Vereinsheime,
Bürgerzentren, Pfarrheime und die aufkommende Mode, viele Feste in
den privaten Bereich zu verlagern, etwa in Form der
"Keller-Partys" an der Hausbar, waren und sind eine ernste
Konkurrenz für die Dorfwirtshäuser.
Darüber hinaus ermöglichte das Auto mehr Mobilität. Das Auto
eröffnete etwa ab den 1970er Jahren auch weiter entfernt liegende
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, für Jugendliche insbesondere
Diskotheken. Damit verlor der Tanzsaal im Dorfwirtshaus nach und
nach seine zentrale Bedeutung. Dazu kamen ausländische
Spiellokale, die einen neuen, exotischen Reiz hatten. Dazu
gehörten Betriebe, in denen zunächst italienische, später auch
griechische und asiatische Spezialitäten angeboten wurden.
Rezension
"Die Beat- und Rockjahre haben leider keinen nachlesbaren Eindruck
in dieser Geschichte der unterfränkischen Dorfwirtshäuser
gefunden, der Band bleibt auch eher im zeitlichen Bereich 1950 bis
Anfang der 60er Jahre, zwischen Schlager, Rock’n’Roll und Twist.
Dafür entschädigt aber eine umfangreiche weiterführende
Literaturangabe zur ländlichen Gasthaus-, Freizeit- und
Jugendkultur, die zur Selbstvertiefung in dieses Thema und in
diese Kultur auffordert. Beim Lesen entwickelt sich neben dem
Hochkommen eigener Jugenderinnerungen an verbrachte Gasthauszeiten
auch die große Lust auf eine Radtour durchs fränkische Land mit
dem Erkundungsmotto 'Kirchen von außen, Wirtschaften von innen'.
Das ca. 70 Seiten umfassende und gut bebilderte Bändchen liefert
den Stoff dazu und das auf eine äußerst kurzweilige Weise." (Pro-Regio-Online,
RegioLine)
Verlagsinformation |
|
|
Herbert Haas: Mittelalterlicher
Weinanbau in der 'villa Randersacker' und dem südlichen
Maindreieck. Eine ungewöhnliche Weinstory. Verlag Königshausen
& Neumann 2005. ISBN: 3-8260-3169-5. |
|
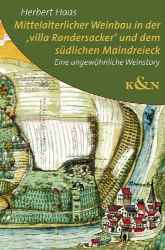
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der Verfasser, dem keine Wengertsarbeit fremd, schildert den
mittelalterlichen Weinbau des südlichen Maindreiecks im
Allgemeinen und die damit verbundenen Randersackerer Begebenheiten
im Besonderen. Der spannende Krimi über die wechselvollen 800
Jahre fränkischen Weinbaues geht von den Anfängen in der Zeit
Karls des Großen bis zur maximalen Ausdehnung der Rebfläche auf
etwa 40.000 Hektar im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, der
Ära Julius Echters von Mespelbrunn.
Die Häcker entblößen sich ihres Grundbesitzes, verarmen und
mutieren vom Eigentümer zum notleidenden Lehensnehmer, das
Weinproletariat entsteht. Eine beginnende, lange währende
Kaltzeit, die den hochgeschätzten Frankenwein zum "Sauerländer"
stigmatisiert, beendet die weitere Verbreitung der Vitis vinifera
und läutet den 400 Jahre währenden Niedergang ein. Rückschlüsse
auf das 20. Jahrhundert und aktuelle Bezüge zur Gegenwart ergänzen
die unterhaltsame, farbige Schilderung der außergewöhnlichen
Wein-Gezeiten.
Aus dem Inhalt
- Die Wanderjahre der Weinrebe und ihre Einbürgerung in
mainfränkischen Gefilden
- Vom Wingarton zum Winperch: Die Rebe klettert den Berg hinauf.
Zeitgleiche Beurkundung von Würzburger und Randersackerer
Weinlagen ab 1050
- Der Weinmotor Randersacker springt an, läuft und läuft ... Wein,
der hochoktanige Kraftstoff zur zügigen Dorfentwicklung
- Die Weinbergsarbeit, ein unaufhörlicher Kampf gegen Unkraut und
Schädlinge. Das Ende der Vielfalt im Lebensraum Weingarten
- Die Häufung der herrschaftlichen Erlasse im 14. Jhd. Randesacker
anno 1350 mit eigener Zehnt- und Leseordnung
- Der mittelalterliche Qualitätsweinbau, Rebsorten, Realteilung
und Kopferziehung
- Klöster saugen den Grundbesitz auf. Die Häcker verarmen.
Würzburger plündern den Randersackerer Edelhof
- Die Rebe als Baum der Erkenntnis? Der Tausendsassa Wein,
wichtigste Arzney des Mittelalters
- Der Bauernkrieg, der Augsburger Religionsfriede und die
Zweiteilung Randersackers
- Die Ära Julius Echter von Mespelbrunn. Wer nicht kommunizieren
kommt, muss gehen
- Franken mit 40.000 Hektar größtes deutsches Weinland. Erblühende
dörfliche Baukultur im 16. Jhd.
- Die 300-jährige Kaltzeit beginnt, mit dem Weinbau geht's bergab.
Der Wein ist stocksauer.
- Quellen und Literaturverzeichnis
Verlagsinformation |
|
|
Stefan Keppler/Johann
Schrenk/Horst Brunner/Otto Wittmann: Goethes Franken.
Johann-Schrenk-Verlag 2005 (1. Auflage). ISBN: 3-924270-41-4. |
|
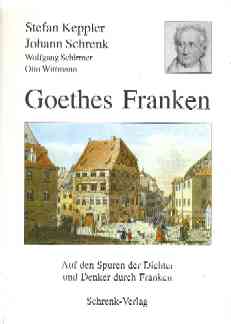
mehr Infos
bestellen
|
Aus dem Inhalt
Johann Schrenk legt mit "Goethes Franken" den dritten Titel aus
der Buchreihe "Auf den Spuren der Dichter und Denker durch
Franken" vor. Mit dem 128 Seiten fassenden, reich bebilderten und
illustriertem Werk ist ein kompakter, preislich erschwinglicher
Reiseführer auf den Markt gekommen, dessen ausgewogene Mischung
wissenschaftlicher Aufsätze einerseits und ausführlicher
touristischer Informationen andererseits deutlich von der Masse
abhebt.
Wie schon in den zwei vorherigen Büchern der Reihe (sie wurden
jeweils in der Druckerei E. Riedel gefertigt) hat Dr. Schrenk auch
dieses Mal kompetente und anerkannte Wissenschaftler als Koautoren
gewonnen. Der Leser ist eingeladen, diesen Landstrich zu bereisen
und ihn sich zu eigen zu machen, wie der Dichter aus Weimar es
tat: "Goethes Franken" heißt es deshalb statt "Goethe in Franken".
Inhaltsverzeichnis
- Stefan Keppler: Goethes Franken – Topographie des Altdeutschen
- Johann Schrenk: Goethe in Nürnberg
- Johann Schrenk: Goethe im Fichtelgebirge
- Wolfgang Schirmer: Goethes Granitstudien in Franken und seine
Idee Granit
- Johann Schrenk: Goethes Reisen durch Franken
- Otto Wittmann: Goethe und der Frankenwein
- Johann Schrenk: Auf den Spuren Goethes durch Franken
Zu den Autoren
Reich bebildert und inspirierend sind die Kapitel, in denen der
Gunzenhäuser Buchhändler, Verleger und Historiker Dr. Johann
Schrenk auf Goethes Spuren quer durch Franken, ins Fichtelgebirge,
und nach Nürnberg reist, um Häuser, Museen und Naturdenkmäler, die
an den vielseitig interessierten Genius erinnern, vorzustellen.
Dr. Stefan Keppler, gebürtiger Franke, ist Assistent am Institut
für Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität
Berlin. 2004 promovierte er an der Universität Würzburg über
Goethes Erzählwerk. Von ihm stammt das erste Kapitel über die
"Topographie des Altdeutschen".
Professor Dr. Wolfgang Schirmer, bis 2005 an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als Geologe tätig,
vergleicht anhand einer ausführlichen Grafik die Vorstellung
Goethes von der Entstehung des Fichtelgebirgsgranits, die er in
vielen Exkursionen vor Ort gewonnen hatte, mit den
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus heutiger Zeit.
Der Gunzenhäuser Dr. Otto Wittmann, von 1989 bis 1993 Präsident
des Bayerischen Geologischen Landesamtes München, setzt sich in
seinem Aufsatz mit Goethe und dem Frankenwein auseinander.
Verlagsinformation/"Altmühl-Bote" vom 10.12.2005 |
|
|
Konrad Beischl: Dr. med. Eduard
Wirths und seine Tätigkeit als SS-Standortarzt im KL Auschwitz.
Königshausen & Neumann-Verlag 2005. ISBN: 3-8260-3010-9. |
|
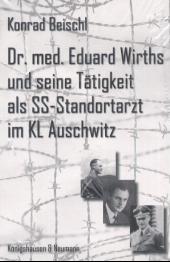
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung des
Medizinstudenten und jungen Mediziners Eduard Wirths (1919-1945)
zu einer der Schlüsselfiguren des Vernichtungsapparates im KL
Auschwitz. Wirths wurde 1919 als Sohn eines mittelständischen
Unternehmers in Geroldshausen, nahe Würzburg, geboren. Noch
während des Studiums trat er in die NSDAP, die SA und später die
SS ein. Beim Fronteinsatz in Norwegen und der Sowjetunion zog er
sich ein Herzleiden zu. Dies führte zu seiner Versetzung zur
"Inspektion K.L." – zum Einsatz in den Konzentrationslagern. Hier
machte Wirths innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere und
wurde – mittlerweile SS-Obersturmführer – Standortarzt des
riesigen Lagerkomplexes Auschwitz. Er war der verantwortliche
Organisator der Selektionen der jüdischen Häftlinge an der "Rampe"
von Auschwitz-Birkenau. Über alle medizinischen Experimente, die
an Häftlingen durchgeführt wurden, war er informiert und
initiierte selbst eigene Versuchsreihen. Sein Häftlingsschreiber
Hermann Langbein, österreichischer Kommunist und aktiv im
Lagerwiderstand, gewann allmählich Einfluss auf Wirths und konnte
dies geschickt für die Widerstandsbewegung ausnutzen. Wirths, der
von Langbeins Verbindung zum Widerstand wusste, ließ Langbein
gewähren, blieb jedoch selbst bis zuletzt loyal gegenüber dem
nationalsozialistischen Deutschland. Insgesamt ergibt sich ein
zwar widersprüchliches Bild, aber doch das Bild eines Mannes, der
dem faschistischen System nichts entgegen zu setzen hatte.
Zum Autor
Konrad Beischl, geboren 1969, ließ sich zunächst zum Gärtner
ausbilden. Anschließend studierte er Humanmedizin in Regensburg.
Derzeit ist er als Assistenzarzt an der Schlossklinik Rottenburg
a.d.L. tätig.
Verlagsinformation |
|
|
Klaus Gasseleder: Zwei
Gesichter.
Aus der Chronik einer jüdischen Familie, eines fränkischen Dorfes
und eines Weltbades in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Vetter-Verlag, Geldersheim 2005. ISBN: 3-9807244-6-8. |
|
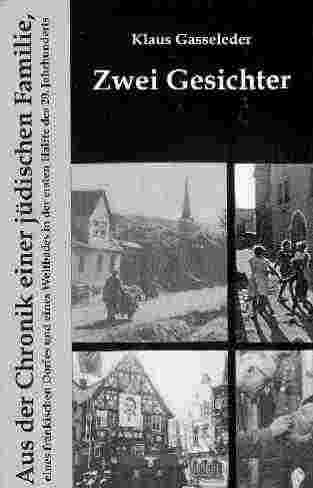
mehr Infos
bestellen
|
Schön wie je liegt das Städtchen – im Stil der Propaganda
ausgedrückt: ein köstlicher Juwel, zusammengesetzt aus den bunten
Edelsteinen seiner grünen Gärten, seiner herrlichen Blumenanlage
und seiner heiteren Häuser, am goldgrünen Band der Saale (die das
tatsächlich einmal war, aber jetzt – die Gründe kenne ich nicht –
fast stehend sumpfig und recht dürftig aussieht) zärtlich umfasst
von dem saftigen Grün seine Wiesen und dem dunkleren seiner
dahinter aufsteigenden Wälder.
Trotz allem, ich muss gestehen, dass auch ich immer es so gesehen
hatte. Und dass mir eine Sehnsucht geblieben war. Denn Kissingen
und meine Jugend gehören zusammen, so wie Steinach und meine
Kindheit. Eine Jugend, die ich für herrlich gehalten hatte. Diese
Herrlichkeit aber war von den späteren Ereignissen her fragwürdig
geworden. Alle Schönheit ihrer Erlebnisse hatte als Basis gehabt
den nie in Frage gezogenen Glauben an die Unwandelbarkeit
menschlicher Ordnungen – den Glauben, dass der Mensch gut sei. Die
schlechten waren nur Ausnahmen, und auch sie würden allmählich
besser werden!
Nun hatte es sich herausgestellt, dass dieser Glaube die
leichtfertige Sicherheit der Jahrhundertwende war, möglich
geworden durch eine ungewöhnlich lange Friedenszeit, die durch die
beiden Weltkriege – und ganz erbarmungslos durch das Grauen des
"Dritten Reiches" – für alle Zeiten von Grund auf zerstört ist.
Übrig geblieben ist das Bild des Menschen in seiner
Jämmerlichkeit, seiner Gefährdetheit von innen heraus, wenn äußere
Ordnungspfeiler zusammengebrochen sind. Kissingen hat uns
verraten. Die Menschen hatten andere Gesichter bekommen, eiserne
statt der freundlichen, Und beide scheinen wahre Gesichter gewesen
zu sein, jedes zu seiner Zeit.
Klappentext |
|
|
Lothar Mayer: Heimat Rhön.
Naturhistorische Wanderbilder aus der Hohen Rhön. Mit zahlreichen
Farbfotos. Parzeller-Verlag 2004. ISBN: 3-7900-0364-6. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Lothar Mayers "Heimat Rhön" bietet auf 179 Seiten naturhistorische
Wanderbilder aus der Hohen Rhön. Der farbige Bildband enthält
zudem Wanderwegebeschreibungen. Genau genommen handelt es sich bei
dem Werk "Heimat Rhön" nicht um ein Wanderbuch klassischer
Prägung, sondern vielmehr um die Darstellung einer großartigen
Landschaft.
Wäre die Rhön nicht die Heimat des Bild- und Textautors, wäre der
Titel "Panorama Rhön" ebenfalls angebracht.
Die Bilder zeigen nämlich die genialische Monotonie und Weite der
Hohen Rhön. Der Text enthält feinsinnige Anregungen zum "Gebrauch"
der Landschaft; er bringt Dinge zur Sprache, die man einfach
wissen muss, wenn man das Land wirklich verstehen will und lädt
dazu ein, die Rhön unermüdlich mit weit offenen Sinnen und wachem
Blick zu durchstreifen. Das Credo aller naturhistorischen
Wanderbilder lautet: Zum Wandern nimm die Seele mit.
"Heimat Rhön" ist somit ein idealer Helfer für die Einstimmung auf
eigene Wanderunternehmungen. Dabei geht der Autor auch über die
Beschreibung der Landschaft und deren "Gebrauch" hinaus. Eine
kritische Reflexion über die konkrete Bedeutung der "Heimat" in
moderner Zeit und insbesondere in der Hohen Rhön beschließt das
Buch.
Zum Autor
Lothar Mayer wurde im Jahre 1950 in Wüstensachsen/Rhön geboren.
Seit 1994 ist er Geschäftsführer und Inhaber der Firma A. Eberle
GmbH & Co. KG (http://www.a-eberle.de/)
in Nürnberg und lebt in Wendelstein. Das Unternehmen entwickelt,
fertigt und vertreibt elektronische Einrichtungen für die
Energie-Versorgungsunternehmen.
Seit 35 Jahre ist Mayer im Naturschutz tätig und war von 1990 bis
2002 Obmann der Entomologischen Abteilung der Naturhistorischen
Gesellschaft in Nürnberg (NHG). Für das Buch "Heimat Rhön" wurde
er im Jahre 2005 von den "Sennfelder Kulturwanderern"
ausgezeichnet.
Verlagsinformation |
|
|
Albert Uderzo/René Goscinny:
Di Fråche der Ehre (Asterix und der Kupferkessel,
unterfränkische Ausgabe). Übersetzt von Kai Fraass, Gunther Schunk
und Hans-Dieter Wolf. Egmont Ehapa-Verlag 2004. ISBN:
3-7704-2297-X. |
|
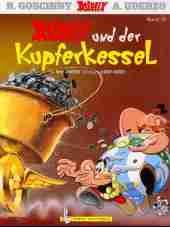
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Ein Jahr nach der "Dour de Frångn" sind Asterix und Obelix zum
zweiten Mal in Mainfranken aktiv. "Di Fråche der Ehre" heißt der
zweite Asterix-Band im mainfränkischen Dialekt. Verantwortlich für
die Übersetzung sind Dr. Gunther Schunk, Kai Fraass und
Hans-Dieter Wolf. Wie im Original "Asterix und der Kupferkessel"
geht es in der Geschichte ums Geld, und zwar um das nicht
vorhandene Geld der Stadt Würzburg. Nachdem die Geschichte bis
nach Aschaffenburg reicht, wurde als kompetenter "Gastsprechenblasenbefüller"
der Kabarettist Urban Priol engagiert. Natürlich gibt es auch
wieder – selbstverständlich rein zufällige – Anspielungen auf
Personen des Zeitgeschehens. So kann man in der Geschichte
beispielsweise dem Wirt Müllrum-Reibachum oder dem Schauspieler
Ingus Klündrian begegnen.
Zu den Autoren
Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem
Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung
eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten
Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich
abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René
Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als
Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".
René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos
Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als
Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem
Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ
Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur
einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf
sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für
Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky
Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und
"Asterix" (mit Uderzo).
Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.
November 1977.
Verlagsinformation
Weitere Informationen
Signierstunde im
Buchladen Neuer Weg am 27.11.2004 |
|
|
Karlheinz
Deschner: Dornröschenträume und Stallgeruch. Über Franken, die
Landschaft meines Lebens. Königshausen & Neumann-Verlag 2004.
ISBN: 3-8260-2801-5. |
|
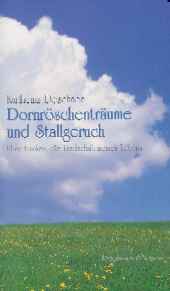
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der wohl bedeutendste Kirchenkritiker unserer Zeit, Karlheinz
Deschner, zeigt sich hier einmal von einer ganz anderen Seite.
Fasziniert von dem, was Franken (noch) an den Himmel schreibt,
Steigerwald, Spessart, Frankenwald und Fichtelgebirge, erzählt er
vor allem von der Landschaft, der er sich tief verbunden weiß. Er
porträtiert kleine Perlen am Main, in denen das Mittelalter
fortzuträumen scheint, Dettelbach etwa, Prichsenstadt, Sulzfeld,
Mainbernheim, aber auch Bamberg, die schönste Stadt Deutschlands,
entlegene Haßberge-Nester.
Immer wieder dazwischen gallig-bissige Geschichten, politische
Reminiszenzen; Frankens Vergangenheit und aktuelle Gegenwart: Die
fränkische Kirche erscheint, eine Sekte, der lokale Adel; nicht
zuletzt auch die eigene Lebensgeschichte des Erzählers, doch immer
das Ganze fast hymnisch durchwoben von eindringlichen
Landschaftsbeschreibungen. Kurz: eine stimmungsdichte,
poesiereiche, doch oft auch kritisch-ironische Betrachtung, voll
von Lobpreis und Verdammnis.
Rezensionen
"Kein Reise- oder Kunstführer ist da in verschiedenen poetischen
Feuilletons entstanden, die hier in einem Buch zusammengefügt
werden. Es ist eher ein Vademekum für ... Genussfreunde."
(Süddeutsche Zeitung)
"Deschner wäre nicht Deschner, schockierte er nicht den gerade in
lyrischen Schilderungen gefangenen Leser mit knallhart
dazwischenfahrenden Fakten aus Frankens dunkler, blutiger
Historie." (Frankfurter Rundschau)
"Karlheinz Deschners nachträgliche Liebeserklärung an Franken
–
ein nostalgisches, romantisches, gar idyllisches Bekenntnisbuch
eines Theoretikers? Nun, Karlheinz Deschners neun
Landschaftsporträts aus Franken fügen sich zu einem hymnischen und
doch leidenschaftlich provokanten Heimatbuch, das fränkische
Literaturgeschichte, regionales Geschichtsbuch, Autobiographie und
literarischer Reisebericht zugleich ist." (Bayerisches Fernsehen)
Zum Autor
Karlheinz Deschner, geboren 1924 in Bamberg. Im Krieg Soldat;
studierte Jura, Theologie, Philosophie, Literaturwissenschaft und
Geschichte. Sein Roman -Die Nacht steht um mein Haus- (1956)
erregte Aufsehen, das sich ein Jahr später bei Erscheinen seiner
Streitschrift -Kitsch, Konvention und Kunst- zum Skandal
steigerte. Seit 1958 veröffentlicht Deschner seine entlarvenden
und provozierenden Geschichtswerke zur Religions- und
Kirchenkritik. Der forschende Schriftsteller lebt in Haßfurt am
Main. 1988 wurde er mit dem Arno-Schmidt-Preis ausgezeichnet.
Verlagsinformation |
|
|
Albert Uderzo/René Goscinny: Dour
de Frångn (Tour de France, unterfränkische Ausgabe). Übersetzt von
Kai Fraass, Gunther Schunk und Hans-Dieter Wolf. Egmont
Ehapa-Verlag 2004. ISBN: 3-7704-2295-3. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Es is fuchzich vor, a glees Völkle in Underfrångn wärd schon lång
underdrüggd vo der Kapitale im Süden. Aber unbeuchsam wie se sin,
tun se alleweil amål aufbegehr. Mid ihrn Mädschigg-Schoppen in der
Hinderhand hamm se halt ihr Subber-Geheimwaffm baråt. Ihr wissd
scho, di Brüh, wu der Obelix als Bu neigfloche is. Un der Asterix
kriechd alsemål aa sei Schlüggle ab, – un dann gibt's Wallung!
Brunzverreck!
Des erschde Asterix-Bändle aus Underfrångn hamm übersetz gemüss
der Fraass Kai, der Schunks Gunther und der Wolfs Hans-Dieter.
Büngtlich zum Stadtjubiläum zeicht Euch der Obelix, wu er den
Mousd holt.
Zu den Autoren
Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem
Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung
eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten
Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich
abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René
Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als
Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".
René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos
Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als
Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem
Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ
Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur
einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf
sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für
Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky
Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und
"Asterix" (mit Uderzo).
Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.
November 1977.
Klappentext |
|
|
Jeanne E. Rehnig:
Schäfereigeschichte(n): Einblicke in die Geschichte der
Schafhaltung in Unterfranken. Bezirk Unterfranken 2004. ISBN:
3-9809330-1-6. |
|
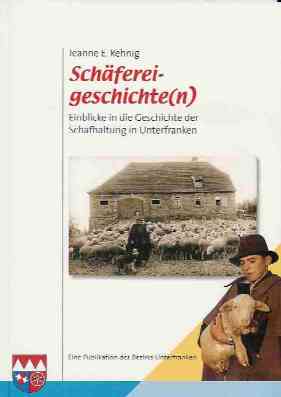
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Wer einmal längere Zeit mit einem Schäfer verbracht hat, stellt
fest, dass in jedem von ihnen eine ganze Welt von Bildern, Wissen
und Geschicklichkeiten steckt. Allein die Beobachtung der Tiere
und der Natur und die Notwendigkeit, sich stets selbst helfen zu
können, füllen einen solchen Menschen an mit Erfahrungen und
Erkenntnissen, die ganze Bibliotheken bestücken könnten. Seit
Jahrhunderten werden Wissen, Kniffe und Fachausdrücke von einer
Generation an die nächste übergeben.
Wie Schäfer in früheren Jahrhunderten gelebt und gearbeitet haben,
ist ein bisher wenig erforschtes Kapitel der unterfränkischen
Agrargeschichte gewesen. Die Ausstellung "Schäfereigeschichte(n)"
gibt als erste umfassende Arbeit zu diesem Thema Einblicke in die
historische Schäferkultur eines Naturraums, der Unterfranken heißt
und der auch schon vor Jahrhunderten zu den schafreichen
landstrichen in Deutschland zählte. Die Hinwendung zu diesem Thema
durch die Bezirksheimatpflege sichert damit wertvolles Material.
Zu den Autorinnen
Dr. Jeanne E. Rehnig M.A. (Berlin), geboren in Würzburg,
aufgewachsen in Kitzingen, studierte Volkskunde, Kunstgeschichte
und Germanistik in Würzburg. Ausbildung zur
Multimedia-Projektmanagerin, Promotion zur Dr. phil. Langjährige
Mitarbeiterin der Redaktion Kultur der Main-Post, Würzburg.
Freiberuflich tätig in den Bereichen Text, Konzeption und
Gestaltung von Ausstellungen. Projekte für öffentliche Träger,
private Auftraggeber und große Projektgesellschaften.
Vorträge und Veröffentlichungen zur Industrie-, Regional- und
Fotografiegeschichte sowie zur Bildenden Kunst. Gastvorträge an
der FHTW Berlin, Fachbereich Museologie.
Christine Schormayer (Hammelburg), geboren in Würzburg,
aufgewachsen in Kitzingen, ist seit Abschluss ihrer Ausbildung im
Buchhandel tätig. Veröffentlichungen, Führungen und Vorträge zur
Botanik, Schäferei- und Regionalgeschichte. Autorin der
Wanderausstellung "Schäferei heute – Wunschbild und Wirklichkeit"
(2002).
Verlagsinformation |
|
|
Marianne Erben: Von Kilian
bis Kiliani. Den Frankenaposteln auf der Spur. Echter-Verlag
2004. ISBN: 3-429-02579-6. |
|
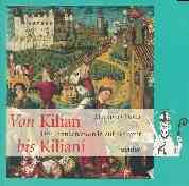
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Würzburg wird die Kiliansstadt genannt. Da steht
der Kiliansdom, gleich daneben Neumünster mit dem Kiliansschrein
über dem Kiliansgrab in der Kiliansgruft, und dazwischen der
Kiliansplatz mit einer Kiliansstatue und dem Kilianshaus. In der
Domstraße werden beim Kiliansbäck Kiliansweck angeboten, auf der
Alten Mainbrücke ist der hl. Kilian die meistfotografierte Figur,
und am 8. Juli, dem Kilianstag, kommen die Kilianswallfahrer und
besuchen nach dem Gottesdienst die Kiliansmesse auf dem Marktplatz
und das Kilianifest auf der Talavera. Wer also war Kilian? In
diesem Buch soll von ihm berichtet und erzählt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Tatsache – Legende
- Passio Sancti Kiliani
- Aus Irland ist Kilian gekommen
- Vom Aussehen irischer Wandermönche
- Das östliche Frankenland
- Wirciburc – der fremde Ort
- Warum Kilian, Kolonat und Totnan sterben mußten
- Das Martyrium
- Strafgericht und Ende der Herzogsfamilie
- Bischof Burkard
- Drei Heilige
- Wunder am Kiliansgrab
- Ein erster Dom
- Das Kiliani-Fest
- Wallfahrer – Steuerzahler
- Das Kiliansbanner
- Der Heilige mit dem Schwert
- Nicht immer hoch verehrt
- Eine besondere Wallfahrt
- Der neue Kiliansschrein
- Kilian wirkt fort
Verlagsinformation |
|
|
Felix Fechenbach/Roland Flade: Im Haus
der Freudlosen. Als Justizopfer
im Zuchthaus Ebrach. Königshausen
& Neumann-Verlag 1993.
ISBN: 3-88479-851-0. |
|
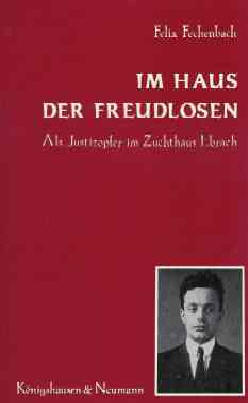
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Wie kaum ein anderer ist der in Würzburg
aufgewachsene Felix Fechenbach in die Geschichte der Weimarer
Republik verwoben. Als enger Mitarbeiter des späteren
Ministerpräsidenten Kurt Eisner rief er im November 1918 in
München die Revolution aus. Als Journalist veröffentlichte er
Dokumente zur Entstehung des Ersten Weltkriegs und wurde dafür
1922 in einem Schauprozess von der bayerischen Justiz zu einer
langjährigen Haftstrafe verurteilt. Als Insasse des Zuchthauses
Ebrach studierte Fechenbach die Auswirkungen des veralteten
Strafvollzugs auf sich und seine Mithäftlinge. In diesem Buch
berichtet er von Menschen, "die zermalmt werden von all dem Leid,
der Entseelung und Entwürdigung" und plädiert für durchgreifende
Vollzugs-Reformen.
Zum Autor
Felix Fechenbach, geboren 1894 in
Mergentheim, absolvierte nach einer
dürftigen Schulausbildung
eine Lehre in einer Schuhwarengroßhandlung;
erste Kontakte zur Gewerkschaft und zur sozialdemokratischen
Jugend. Umzug nach München, dort im Arbeitersekretariat (Vorläufer
gewerkschaftlicher Rechtsberatung) beschäftigt. Nach der
Novemberrevolution 1918 wurde er Sekretär
des Ministerpräsidenten Kurt Eisner. Nach Eisners Ermordung wurde
er in einem skandalösen Prozess wegen
angeblichem Landesverrat zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt (Es
ging um Veröffentlichungen zur Kriegsschuld Deutschlands).
Vorzeitig entlassen, ging er nach Berlin
und war in der reformpädagogischen Bewegung aktiv. 1929 trat er
eine Stelle als Redakteur der sozialdemokratischen Zeitung in
Detmold an. Er schrieb mit spitzer Feder gegen die Nazis und
beteiligte sich als Redner an den Wahlkämpfen in dem damals noch
selbstständigen Land Lippe. Dies und seine Beteiligung an der
Revolution 1918 sowie seine jüdische Abstammung machte ihn unter
den Nazis im östlichen Westfalen und Lippe zur meistgehassten
Person. Kurz nach Hitlers Machtübernahme wurde er
in NS-"Schutzhaft" genommen und als eines
der ersten Opfer des Nazi-Regimes am 7. August 1933 von SS-Mitgliedern bei einem
angeblichen "Fluchtversuch" ermordet.
Der Historiker Dr. Roland Flade
leitet die Lokalredaktion der Würzburger
Main-Post. Mehrere Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation |

Felix Fechenbach als junger Mann

Felix Fechenbachs
Journalistenausweis
für den Berliner Reichstag |
|
|