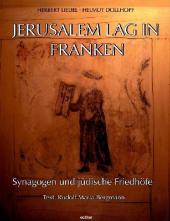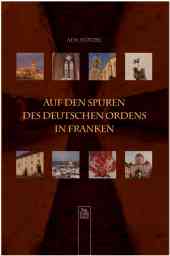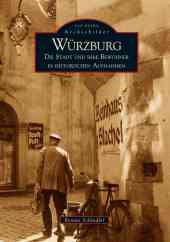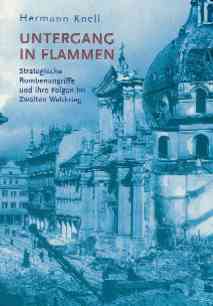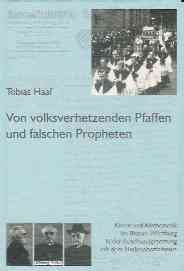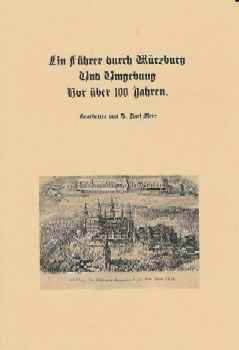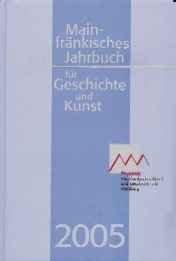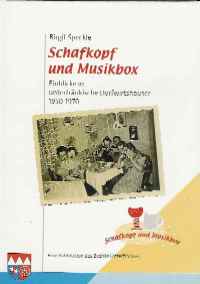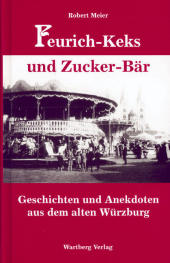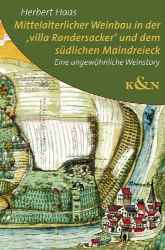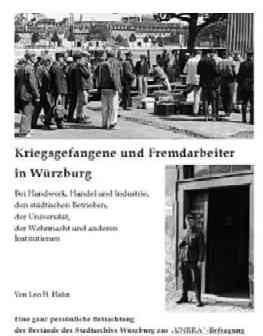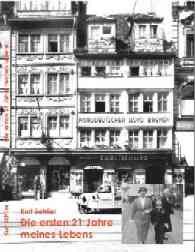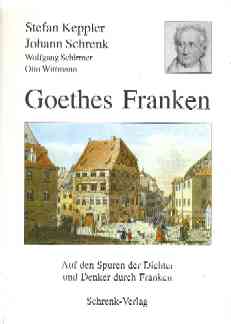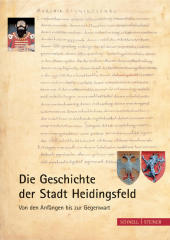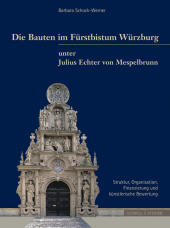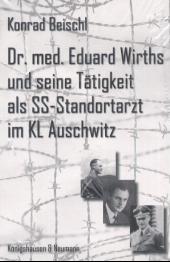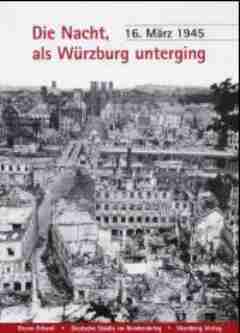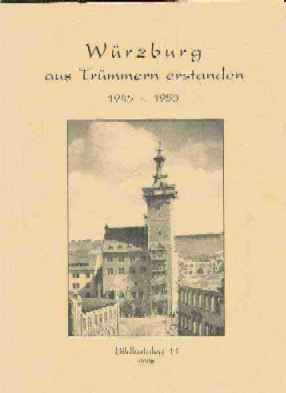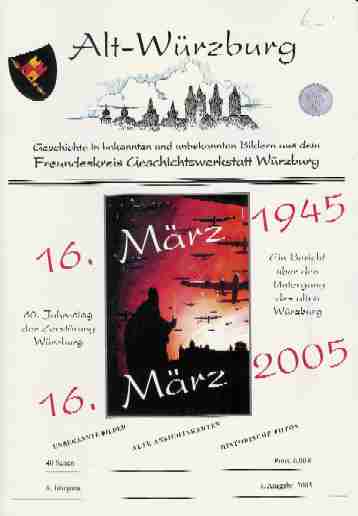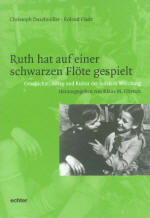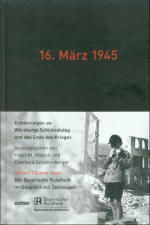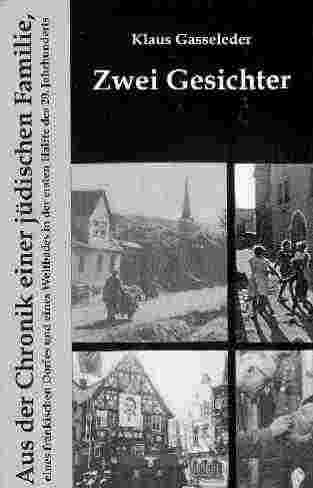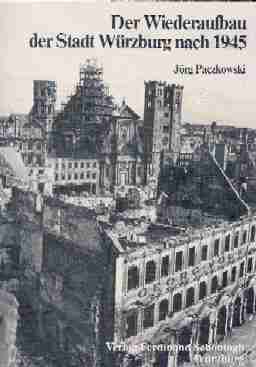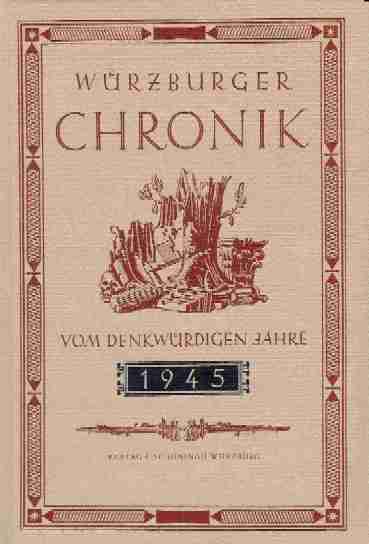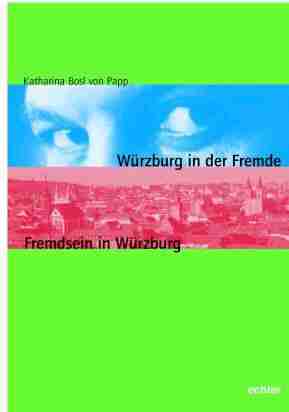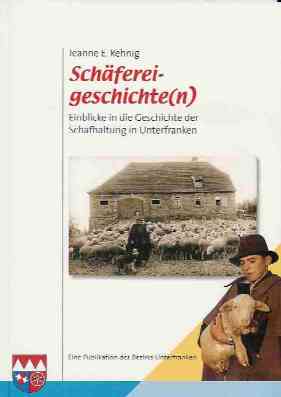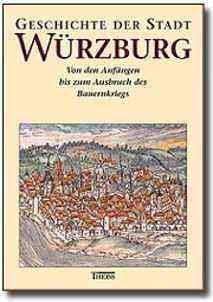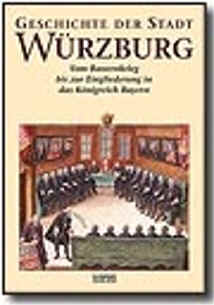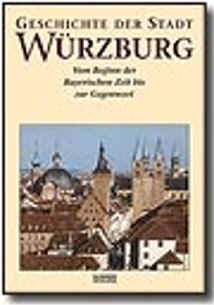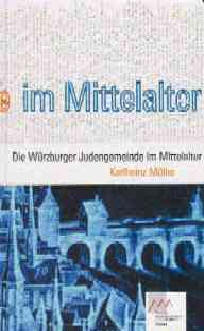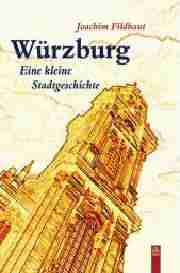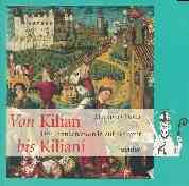|
Geschichte aktuell
(Bücher 2004-2006) |
|
|
|
Herbert Liedel/Helmut Dollhopf/Rudolf
M. Bergmann: Jerusalem lag in Franken. Synagogen und jüdische
Friedhöfe. Echter-Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 3-429-02826-4. |
|
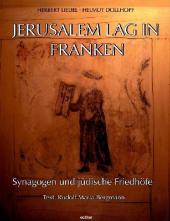
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Bei der Beschäftigung mit den Folgen der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft waren die Fotografen Herbert Liedel und Helmut
Dollhopf auf die noch erhaltenen Synagogen und Friedhöfe
aufmerksam geworden. Nicht wenige präsentierten sich
zweckentfremdet oder verwahrlost. In jüngster Zeit sind viele
dieser Friedhöfe wiederhergerichtet. Synagogen restauriert, und
einer neuen, würdigen Bestimmung zugeführt worden. So finden dort
nicht nur Mahn- und Gedenkgottesdienste, sondern auch kulturelle
Veranstaltungen statt.
"Jerusalem lag in Franken – Synagogen und jüdische Friedhöfe"
dokumentiert die tragische Geschichte jüdischer Gotteshäuser und
-acker repräsentativ über diesen Zeitabschnitt. Gegenübergestellt
werden der Zustand nach dem Ende des Dritten Reiches und das
jetzige Antlitz – teilweise ergänzt durch Schwarzweiß-Aufnahmen
aus der Zeit vor der "Reichskristallnacht" im Jahr 1938.
Der Text liefert den nötigen Hintergrund zu den abgebildeten
Objekten, informiert über Zerstörung. Zweckentfremdung, aber auch
über Erhaltung und neue Bestimmung. So ist dieser Band ein Projekt
gegen das Vergessen und eine Aufforderung, zur Verhinderung neuer
Unmenschlichkeit beizutragen.
Zu den Autoren
Herbert Liedel lebt als Fotograf in Nürnberg. Der Bildautor
zahlreicher Landschaftsbände und anderer Bücher engagiert sich
auch als Filmemacher. Als passionierter Fußball-Anhänger
fotografiert er seit langem für das Kicker Sport-Magazin. Auch
Helmut Dollhopf arbeitet als Fotograf.
Rudolf Maria Bergmann, der Textautor, studierte Kunstgeschichte,
Germanistik und Philosophie. Er arbeitet als freier Journalist und
Publizist, schreibt über Architektur, Kunst und Reisen. Zahlreiche
Veröffentlichung, u.a. in: Baumeister, Bauwelt, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Goethe-Institut Inter
Nationes, Neue Zürcher Zeitung, Rheinischer Merkur, Der
Tagesspiegel, Der Standard, Zeitschrift für Gottesdienst und
Predigt. Verfasser von Baumonografien; Beiträge in Anthologien und
Jahrbüchern. Buchautor. Bergmann lebt in Eichstätt und Wien.
Verlagsinformation |
|
|
Ada Stützel: Auf den Spuren des
Deutschen Ordens in Franken.
Mit zahlreichen zum Teil farbige Abbildungen. Sutton Verlag 2006.
ISBN: 3-89702-990-1. |
|
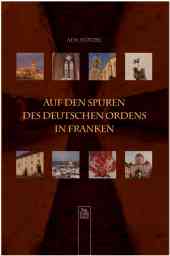
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Über 600 Jahre hat der einst mächtige Deutsche Orden die
Geschichte Frankens mitgeprägt. Er war Herr über Städte, Dörfer
und Burgen und entfaltete seine Macht vor allem in ländlich
geprägten Gebieten. In vielen Orten stellte der Ritterorden einen
beutenden Wirtschaftsfaktor dar. Langfristig prägte er das
religiöse Empfinden der Menschen ganzer Regionen und entwickelte
sich schließlich zu einem festen Bestandteil der fränkischen
Kulturlandschaft. Dennoch sind die historischen Hintergründe
seines Einflusses in Franken heute nahezu in Vergessenheit
geraten.
Die Journalistin Ada Stützel hat sich nun auf Spurensuche begeben
und die bekannten und weniger bekannten fränkischen
Wirkungsstätten des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch,
das sich vor allem auf das heutige Mittel- und Unterfranken
konzentriert, behandelt sie die Zeit von der Niederlassung des
Deutschen Ordens in Franken um 1200 bis zu seiner Auflösung durch
Napoleon im Jahre 1809.
Anhand heute noch sichtbarer Überreste macht dieses reich
illustrierte Buch die Geschichte des Deutschen Ordens wieder
lebendig. Unterhaltsam und kenntnisreich erzählt die Autorin,
welche Ereignisse, Machtkämpfe und Traditionen sich hinter den
immer noch präsenten Spuren des Ordens verbergen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der Deutsche Orden: Ein Abriss seiner Geschichte
- I. Der Deutsche Orden als Herr über Stadt, Dorf oder Burg:
Ellingen, Stopfenheim, Absberg, Virnsberg, Wolframs-Eschenbach,
Gelchsheim, Hüttenheim, Stadtprozelten, Obermässing
- II. Der Deutsche Orden in den freien Reichsstädten: Nürnberg,
Rothenburg ob der Tauber, Detwang, Dinkelsbühl, Schweinfurt
- III. Der Deutsche Orden in Residenz- und Landstädten: Würzburg,
Münnerstadt
- IV. Wissenswertes und Impressionen
- Bildnachweis
- Literaturhinweise
Aus dem Vorwort
Franken ist ein altes Kulturland, Seine Einwohner blicken stolz
auf ihre Geschichte und Traditionen. Stolz sind sie auch auf den
Ort, in dem sie leben - ganz gleich, ob er für den Verlauf der
großen Geschichte von Bedeutung war oder nicht. Zwischen zwei
Orten, die vielleicht nur wenige Kilometer voneinander entfernt
sind, können Welten liegen: sprachliche, traditionelle, religiöse.
Meist wortkarg und zurückhaltend agieren die Franken gegenüber
Fremden. Franken sind bodenständig. Sie bleiben gern zu Hause,
denn dort wissen sie, woran sie sind. Außerhalb ihrer Heimat gibt
es für den Franken in Deutschland nur noch Bayern und Preußen.
Wandert ein Bayer oder Preuße ein, muss er sich bewähren. Bis er
ein Freund wird, kann es eine ganze Generation dauern. Bis er als
Franke akzeptiert ist, muss er schon ein paar Ahnen auf dem
örtlichen Friedhof zu Grabe getragen haben.
Auch in der Geschichte des Deutschen Ordens auf dem Boden des
heutigen Frankens lässt sich ein Schlüssel finden - zum
Verständnis all jener Eigenschaften, die den Franken so
unverwechselbar charakterisieren. Fast 600 Jahre war der Deutsche
Orden Teil des fränkischen Alltags. Er baute Städte, Burgen und
Schlösser, etablierte sich als Wirtschaftsfaktor des Ortes, in dem
er sich niederließ, prägte das religiöse Empfinden der Menschen
ganzer Regionen und wurde schließlich ein fester Bestandteil der
fränkischen Kulturlandschaft. Vieles von dem ist heute leider in
Vergessenheit geraten. Zu Unrecht.
Dieses Buch möchte Sie auf die Spuren führen, die der einst so
mächtige Orden im heutigen Franken hinterlassen hat. Manchmal ist
es nur ein unscheinbarer Gemarkungsstein am Wegesrand, ein anderes
Mal sind es mächtige himmelwärts strebende Sakralbauten. An einem
Ort ist es ein schlichter Verwaltungsbau und an einem anderen eine
beeindruckende Stadtbefestigung oder ein imposantes Barockschloss.
Zur Autorin
Die Journalistin Ada Stützel hat sich auf Spurensuche begeben und
die bekannten und weniger bekannten fränkischen Wirkungsstätten
des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch, das sich vor allem
auf das heutige Mittel- und Unterfranken konzentriert, behandelt
sie die Zeit von der Niederlassung des Deutschen Ordens in Franken
um 1200 bis zu seiner Auflösung durch Napoleon im Jahre 1809.
Verlagsinformation |
|
|
Renate Schindler: Würzburg.
Die Stadt und ihre Bewohner in historischen Aufnahmen. Die Reihe
Archivbilder. Mit 160 meist historische Fotos. Sutton-Verlag,
Erfurt 2006. ISBN: 3-89702-966-9. |
|
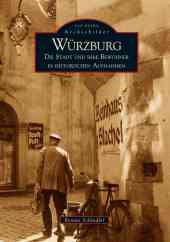
mehr Infos
bestellen
|
Würzburg hat sich im letzten Jahrhundert dramatisch verändert. Bis
zum Ende des 19. Jahrhunderts legte man die Wallanlagen der
barocken Stadtbefestigung nieder. Einzigartige Bauwerke und
Kunstdenkmäler fielen dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Der
Wiederaufbau zog sich über Jahrzehnte hin und gab der Stadt ein
neues Gesicht. Doch in all den Jahren ist Würzburg eine lebendige
und liebenswerte Stadt geblieben.
Mit 160 bislang größtenteils unveröffentlichten Aufnahmen aus den
reichhaltigen Beständen des Stadtarchivs dokumentiert Archivarin
Renate Schindler das Leben im Würzburg vergangener Tage. Das Buch
zeigt den Alltag in der Zeit, als noch Pferdefuhrwerke in den
Straßen unterwegs waren und die Herren steife Bärte trugen, die
Trümmerbahnen des Wiederaufbaus und die Errungenschaften des
Wirtschaftswunders. Manches scheint vertraut, vieles ist verloren,
doch alles weckt Erinnerungen an die Stadt am Main mit ihren engen
Gassen, barocken Bauten und vertrauten Plätzen.
Verlagsinformation |
|
|
Herrmann Knell: Untergang in
Flammen.
Strategische Bombenangriffe und ihre Folgen im Zweiten Weltkrieg.
Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg, Bd. 12.
Schöningh-Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 3-87717-792-1. |
|
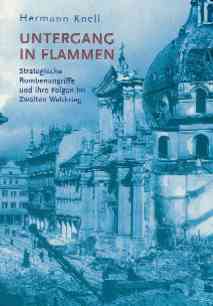
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der verheerende Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 war
sinnlos und diente keinem strategischen Zweck. Zu diesem Ergebnis
kommt das Buch "Untergang in Flammen" des gebürtigen Würzburgers
und Wahl-Kanadiers Hermann Knell. "Ich habe dieses Buch
geschrieben, damit so etwas nie wieder passiert". Der heute
79-jährige Hermann Knell erläutert ausführlich die Strategien des
Bombenkrieges im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ausgehend von den
persönlichen Erlebnissen des Autors stellt das Buch die
Bombardierungen Würzburgs in einen größeren Zusammenhang.
Sein Fazit: "Die Verluste und Zerstörungen durch die
Bombenangriffe zwischen 1914 und 1945 sind kein Ruhmesblatt der
Geschichte." Würzburg sei damals auch kein "Ziel erster Ordnung",
sondern immer nur "Zweitziel" der englischen und amerikanischen
Bomberverbände gewesen. In einigen Fällen seien die Bomben zu früh
oder zu spät abgeworfen worden, zum Beispiel bei einem Angriff auf
die Leistenstraße im Jahr 1944, bei dem 41 Menschen ums Leben
kamen. Das Werk erschien 2003 in Kanada in englischer Sprache und
wurde jetzt in Zusammenarbeit mit dem Würzburger Stadtarchiv ins
Deutsche übersetzt und überarbeitet.
Rezensionen
-
Zerstörung Würzburgs war sinnlos (Volksblatt Würzburg,
11.04.2006)
-
Kein Ruhmesblatt der Geschichte (Main Post Würzburg,
09.04.2006)
Zum Autor
Der heute 79-jährige Hermann Knell hat als 18-Jähriger die
Bombenangriffe auf Würzburg selbst miterlebt und mit seinem Vater
nur knapp überlebt. Nach dem Krieg studierte er in Darmstadt und
emigrierte dann nach Vancouver/Kanada. Von dort aus baute er als Ingenieur
in der ganzen Welt Papierfabriken, bevor er sich ab 1984 als
"Ruhestandsprojekt" den jahrelangen Recherchen über "Strategische
Bombenangriffe und ihre Folgen im Zweiten Weltkrieg" (so der
Untertitel des Buches) widmete. Das Buch erschien zunächst 2003
auf englisch unter dem Titel "To destroy a city" und wurde in
Zusammenarbeit mit dem Schöningh-Verlag Würzburg sowie dem
Stadtarchiv Würzburg übersetzt.
Verlagsinformation |
|
|
Tobias Haaf: Von volksverhetzenden
Pfaffen und falschen Propheten.
Klerus und Kirchenvolk im Bistum Würzburg in der
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Schöningh-Verlag,
Würzburg 2005. ISBN: 3-87717-067-6. |
|
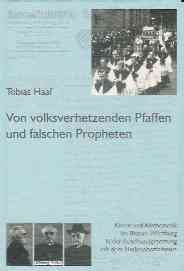
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Als "volksverhetzende Pfaffen" beschimpft der Kreisleiter der
NSDAP Ochsenfurt die unterfränkischen Priester, während Pfarrer
Ludwig Spangenberger von Kleinwallstadt die Nationalsozialisten in
seinen Predigten als "falsche Propheten" betitelt. Mit diesen
beiden Zitaten ist die Konfrontation zwischen Nationalsozialismus
und Kirche auf den Punkt gebracht und das Spannungsfeld
beschrieben, das die vorliegende Quellenstudie untersucht: Sie
geht der Frage nach, welche Konflikte zwischen den Ortspfarrern
und gläubigen Katholiken sowie den lokalen Funktionsträgern von
Regierung und Partei in den Jahren 1933 bis 1945 in der Diözese
Würzburg aufgebrochen sind.
Die Untersuchung bietet nicht nur einen vielseitigen und tiefen
Einblick in die Lebenswelt und Geisteshaltung der unterfränkischen
Katholiken und Diözesanpriester im Dritten Reich, sondern ordnet
darüber hinaus die unterfränkischen Verhältnisse in die
gesamtdeutschen und gesamtkirchlichen Entwicklungen ein.
Neben den Konfrontationen in der Schulfrage kommen die
Streitigkeiten wegen der kirchlichen Feiertage und Fahnen, wegen
des verbotenen Läutens der Kirchenglocken und der Verweigerung des
Hitlergrußes sowie die heftigen Proteste gegen die Entfernung der
Schulkreuze 1941 zur Sprache. Ausführlich wird auch thematisiert,
wie Klerus und Katholiken in Unterfranken auf die Ermordung
geistig behinderter Menschen, die Verschleppung ausländischer
Arbeitskräfte, die Vernichtung der Juden und die Kriegspolitik der
Nationalsozialisten reagiert haben. Reichweite und Grenzen des
kirchlichen Widerstands werden abschließend kritisch reflektiert.
Rezension
"Wie war das eigentlich damals im 'Dritten Reich'? Wie hat sich
die katholische Kirche verhalten? Tobias Haaf, der in Würzburg
Germanistik und Theologie studiert hat und inzwischen an einem
Gymnasium in Bayreuth als Lehrer arbeitet, wollte es ganz genau
wissen. Er begann zu forschen. Herausgekommen ist dabei ein 500
Seiten starkes Buch: seine Doktorarbeit zum NS-Kirchenkampf in
Unterfranken. Die Dissertation trägt den Titel 'Von
volksverhetzenden Pfaffen und falschen Propheten'." (Main Post,
15.12.2005,
Handfester Streit mit den Nazis)
Zum Autor
Tobias Haaf, Dr. theol., geboren 1975, studierte Germanistik und
katholische Theologie an der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg. Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im
Herbst 2000, anschließend Promotionsstudium mit
Graduiertenstipendium der Hanns-Seidel-Stiftung e. V., seit Herbst
2003 Studienreferendar an einem humanistischen Gymnasium in
Nürnberg, 2004 Promotion in Fränkischer Kirchengeschichte mit
vorliegender Arbeit, Preisträger der Unterfränkischen
Gedenkjahrsstiftung für Wissenschaft 2005.
Verlagsinformation |
|
|
S. Karl Metz: Ein Führer durch Würzburg und
Umgebung vor über 100 Jahren. |
|
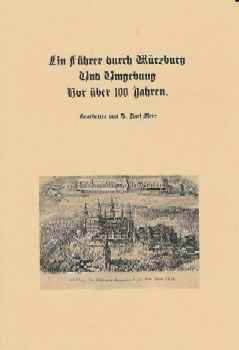
|
Zum Buch
Die handliche Broschüre dokumentiert eine Würzburger Stadtführung
von vor über 100 Jahren. Auf 102 Seiten werden fast 100
Sehenswürdigkeiten in Wort und Bild geschildert.
Michael Kraus
Aus dem Vorwort
"Main, Wein und Glockenklang / Gehen durch ganz Frankenland":
Würzburg, die liebliche Main- und Weinstadt, nimmt unter den
Städten, die in der damaligen Zeit einen großen Aufschwung
genommen haben, eine hervorragende Stelle ein. Es verdankt dies
der Tatsache, dass vor drei Jahrzehnten seine frühere
Festungseigenschaft aufgehoben wurde und dadurch die bis dahin in
ihrer Entwicklung und Erweiterung gehemmte Stadt sich ungehindert
ausdehnen konnte.
Zum Aufschwung Würzburgs trug außerdem die beschleunigte
Entwicklung der Universität, deren medizinische Fakultät zu den
berühmtesten Deutschlands zählt, bei. Jetzt präsentiert sich
Würzburg mit seinen zahlreichen alten und neuen Prachtbauten als
eine Stadt, die bei den Besuchern den freundlichsten Eindruck
hinterlässt und durch ihre vielen Sehenswürdigkeiten sowie ihre
schöne Umgebung den Fremden, wenn sie die Stadt schon lange wieder
verlassen haben, in angenehmer Erinnerung bleiben wird.
Verlagsinformation
Exemplare des "Führers durch Würzburg und Umgebung" können für
6 Euro
direkt im
Buchladen Neuer Weg
gekauft oder bestellt werden.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Mainfränkisches
Jahrbuch für Geschichte und Kunst, 2005. Herausgegeben von den
Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg.
Gesamtherstellung: HartDruck GmbH, Volkach 2005. ISSN: 0076-2725. |
|
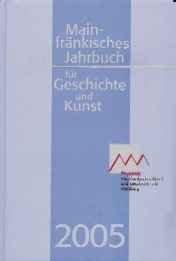
|
Aus dem Vorwort
Das vorliegende Jahrbuch ist sehr umfangreich, es enthält einige
längere Aufsätze. Die Publikation dieses Jahrbuchs war nur durch
einen finanziellen Kraftakt möglich. Ich bin froh, dass es
gelungen ist, das ganze Spektrum der unterfränkischen Geschichte
vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit zu berücksichtigen. Im
Jahre 2005 gedachte man in Deutschland dem 60. Jahrestag des
Kriegsendes. Den letzten Kriegsjahren sind einige Aufsätze
gewidmet, die interessante neue Aspekte der unterfränkischen
Geschichte beleuchten. Gemäß dem Auftrag der Vereinssatzung werden
auch kunstgeschichtliche Themen gebührend berücksichtigt.
Herbert Schott, Schriftleiter
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Gerhard Wagner: Der fränkische Königshof Herlheim
- Thomas Steinmetz: Neues zu den Maintalburgen Ravensburg,
Falkenberg und Neuenburg
- Ludwig Reusch: Die vierherrische Zent Mittelsinn - Zweiter Teil
- Hubert Emmerig: Münzen der Stadt Hammelburg im 16. Jahrhundert?
- Markus Josef Maier: Jost Ammann (1539-1591) als Portraitist
zweier Würzburger Persönlichkeiten
- Matthias Löffelmann: Balthasar Neumanns Würzburger
Dominikanerkirche (heutige Augustinerkirche)
- Victor Metzner: Franz Erwein von Schönborn und seine Bedeutung
- Hans-Bernd Spies: Ein Brief Friedrich Ludwig Heinrich Rumpachs
an Heinrich Stephani (1796)
- Oliver Weinreich und Helge Clausen: Ein Däne an der
Universitätsbibliothek Würzburg
- Walter M. Brod: Eine Würzburg-Ansicht in der Presse des 19.
Jahrhunderts
- Hanns-Helmut Schnebel: Johann Reiter, Hammelburgs letzter Türmer
(1804-1886)
- Jörg Seiler: Ungeliebte Würzburger zwischen Ausgrenzung,
Auswanderung, Ausbürgerung und Deportation (1933-1944)
- Astrid Freyeisen: Verbohrt bis zuletzt – Gauleiter Dr. Otto
Hellmuth
- Herbert Schott: Würzburg zwischen Stalingrad und dem Kriegsende
- Ellen Latzin: Begegnung mit Tiepolo in New York
- Gottfried Mälzer: Die Universitätsbibliothek Würzburg als
Regionalbibliothek
- Bibliographie Dr. Gottfried Mälzer, Leiter der
Universitätsbibliothek
- Anzeigen und Besprechungen
- Geschäftsbericht
- Mitarbeiterverzeichnis
Verlagsinformation
Exemplare des "Mainfränkischen Jahrbuchs" können für
43,50
Euro
direkt im
Buchladen Neuer Weg
gekauft oder bestellt werden.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Birgit Speckle: Schafkopf und
Musikbox.
Einblicke in unterfränkische Dorfwirtshäuser 1950-1970. Verlag:
Bezirk Unterfranken 2005. ISBN: 3-9809330-0-8. |
|
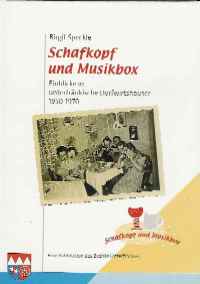
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Im Dorfwirtshaus der 1950er/1960er Jahre herrschte reges Treiben:
Am Sonntagnachmittag füllten die Schafkopf-Runden die ganze
Wirtsstube. Im Wirtshaus saß man nicht nur gemütlich zusammen,
sondern hier wurden Geschäfte gemacht, Aufträge vergeben und
politische Debatten geführt, aber auch Vorträge und
Lehrveranstaltungen abgehalten. Viele Wirtshäuser hatten im
Obergeschoss auch einen Tanzsaal, der als Vorläufer der Mehrzweck-
und Sporthalle bezeichnet werden kann. Hier machte das Wanderkino
Station und hier wurden sämtliche Vereinsfeiern abgehalten.
Gesellschaftliches Großereignis aber war die alljährliche
Kirchweih.
Das Dorfwirtshaus stand häufig auch für Innovationen. Die
Wirtsleute hatten Geräte angeschafft, die sich noch nicht
jedermann im heimischen Haushalt leisten konnte, nämlich Telefon
und Fernseher. Darüber hinaus galten in einer Zeit ohne
Diskotheken oder Spielhallen auch Musikbox, Geldspiel- oder
Unterhaltungsautomaten als echte Attraktionen. Dorfwirtshäuser
waren in den 1950er/1960er Jahren für alle gesellschaftlichen
Schichten und für Jung und Alt der Treffpunkt schlechthin.
Die goldene Zeit der Dorfwirtshäuser ist seit etwa den 1970er
Jahren vorbei und damit auch ihre Funktion als wichtiger Teil
öffentlicher Dorfkultur. Für den Niedergang der Dorfwirtshäuser
gibt es mehrere Gründe: Der Fernseher, den sich in den 1970er
Jahren bald jedermann leisten konnte, förderte den Rückzug ins
heimische Wohnzimmer. Die nach und nach entstehenden Vereinsheime,
Bürgerzentren, Pfarrheime und die aufkommende Mode, viele Feste in
den privaten Bereich zu verlagern, etwa in Form der
"Keller-Partys" an der Hausbar, waren und sind eine ernste
Konkurrenz für die Dorfwirtshäuser.
Darüber hinaus ermöglichte das Auto mehr Mobilität. Das Auto
eröffnete etwa ab den 1970er Jahren auch weiter entfernt liegende
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, für Jugendliche insbesondere
Diskotheken. Damit verlor der Tanzsaal im Dorfwirtshaus nach und
nach seine zentrale Bedeutung. Dazu kamen ausländische
Spiellokale, die einen neuen, exotischen Reiz hatten. Dazu
gehörten Betriebe, in denen zunächst italienische, später auch
griechische und asiatische Spezialitäten angeboten wurden.
Rezension
"Die Beat- und Rockjahre haben leider keinen nachlesbaren Eindruck
in dieser Geschichte der unterfränkischen Dorfwirtshäuser
gefunden, der Band bleibt auch eher im zeitlichen Bereich 1950 bis
Anfang der 60er Jahre, zwischen Schlager, Rock’n’Roll und Twist.
Dafür entschädigt aber eine umfangreiche weiterführende
Literaturangabe zur ländlichen Gasthaus-, Freizeit- und
Jugendkultur, die zur Selbstvertiefung in dieses Thema und in
diese Kultur auffordert. Beim Lesen entwickelt sich neben dem
Hochkommen eigener Jugenderinnerungen an verbrachte Gasthauszeiten
auch die große Lust auf eine Radtour durchs fränkische Land mit
dem Erkundungsmotto 'Kirchen von außen, Wirtschaften von innen'.
Das ca. 70 Seiten umfassende und gut bebilderte Bändchen liefert
den Stoff dazu und das auf eine äußerst kurzweilige Weise." (Pro-Regio-Online,
RegioLine)
Verlagsinformation |
|
|
Robert Meier: Feurich-Keks und
Zucker-Bär.
Geschichten und Anekdoten aus dem alten Würzburg. Wartberg-Verlag
2005. ISBN: 3-8313-1603-1. |
|
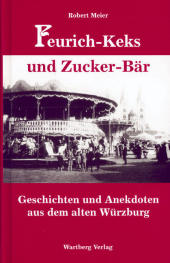
mehr Infos
bestellen
|
Feurich-Keks und Zucker-Bär ... das waren zwei der beliebten
Süßigkeitsläden im alten Würzburg, an deren Schaufensterscheiben
sich die Kinder die Nasen platt drückten. Davon und von vielen
anderen Ereignissen, Orten und Persönlichkeiten erzählt dieser
Band. So glaubte man sich 1928 beim Mozartfest ins Rokokozeitalter
zurückversetzt, konnte Ende der 40er Jahre, als die Winter noch
Winter waren, über den zugefrorenen Main spazieren und staunte an
Kiliani nicht schlecht, wenn die Zauberkünstlerin Peppino eine
Kerze verschluckte und von innen heraus leuchtete. Da werden
Erinnerungen wach ...
Verlagsinformation |
|
|
Herbert Haas: Mittelalterlicher
Weinanbau in der 'villa Randersacker' und dem südlichen
Maindreieck. Eine ungewöhnliche Weinstory. Verlag Königshausen
& Neumann 2005. ISBN: 3-8260-3169-5. |
|
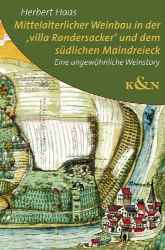
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der Verfasser, dem keine Wengertsarbeit fremd, schildert den
mittelalterlichen Weinbau des südlichen Maindreiecks im
Allgemeinen und die damit verbundenen Randersackerer Begebenheiten
im Besonderen. Der spannende Krimi über die wechselvollen 800
Jahre fränkischen Weinbaues geht von den Anfängen in der Zeit
Karls des Großen bis zur maximalen Ausdehnung der Rebfläche auf
etwa 40.000 Hektar im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, der
Ära Julius Echters von Mespelbrunn.
Die Häcker entblößen sich ihres Grundbesitzes, verarmen und
mutieren vom Eigentümer zum notleidenden Lehensnehmer, das
Weinproletariat entsteht. Eine beginnende, lange währende
Kaltzeit, die den hochgeschätzten Frankenwein zum "Sauerländer"
stigmatisiert, beendet die weitere Verbreitung der Vitis vinifera
und läutet den 400 Jahre währenden Niedergang ein. Rückschlüsse
auf das 20. Jahrhundert und aktuelle Bezüge zur Gegenwart ergänzen
die unterhaltsame, farbige Schilderung der außergewöhnlichen
Wein-Gezeiten.
Aus dem Inhalt
- Die Wanderjahre der Weinrebe und ihre Einbürgerung in
mainfränkischen Gefilden
- Vom Wingarton zum Winperch: Die Rebe klettert den Berg hinauf.
Zeitgleiche Beurkundung von Würzburger und Randersackerer
Weinlagen ab 1050
- Der Weinmotor Randersacker springt an, läuft und läuft ... Wein,
der hochoktanige Kraftstoff zur zügigen Dorfentwicklung
- Die Weinbergsarbeit, ein unaufhörlicher Kampf gegen Unkraut und
Schädlinge. Das Ende der Vielfalt im Lebensraum Weingarten
- Die Häufung der herrschaftlichen Erlasse im 14. Jhd. Randesacker
anno 1350 mit eigener Zehnt- und Leseordnung
- Der mittelalterliche Qualitätsweinbau, Rebsorten, Realteilung
und Kopferziehung
- Klöster saugen den Grundbesitz auf. Die Häcker verarmen.
Würzburger plündern den Randersackerer Edelhof
- Die Rebe als Baum der Erkenntnis? Der Tausendsassa Wein,
wichtigste Arzney des Mittelalters
- Der Bauernkrieg, der Augsburger Religionsfriede und die
Zweiteilung Randersackers
- Die Ära Julius Echter von Mespelbrunn. Wer nicht kommunizieren
kommt, muss gehen
- Franken mit 40.000 Hektar größtes deutsches Weinland. Erblühende
dörfliche Baukultur im 16. Jhd.
- Die 300-jährige Kaltzeit beginnt, mit dem Weinbau geht's bergab.
Der Wein ist stocksauer.
- Quellen und Literaturverzeichnis
Verlagsinformation |
|
|
Leo H. Hahn: Kriegsgefangene und
Fremdarbeiter in Würzburg. Bei Handwerk, Handel und Industrie,
bei städtischen Betrieben, der Universität, der Wehrmacht und
anderen Institutionen. Eigenverlag, Dezember 2005. ISBN:
3-00-017731-0. |
|
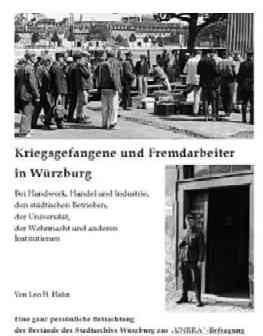
|
Aus dem Inhalt
Ohne Zwangsarbeiter lief in Würzburg nichts: Im Zweiten Weltkrieg
waren in Würzburg ständig zwischen 6.000 und 9.000 Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter beschäftigt. Nach jahrelanger Arbeit hat Leo H.
Hahn nun ein bemerkenswertes, reich bebildertes Buch über jene
Menschen vorgelegt, ohne die das Wirtschaftsleben in der Domstadt
zusammengebrochen wäre. Der Band mit 33 bisher unveröffentlichten
Fotos trägt den Titel "Kriegsgefangene und Fremdarbeiter in
Würzburg. Bei Handwerk, Handel und Industrie, bei städtischen
Betrieben, der Universität, der Wehrmacht und anderen
Institutionen."
Rezension
Ohne Zwangsarbeiter lief in Würzburg nichts (Main Post,
07.12.2005)
Zum Autor
Leo H. Hahn, 1933 geboren, erlebte das "Dritte Reich" als Kind
mit. Er war über 30 Jahre lang als technischer Angestellter bei
der MAIN-POST tätig. 1995 legte er "Streiflichter zur Geschichte
der Zellerau und der Stadt Würzburg" vor.
Verlagsinformation
Exemplare
des Buchs können für
15,90 Euro
direkt im
Buchladen Neuer Weg
bekauft oder bestellt werden.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Kurt Schlier: Die ersten 21 Jahre meines
Lebens. Eigenverlag 2005 (2. Auflage). ISBN: 3-00-015845-6. |
|
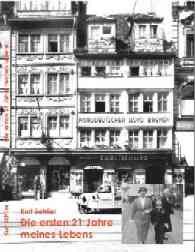
|
Zum Buch
1945 war der Krieg zu Ende. Ich war gerade 21 Jahre alt und wurde
volljährig. Diese ersten Jahre meines Lebens wurden vorwiegend vom
Hitlerregime, vom Krieg und von meiner Soldatenzeit geprägt. Jetzt
standen wir vor einem Neuanfang. Keines meiner Kinder und
Enkelkinder kann sich eine Jugend in solch einer Zeit vorstellen.
Über meine Kriegserlebnisse habe ich mit meinen Kindern nie
gesprochen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, um ihnen solche
Zeilen selbst in Gedanken zu ersparen.
Rezension
Leichen bergen unter den Trümmern (Main Post, 16.09.2005)
Verlagsinformation
Exemplare
des Buchs können für
9,90 Euro
direkt im
Buchladen Neuer Weg
bekauft oder bestellt werden.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Stefan Keppler/Johann
Schrenk/Horst Brunner/Otto Wittmann: Goethes Franken.
Johann-Schrenk-Verlag 2005 (1. Auflage). ISBN: 3-924270-41-4. |
|
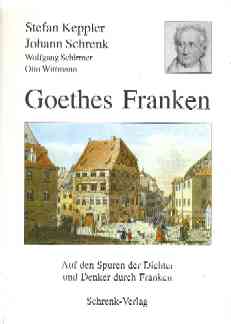
mehr Infos
bestellen
|
Aus dem Inhalt
Johann Schrenk legt mit "Goethes Franken" den dritten Titel aus
der Buchreihe "Auf den Spuren der Dichter und Denker durch
Franken" vor. Mit dem 128 Seiten fassenden, reich bebilderten und
illustriertem Werk ist ein kompakter, preislich erschwinglicher
Reiseführer auf den Markt gekommen, dessen ausgewogene Mischung
wissenschaftlicher Aufsätze einerseits und ausführlicher
touristischer Informationen andererseits deutlich von der Masse
abhebt.
Wie schon in den zwei vorherigen Büchern der Reihe (sie wurden
jeweils in der Druckerei E. Riedel gefertigt) hat Dr. Schrenk auch
dieses Mal kompetente und anerkannte Wissenschaftler als Koautoren
gewonnen. Der Leser ist eingeladen, diesen Landstrich zu bereisen
und ihn sich zu eigen zu machen, wie der Dichter aus Weimar es
tat: "Goethes Franken" heißt es deshalb statt "Goethe in Franken".
Inhaltsverzeichnis
- Stefan Keppler: Goethes Franken – Topographie des Altdeutschen
- Johann Schrenk: Goethe in Nürnberg
- Johann Schrenk: Goethe im Fichtelgebirge
- Wolfgang Schirmer: Goethes Granitstudien in Franken und seine
Idee Granit
- Johann Schrenk: Goethes Reisen durch Franken
- Otto Wittmann: Goethe und der Frankenwein
- Johann Schrenk: Auf den Spuren Goethes durch Franken
Zu den Autoren
Reich bebildert und inspirierend sind die Kapitel, in denen der
Gunzenhäuser Buchhändler, Verleger und Historiker Dr. Johann
Schrenk auf Goethes Spuren quer durch Franken, ins Fichtelgebirge,
und nach Nürnberg reist, um Häuser, Museen und Naturdenkmäler, die
an den vielseitig interessierten Genius erinnern, vorzustellen.
Dr. Stefan Keppler, gebürtiger Franke, ist Assistent am Institut
für Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität
Berlin. 2004 promovierte er an der Universität Würzburg über
Goethes Erzählwerk. Von ihm stammt das erste Kapitel über die
"Topographie des Altdeutschen".
Professor Dr. Wolfgang Schirmer, bis 2005 an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als Geologe tätig,
vergleicht anhand einer ausführlichen Grafik die Vorstellung
Goethes von der Entstehung des Fichtelgebirgsgranits, die er in
vielen Exkursionen vor Ort gewonnen hatte, mit den
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus heutiger Zeit.
Der Gunzenhäuser Dr. Otto Wittmann, von 1989 bis 1993 Präsident
des Bayerischen Geologischen Landesamtes München, setzt sich in
seinem Aufsatz mit Goethe und dem Frankenwein auseinander.
Verlagsinformation/"Altmühl-Bote" vom 10.12.2005 |
|
|
Rainer Leng (Hrsg.): Geschichte der
Stadt Heidingsfeld.
Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 100 SW- u. 32 Farbtafeln.
Schnell & Steiner-Verlag 2005. ISBN: 3-7954-1629-9. |
|
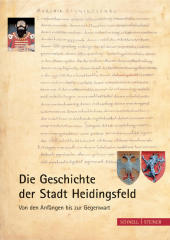
mehr Infos
bestellen
|
Erstmals wird die reiche Geschichte der Stadt Heidingsfeld
anschaulich in einem umfassend illustrierten Band dargeboten. Von
den ältesten Siedlungsspuren bis zum nicht immer spannungsfreien
Verhältnis zur nahen Bischofsstadt Würzburg in der Neuzeit reicht
der Bogen dieser fundierten Stadtgeschichte.
Mit der ersten urkundlichen Erwähnung in einer althochdeutschen
Markbeschreibung von 779 ist Heidingsfeld nur wenige Jahre jünger
als das nahe gelegene Würzburg. Zug um Zug wurde die städtische
Autonomie im Laufe des Mittelalters ausgebaut. Die Grafen von
Rothenburg und Hohenlohe sowie die staufischen Könige und Kaiser
versuchten die Stadt als Herrschaftssitz zu nutzen. So entstand
eine enge Verbindung zur Reichsgeschichte. Zuletzt verlieh der
böhmische König Wenzel 1367 ein Privileg, das Heidingsfeld auf den
besten Weg zur freien Reichsstadt brachte.
Die Bischöfe von Würzburg waren dagegen über zwei Jahrhunderte
bestrebt, die Gemeinde auf dem Weg der Pfandschaft in das
Territorium des Hochstifts zu integrieren. Dies gelang erst in der
frühen Neuzeit. Doch auch dann konnte die Stadt immer wieder
eigene Wege gehen. Ein Rathaus, das Stadtwappen mit Reichadler und
böhmischem Löwen und ein noch heute fast vollständiger Mauerring
künden vom Bewusstsein der Heidingsfelder Bürger für die
Sonderstellung ihrer Stadt selbst unter bischöflicher Herrschaft.
Erst 1930 erlosch die Selbständigkeit mit der Eingliederung nach
Würzburg. Dem historischen Wandel von Herrschaft, Politik und
Verwaltung ist ein umfangreicher Teil der Publikation gewidmet.
Zahlreiche Historiker, Volkskundler und Kunsthistoriker widmen
sich in weiteren Abschnitten den Themen - Heidingsfeld in Kriegs-
und Nachkriegszeit - Handel und Verkehr - Die
Religionsgemeinschaften: Katholiken, Protestanten und die Jüdische
Gemeinde - Schulwesen - Architektur in Sakral- und Profanbauten -
Kunstgeschichte und Künstlergeschichte - Brauchtum und
Wallfahrtswesen. Initiator der Veröffentlichung ist die
Bürgervereinigung Heidingsfeld.
Verlagsinformation |
|
|
Barbara Schock-Werner: Die
Bauten im Fürstbistum Würzburg unter Julius Echter von Mespelbrunn
(1573-1617).
Struktur, Organisation, Finanzierung und künstlerische Bewertung.
Habilitations-Schriften. Mit 96 Farb- und 118 SW-Abbildungen.
Schnell & Steiner-Verlag 2005. ISBN: 3-7954-1623-X. |
|
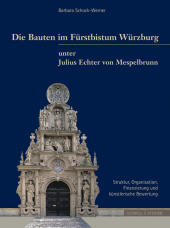
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Das Buch enthält die erste umfassende Darstellung der zahlreichen
Sakral- und Profanbauten, die auf Initiative des Würzburger
Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617)
entstanden. Ein besonderes Interesse gilt seinem persönlichen
Engagement in allen Bauangelegenheiten. Nicht nur der Umfang
seines Schaffens, auch die bisher weithin unterschätzte Qualität
der Bauten wird unter Berücksichtigung von Zeitquellen erschlossen
und in einem umfangreichen Katalogteil dokumentiert.
In diesem Buch wird die Bautätigkeit Julius Echters erstmals
detailliert geschildert und die sehr persönliche Prägung durch den
Fürstbischof und seine direkte Beteiligung herausgearbeitet. Die
Systematik der Bauorganisation, der Charakter der einzelnen
Bauaufgaben – einfache wie anspruchsvolle Kirchenbauten,
Rathäuser, Pfarrhäuser, Amtshäuser, Schlösser – und deren
Finanzierung sind ausführlich dargestellt.
Soweit heute noch möglich, rekonstruiert die Autorin auch
Ausmalung und Ausstattung. Zahlreiche Quellenzitate
vergegenwärtigen den historischen Kontext und die Intentionen des
Bauherrn. In dem umfangreichen Katalogteil werden alle noch
existierenden Bauten in Text und Bild vorgestellt. Darunter sind
so berühmte Bauten wie die Universitätskirche in Würzburg, aber
auch bislang weitgehend unbekannte Kleinode wie Altbessingen oder
Dipbach.
Die Kunsttopographie Unterfranken erfährt durch dieses Werk eine
wertvolle Ergänzung und bietet zugleich überregional bedeutsamen
Einblick in die Baugeschichte um 1600. Fürstbischof Julius Echter
von Mespelbrunn ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten in
der Geschichte Unterfrankens. Seine Bedeutung für die
Gegenreformation, für das Sozial- und Rechtswesen und die
wirtschaftliche Erneuerung Unterfrankens aber auch die durch ihn
forcierte Bautätigkeit standen wiederholt im Mittelpunkt
wissenschaftlicher Untersuchungen.
Zum Autor
Mit dem vorliegenden Band habilitierte sich Barbara Schock-Werner
an der Universität Würzburg. Seit 1999 ist die Autorin
Dombaumeisterin in Köln.
Verlagsinformation |
|
|
Konrad Beischl: Dr. med. Eduard
Wirths und seine Tätigkeit als SS-Standortarzt im KL Auschwitz.
Königshausen & Neumann-Verlag 2005. ISBN: 3-8260-3010-9. |
|
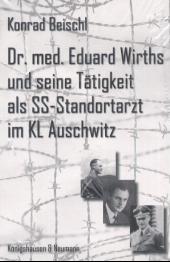
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung des
Medizinstudenten und jungen Mediziners Eduard Wirths (1919-1945)
zu einer der Schlüsselfiguren des Vernichtungsapparates im KL
Auschwitz. Wirths wurde 1919 als Sohn eines mittelständischen
Unternehmers in Geroldshausen, nahe Würzburg, geboren. Noch
während des Studiums trat er in die NSDAP, die SA und später die
SS ein. Beim Fronteinsatz in Norwegen und der Sowjetunion zog er
sich ein Herzleiden zu. Dies führte zu seiner Versetzung zur
"Inspektion K.L." – zum Einsatz in den Konzentrationslagern. Hier
machte Wirths innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere und
wurde – mittlerweile SS-Obersturmführer – Standortarzt des
riesigen Lagerkomplexes Auschwitz. Er war der verantwortliche
Organisator der Selektionen der jüdischen Häftlinge an der "Rampe"
von Auschwitz-Birkenau. Über alle medizinischen Experimente, die
an Häftlingen durchgeführt wurden, war er informiert und
initiierte selbst eigene Versuchsreihen. Sein Häftlingsschreiber
Hermann Langbein, österreichischer Kommunist und aktiv im
Lagerwiderstand, gewann allmählich Einfluss auf Wirths und konnte
dies geschickt für die Widerstandsbewegung ausnutzen. Wirths, der
von Langbeins Verbindung zum Widerstand wusste, ließ Langbein
gewähren, blieb jedoch selbst bis zuletzt loyal gegenüber dem
nationalsozialistischen Deutschland. Insgesamt ergibt sich ein
zwar widersprüchliches Bild, aber doch das Bild eines Mannes, der
dem faschistischen System nichts entgegen zu setzen hatte.
Zum Autor
Konrad Beischl, geboren 1969, ließ sich zunächst zum Gärtner
ausbilden. Anschließend studierte er Humanmedizin in Regensburg.
Derzeit ist er als Assistenzarzt an der Schlossklinik Rottenburg
a.d.L. tätig.
Verlagsinformation |
|
|
Bruno Erhard: Die Nacht, als
Würzburg unterging – 16. März 1945.
Deutsche Städte im Bombenkrieg. Wartberg-Verlag 2005. ISBN:
3-8313-1482-9. |
|
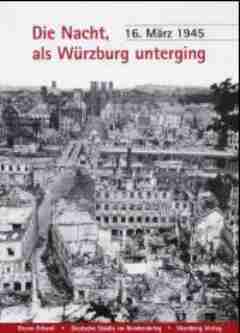
mehr Infos
bestellen
|
Das Grab am Main – das war Würzburg nach dem verheerenden
Bombenangriff am 16. März 1945. Innerhalb von nur zwanzig Minuten
legten alliierte Bomber große Teile des Stadtgebiets in Schutt und
Asche. Tausende Menschen kamen ums Leben, Häuser und Straßen
wurden zerstört, jahrhundertealte Kunstschätze gingen
unwiederbringlich verloren. Beeindruckende Bilder dokumentieren
den Untergang des fränkischen Kleinods, viele
Bild-Gegenüberstellungen erlauben den direkten Vergleich,
informative Texte berichten vom Kriegsverlauf, auch Zeitzeugen
kommen zu Wort. So wird der Band in Wort und Bild zu einem
bewegenden Dokument der Zeitgeschichte.
Verlagsinformation |
|
|
Heinrich Weppert: Würzburg aus Trümmern entstanden. 1945-1953.
Bildkatalog 11. Herausgegeben von den Freunden der
Geschichtswerkstatt Würzburg. Copier-Center Haase 2005 (Druck, 1.
Auflage). |
|
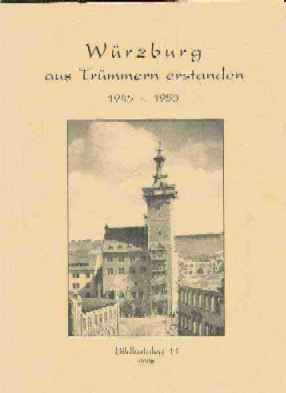
|
Der vorliegende Bildkatalog, der elfte seiner Art und zugleich der
erste, dessen Gegenstand die unmittelbare Nachkriegszeit in
Würzburg ist, zeigt eindrucksvoll, wie sich das Leben in der
zerstörten Stadt dank des Lebenswillens ihrer Einwohner allmählich
wieder normalisierte.
Verantwortlich für die Erstellung sind Heinrich Weppert und die
Freunde der Geschichtswerkstatt Würzburg.
Verlagsinformation
Exemplare sind im
Buchladen Neuer Weg
erhältlich.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Heinrich Weppert: 16. März 1945 – 16. März 2005. Ein Bericht über
den Untergang des alten Würzburg.
Alt-Würzburg, 8. Jg, 1. Halbjahr 2005. Geschichte in bekannten und
unbekannten Bildern aus dem Freundeskreis Geschichtswerkstatt
Würzburg. Copier-Center Haase 2005 (Druck, 1. Auflage). |
|
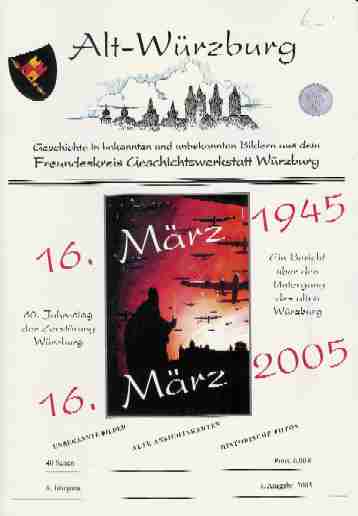
|
60 Jahre sind
vergangen seit jener furchtbaren Katastrophe, die das alte
Würzburg auslöschte. Eine neue Generation ist herangewachsen, die
nur noch vage Vorstellungen von jenen Vorgängen besitzt. In dem
wiederaufgebauten Würzburg sind neben den alten auch viele neue
Bürger ansässig geworden. Sie wollen ebenfalls erfahren, wie
Würzburg in den Jahren 1942 bis 1945 in Schutt und Asche versank.
Der vorliegende Bericht stütz sich auf authentisches Material, das
von Dr. Max Domarus in unzähligen Einzeluntersuchungen und
persönlichen Befragungen zusammengetragen wurde. Der Bericht soll
ein Denkzeichen für den unermüdlichen Einsatz von Domarus sein,
der sich dem Leitwort "Veritas", die Wahrheit, verpflichtet
fühlte. Darüber hinaus haben Würzburger viele Bilder beigesteuert.
Verlagsinformation
Exemplare sind im
Buchladen Neuer Weg
erhältlich.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |
|
|
Christoph Daxelmüller/Roland
Flade: Ruth hat auf einer schwarzen Flöte gespielt.
Geschichte, Alltag und Kultur der Juden in Würzburg. Herausgegeben
von Klaus M. Höynck. Echter-Verlag 2005. ISBN: 3-429-02666-0. |
|
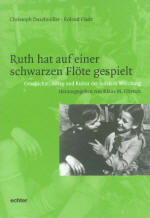
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die 1300-jährige Geschichte Würzburgs ist auch geprägt durch eine
lange, wechselvolle Beziehung der Stadt zu den in ihr beheimateten
Juden. Beispielhaft für andere deutsche Städte zeichnen die beiden
Autoren ein lebendiges Bild von Geschichte und Alltag der
Würzburger Juden. Nicht nur im Hinblick auf die in den letzten
Jahren stark anwachsende jüdische Gemeinde Würzburgs wird somit
ein wichtiger Teil der Vergangenheit wieder bewusst gemacht. Die
Texte werden ergänzt durch teilweise unveröffentlichte Bilder zum
jüdischen Alltagsleben.
Zu den Autoren
Christoph Daxelmüller ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkskunde an
der Universität Würzburg
Roland Flade, geboren 1951, ist Redakteur bei der Würzburger
Tageszeitung MAIN-POST. Er hat sich in zahlreichen
wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit der Geschichte der Juden
in Unterfranken befasst.
Herausgeber Klaus M. Höynck ist freier Autor und Träger des
Publizistikpreises des Verbandes Bayerischer Bezirke.
Verlagsinformation |
|
|
Klaus M. Höynck/Eberhard
Schellenberger: 16. März 1945.
Erinnerungen an Würzburgs Schicksalstag und das Ende des Krieges.
Mit Audio-CD "Der Bayerische Rundfunk im Gespräch mit Zeitzeugen".
2005.
ISBN: 3-429-02693-8. |
|
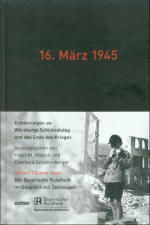
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der 16. März 1945 hat sich für die Stadt Würzburg tief in die
Erinnerung eingegraben. An diesem Tag fielen den Bomben der
britischen Royal Airforce nahezu 90 Prozent der Gebäude zum Opfer,
wertvolle Kunstdenkmäler wurden zerstört, 5.000 Menschen starben.
Die Vorgeschichte und der Ablauf dieses historischen Ereignisses
wurden in zahlreichen Veröffentlichungen dargestellt. In diesem
Band stehen jedoch nicht die Ereignisse, sondern die Erlebnisse
der betroffenen Menschen im Mittelpunkt. Augenzeugen berichten,
wie sie den verheerenden Angriff und die Wochen danach erlebten.
In Verbindung mit der CD mit historischen Tondokumenten aus dem
Archiv des Bayerischen Rundfunks entsteht so ein lebendiges und
beeindruckendes Bild der letzten Kriegstage und des Beginns der
Nachkriegzeit in Würzburg.
Zu den Herausgebern
Klaus M. Höynck ist freier Autor und Träger des Publizistikpreises
des Verbandes Bayerischer Bezirke.
Eberhard Schellenberger ist Leiter der Hörfunkredaktion beim
Bayerischen Rundfunk, Studio Mainfranken und ebenfalls Träger des
Publizistikpreises Bayerischer Bezirke.
Verlagsinformation |
|
|
Klaus Gasseleder: Zwei
Gesichter.
Aus der Chronik einer jüdischen Familie, eines fränkischen Dorfes
und eines Weltbades in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Vetter-Verlag, Geldersheim 2005. ISBN: 3-9807244-6-8. |
|
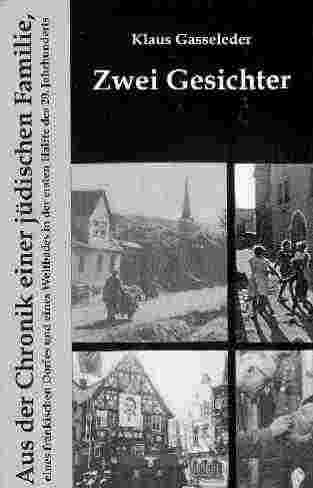
mehr Infos
bestellen
|
Schön wie je liegt das Städtchen – im Stil der Propaganda
ausgedrückt: ein köstlicher Juwel, zusammengesetzt aus den bunten
Edelsteinen seiner grünen Gärten, seiner herrlichen Blumenanlage
und seiner heiteren Häuser, am goldgrünen Band der Saale (die das
tatsächlich einmal war, aber jetzt – die Gründe kenne ich nicht –
fast stehend sumpfig und recht dürftig aussieht) zärtlich umfasst
von dem saftigen Grün seine Wiesen und dem dunkleren seiner
dahinter aufsteigenden Wälder.
Trotz allem, ich muss gestehen, dass auch ich immer es so gesehen
hatte. Und dass mir eine Sehnsucht geblieben war. Denn Kissingen
und meine Jugend gehören zusammen, so wie Steinach und meine
Kindheit. Eine Jugend, die ich für herrlich gehalten hatte. Diese
Herrlichkeit aber war von den späteren Ereignissen her fragwürdig
geworden. Alle Schönheit ihrer Erlebnisse hatte als Basis gehabt
den nie in Frage gezogenen Glauben an die Unwandelbarkeit
menschlicher Ordnungen – den Glauben, dass der Mensch gut sei. Die
schlechten waren nur Ausnahmen, und auch sie würden allmählich
besser werden!
Nun hatte es sich herausgestellt, dass dieser Glaube die
leichtfertige Sicherheit der Jahrhundertwende war, möglich
geworden durch eine ungewöhnlich lange Friedenszeit, die durch die
beiden Weltkriege – und ganz erbarmungslos durch das Grauen des
"Dritten Reiches" – für alle Zeiten von Grund auf zerstört ist.
Übrig geblieben ist das Bild des Menschen in seiner
Jämmerlichkeit, seiner Gefährdetheit von innen heraus, wenn äußere
Ordnungspfeiler zusammengebrochen sind. Kissingen hat uns
verraten. Die Menschen hatten andere Gesichter bekommen, eiserne
statt der freundlichen, Und beide scheinen wahre Gesichter gewesen
zu sein, jedes zu seiner Zeit.
Klappentext |
|
|
Jörg Paczkowski: Der
Wiederaufbau der Stadt Würzburg nach 1945.
Ferdinand-Schöningh-Verlag, Würzburg 1995 (Unveränderter Nachdruck
der Ausgabe von 1982). ISBN: 3-87717-803-0. |
|
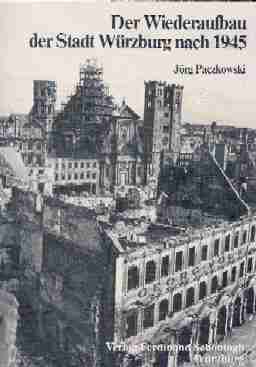
mehr Infos
bestellen
|
Die 1982 bei den Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte als
30. Band der Mainfränkischen Studien erschienene Dissertation über
den Wiederaufbau der Stadt Würzburg nach 1945 war nach wenigen
Jahren vollständig vergriffen. Da sich grundsätzlich an den damals
vertretenen Thesen – wie es auch die Besprechungen gezeigt haben –
kaum etwas geändert hat, erschien es – trotz einiger technischer
Mängel – gerechtfertigt, diese Arbeit unverändert nachzudrucken.
Eine Überarbeitung war aus Zeitgründen nicht möglich und hätte
kaum wesentlich andere Ergebnisse gebracht. Hier sei nur auf eine
Anregung Heiner Reitbergers verwiesen, der in einem persönlichen
Brief vom 14. Dezember 1982 feststellte, dass aus dieser Arbeit
"eine Serie von Studien verschiedener Richtung zu entwickeln" sei.
Ebenso stellt Richard Strobel fest, dass mit dieser Arbeit "für
eine wichtige Würzburger Stadtgeschichtsperiode nun Materialien
vorliegen, die es für Stuttgart und Heilbronn, Ulm und Reutlinen
noch nicht gibt." (Besprechung in der Zeitschrift für
Württembergische Landesgeschichte, 45. Jahrgang, 1986, S. 451f.)
Allerdings soll an dieser Stelle auf einen Aspekt hingewiesen
werden, der sich bei der Erstellung der Arbeit andeutete,
inhaltlich jedoch nur bedingt Berücksichtigung finden konnte und
sich heute bestätigt hat: gleichsam die dritte Zerstörung
Würzburgs. D.h. Leistungen des Wiederaufbaus werden ignoriert,
beseitigt oder übersehen, ganz zu schweigen davon, dass immer noch
in Würzburg historische Substanz geopfert wird.
Auszug aus den Anmerkungen zur Neuauflage |
|
|
Hans Oppelt: Würzburger Chronik vom
denkwürdigen Jahre 1945.
Mit Geleitworten von Würzburgs Oberbürgermeister Dr. h.c. Hans
Löffler, dem Würzburger Bischof Matthias Ehrenfried und
Unterfrankens Regierungspräsident Dr. Adolf Körner.
Ferdinand-Schöningh-Verlag, Würzburg 1995 (Unveränderter Nachdruck
der Ausgabe von 1947). ISBN: 3-87717-801-4. |
|
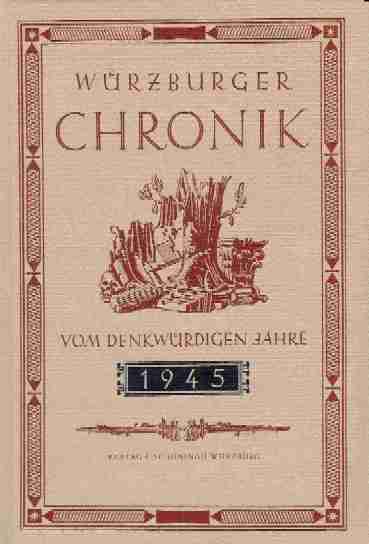
mehr Infos
bestellen
|
"Zu den schönsten, aufschlussreichsten Überlieferungen Würzburgs
zählt die Chronik, der wir das Wissen um die einzigartige, mehr
als tausendjährige Vergangenheit der alten Kiliansstadt verdanken.
Zeiten glückhaften Friedens, Jahre des Krieges und der Not,
Begebenheiten örtlicher Bedeutung und Ereignisse historischen
Ausmaßes: sie verbinden sich in diesem Geschichtswerk zu einer
bunten Folge im Wechsel der Jahrhunderte. Allein – vergeblich
suchen wir in all den vielen Aufzeichnungen auch nur ein einziges
Ereignis, das mit dem Erleben des Schicksalsjahrs
neunzehnhundertfünfundvierzig zu vergleichen wäre. Ja, welch ein
schmerzliches Jubiläum, dass rund 400 Jahre nach der erstmaligen
Niederschrift der Würzburger Chronik durch Magister Lorenz Fries
(um 1546) nun der Untergang der Stadt zu schildern ist!
Die möglichst inhaltsreiche wie anschauliche Gestaltung gerade
dieser Annalen freilich war eine äußerst umfangreiche Aufgabe,
doch glaubte ich sie am besten dann zu lösen, wenn ich über den
Rahen eigener Unterlagen und Erinnerungen hinaus auch die
Mitarbeit anderer erbat, deren persönliches Erleben oder
beruflicher Einsatz im Notjahr 1945 für die vorliegende Chronik
besonders aufschlussreich erschien. So entstand schließlich eine
Zeitgeschichte, die zumeist noch während es Katastrophenjahrs
geschrieben wurde und im wesentlichen bereits am ersten Gedenktag
des Schwarzen 16. März beendet war. Dass erst jetzt die
Veröffentlichung erfolgt, bedingte eine Reihe mannigfältiger
Schwierigkeiten, die bis zu ihrer Überwindung allerdings
verschiedene textlichen Ergänzungen gestattete.
Zeit und Umstände indessen bestimmten auch den Rahmen dieser
Arbeit, so dass es sich beispielsweise trotz weitverzweigter
Forschungen, zahlreicher Aussagen, berichte, Besprechungen und
Korrespondenzen nicht immer ermöglichen ließ, eine Begebenheit aus
ihrer eigentlichen Ursache oder bis in ihre letzte Folge
aufzuzeigen. Im wesentlichen und allgemeinen aber hoffe ich nun
doch ein klares Bild - sei es von der furchtbaren Zerstörung, dem
beginnenden Wiederaufbau oder sonst einem bedeutsamen Ereignis des
einzigartigen Jahres 1945 – der Nachwelt vermitteln zu können.
Dass ich mich hierbei um weitgehendste Objektivität der
Darstellung bemühte, schien mir oberstes Gesetz einer
voraussetzungslosen Forschung, "die nicht das findet" – wie
Theodor Mommsen einmal sagte – "was sie nach
Zweckerwägungen und
Rücksichtnahmen finden soll und finden möchte, was anderen
außerhalb der Wissenschaft liegenden praktischen Zielen dient,
sondern was logisch und historisch dem gewissenhaften Forscher als
das Richtige erscheint, in ein Wort zusammengefasst: Die
Wahrhaftigkeit. [...]
Neubrunn bei Würzburg, Sommer 1947 – Dr. Hans Oppelt"
Auszug aus dem Vorwort |
|
|
Katharina Bosl von Papp:
Würzburger in der Fremde – Fremdsein in Würzburg.
Echter-Verlag 2004. ISBN: 3-429-02628-8. |
|
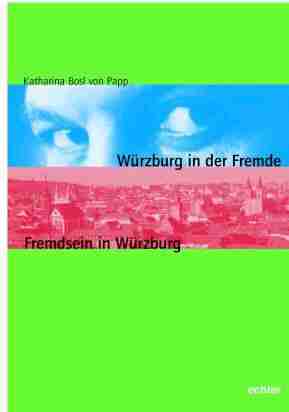
mehr Infos
bestellen
|
Die Identität einer Stadt wird bestimmt durch die Menschen, die in
ihr leben. So haben die Auswanderung aus Würzburg und die
Zuwanderung in die Mainfrankenmetropole deren wirtschaftliches und
kulturelles Leben bis in die Gegenwart geprägt. Das Buch widmet
sich diesen Migrationsbewegungen und ist so ein fundiertes und
zugleich aktuelles Lesebuch, das ein ungewöhnliches Stück
Stadtgeschichte nahe bringt und gleichzeitig die Vielfältigkeit
internationalen und interkulturellen Lebens heute aufzeigt. Der
Bogen spannt sich von Philipp von Hutten (1511 1546) über die
mainfränkische Auswanderung nach Russland und Ungarn im 18.
Jahrhundert hin zu der aktuellen Situation von Flüchtlingen im
Würzburg des 21. Jahrhunderts.
Verlagsinformation |
|
|
Jeanne E. Rehnig:
Schäfereigeschichte(n): Einblicke in die Geschichte der
Schafhaltung in Unterfranken. Bezirk Unterfranken 2004. ISBN:
3-9809330-1-6. |
|
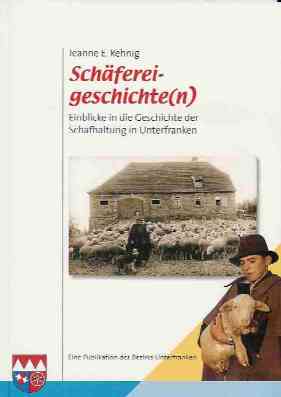
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Wer einmal längere Zeit mit einem Schäfer verbracht hat, stellt
fest, dass in jedem von ihnen eine ganze Welt von Bildern, Wissen
und Geschicklichkeiten steckt. Allein die Beobachtung der Tiere
und der Natur und die Notwendigkeit, sich stets selbst helfen zu
können, füllen einen solchen Menschen an mit Erfahrungen und
Erkenntnissen, die ganze Bibliotheken bestücken könnten. Seit
Jahrhunderten werden Wissen, Kniffe und Fachausdrücke von einer
Generation an die nächste übergeben.
Wie Schäfer in früheren Jahrhunderten gelebt und gearbeitet haben,
ist ein bisher wenig erforschtes Kapitel der unterfränkischen
Agrargeschichte gewesen. Die Ausstellung "Schäfereigeschichte(n)"
gibt als erste umfassende Arbeit zu diesem Thema Einblicke in die
historische Schäferkultur eines Naturraums, der Unterfranken heißt
und der auch schon vor Jahrhunderten zu den schafreichen
landstrichen in Deutschland zählte. Die Hinwendung zu diesem Thema
durch die Bezirksheimatpflege sichert damit wertvolles Material.
Zu den Autorinnen
Dr. Jeanne E. Rehnig M.A. (Berlin), geboren in Würzburg,
aufgewachsen in Kitzingen, studierte Volkskunde, Kunstgeschichte
und Germanistik in Würzburg. Ausbildung zur
Multimedia-Projektmanagerin, Promotion zur Dr. phil. Langjährige
Mitarbeiterin der Redaktion Kultur der Main-Post, Würzburg.
Freiberuflich tätig in den Bereichen Text, Konzeption und
Gestaltung von Ausstellungen. Projekte für öffentliche Träger,
private Auftraggeber und große Projektgesellschaften.
Vorträge und Veröffentlichungen zur Industrie-, Regional- und
Fotografiegeschichte sowie zur Bildenden Kunst. Gastvorträge an
der FHTW Berlin, Fachbereich Museologie.
Verlagsinformation |
|
|
Ulrich Wagner (Hrsg.): Geschichte der Stadt Würzburg. Drei Bände.
Theiss-Verlag 2001/2004/2007.
ISBN: 3-8062-1465-4 (1. Band) / 3-8062-1477-8 (2. Band) /
3-8062-1478-6 (3. Band). |
|
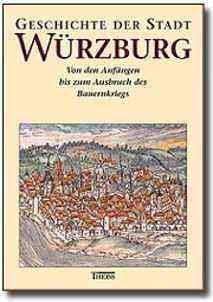
Band 1: 704 bis 1525
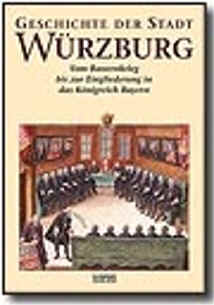
Band 2: 1525 bis 1814
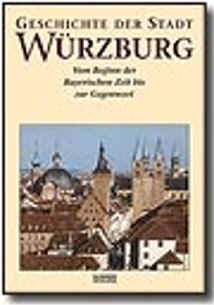
Band 3: 1814 bis 2004
mehr Infos
bestellen
|
704 bis 2004 –
1300 Jahre Stadt Würzburg
Das Stadtjubiläum ist der passende Anlass für die neue, umfassende
Stadtgeschichte, die fesselnden Lesestoff bietet und zugleich
hohen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Das Spektrum der
Themen umfasst die politische Geschichte ebenso wie die Sozial-,
Kirchen- und Kulturgeschichte. Die Bände schildern die einzelnen
Bereiche städtischen Lebens in ihren wechselseitigen
Zusammenhängen und stellen so die prägenden Kräfte der
Stadthistorie auf besonders anschauliche Weise dar. Dabei wurde
großer Wert auf leichte Lesbarkeit für ein breites, historisch
interessiertes Publikum gelegt. Zahlreiches
Bildmaterial, Karten, Grafiken und Tabellen erläutern die
Darstellung.
Band I
(vergriffen)
Von den Anfängen bis zum Ausbruch des Bauernkriegs.
Herausgegeben im Auftrag der Stadt Würzburg von Ulrich
Wagner.
Theiss-Verlag 2001. ISBN 3-8062-1465-4.
66,00 Euro (Einzelpreis).
Von den ersten Siedlungsspuren bis zum Beginn der Neuzeit:
Der erste Band behandelt die Geschichte des Herzogs- und
Bischofssitzes bis zum Ausbruch des Bauernkriegs – auf der Basis
des heutigen Wissensstandes, ergänzt durch neue, aus den Quellen
erarbeitete Forschungsergebnisse. Der Bogen spannt sich von der
Stadt des Königs als Ort des Burggrafen bis zu den Aufständen der
Bürgerschaft gegen die Macht ihrer Fürsten.
Band II
Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Übergang an Bayern 1814.
Herausgegeben im Auftrag der Stadt Würzburg von Ulrich Wagner.
Theiss-Verlag 2004. ISBN 3-8062-1477-8.
66,00 Euro (Einzelpreis).
Band 2 umfasst den Zeitraum zwischen 1525 und 1814.
Die Themen sind u.a.: Das Hochwasser
von 1784, Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), Fürstlicher
Absolutismus und barocke Stadt (1648-1795), Stadt und Kirche,
Sozialgeschichte, Hexenprozesse, Architektur und bildende Kunst.
Band III
Die bayerische Zeit von 1814 bis zur Gegenwart.
Herausgegeben im Auftrag der Stadt Würzburg von Ulrich Wagner.
Theiss-Verlag, voraussichtlich 2006. ISBN 3-8062-1478-6.
66,00 Euro (Einzelpreis).
Band 3 umfasst den Zeitraum zwischen 1814 und 2000.
Die Themen sind u.a.: Kaiserreich,
1. Weltkrieg, Revolution, Weimarer Republik, 3. Reich und 2.
Weltkrieg, Wiederaufbau, Die moderne Großstadt, Umweltgeschichte,
Stadt- und Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsgeschichte -
Industrialisierung, Würzburg als Garnisonsstadt, Theater, Musik,
Geselligkeit, Sport.
Verlagsinformation
Bestellen Sie telefonisch
oder per Mail:
Tel. 0931/35591-0,
fachbuch@neuer-weg.com |
|
|
Umweltreferat & Stadtarchiv Würzburg (Hrsg.): Der Würzburger
Ringpark. Kulturdenkmal und Naherholungsgebiet.
Schöningh-Verlag Würzburg 1996. ISBN: 3-87717-778-6.
Sonderpreis: Jetzt nur 4,80 Euro. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Der Würzburger Ringpark feierte 1996 seinen 100. Geburtstag. Im
Jahr 1896 war die Umgestaltung der Glacisanlagen zu einem der
schönsten Parks Deutschlands größtenteils abgeschlossen. Dies ist
Anlass zu Erinnerung und Rückblick.
Dank der Initiative des städtischen Umweltreferats und des
Stadtarchivs können wir diese Publikation zum Entstehen und zur
Geschichte des städtischen Ringparks der Öffentlichkeit vorlegen.
Es wird deutlich, dass Gärten und Parks nicht naturgegeben sind,
sondern in einer vom Menschen geformten Kulturlandschaft erst
geschaffen und insbesondere auch erhalten werden müssen. Die
Geschichte des Parks kann daher nicht nur Rückblick auf dessen
Entstehen und werden sein, vielmehr zielt sie darauf, die
gegenseitige Abhängigkeit von Natur und Stadtkultur bewusst zu
machen und die Verpflichtung zu unterstreichen, den Ringpark auch
zukünftig in seinem Bestand zu sichern. Mit dem vorausblickenden
Bürgermeister Dr. Georg Zürn, dem hochbegabten Stadtgärtner Jens
Person Lindahl sowie seinem vorzüglichen Nachfolger Engelbert
Sturm werden die Urheber dieses Parks sichtbar. Erinnert wird in
diesem Heft aber auch an die Bürger der Stadt, die zusammen mit
dem Verschönerungsverein und anderen Institutionen stets ihre
schützende Hand über den Park hielten und zu dessen
Weiterentwicklung beitrugen. So präsentiert sich der Ringpark
heute als ein gut erhaltener Bestandteil des alten Würzburgs, der
trotz mannigfacher Veränderungen seinen ursprünglichen Charakter
bewahrt hat und nach wie vor zu den großzügigen Anlagen des
bürgerlichen Zeitalters europäischer Gartenkultur zählt.
Zum Gelingen dieser Publikation haben viele beigetragen. Besonders
zu danken ist dem städtischen Umweltreferenten, Herrn Dr. Matthias
Thoma, dem städtischen Gartenamt mit Herrn Alfred Büstgens und
Herrn Dieter Müller, sowie Herrn Dr. Ulrich Wagner und Frau
Sybille Grübel vom Stadtarchiv Würzburg. Herr Adolf Wolz hat das
Heft dankenswerterweise in sein Publikationsprogramm aufgenommen.
Mitgewirkt haben bei der Gestaltung Herr Ernst Weckert und Herr
Andreas Bestle vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Statistik. Zu
danken ist vor allem Herrn Ulrich Heid, der die Texte erarbeitet,
sowie Herrn Raftopoulo vom Naturwissenschaftlichen Verein, der die
besonders markanten Bäume des Parks beschrieben hat.
Dem Heft wünsche ich eine weite Verbreitung in der Öffentlichkeit
und hoffe, dass es viele Bürger und Gäste der Stadt zu einem
Rundgang durch den Park veranlasst und ihnen dessen Schönheit und
kulturgeschichtliche Bedeutung näher bringt.
Vorwort von Jürgen Weber,
Oberbürgermeister der Stadt Würzburg (1990-2002) |
|
|
Karlheinz Müller: Die
Würzburger Judengemeinde im Mittelalter. Von den Anfängen um
1100 bis zum Tod Julius Echters (1617). Herausgegeben von den
Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg.
HartDruck Volkach 2004. ISBN: 3-9800538-0-6. |
|
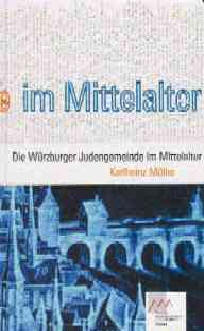
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Dieses Buch bemüht sich, das Wissen über die "Würzburger
Judengemeinde im Mittelalter" auf den neusten Stand zu bringen.
Verwiesen sei dabei auf einige Besonderheiten in der Zielsetzung,
welche die Darstellung maßgebend bestimmen.
1. Es wird – mehr als das bislang der Fall war – darauf geachtet,
das Ergehen und das Handeln der mittelalterlichen Judengemeinde in
Würzburg als Bestandteil und Faktor eines weit umfassenderen
Geschehens zu begreifen. Es werden also nicht nur alle verfügbaren
jüdischen (hebräischen) Quellen neu gesichtet, neu übersetzt und
in einem nicht unerheblichen Ausmaß neu zugeordnet. Sondern es
geht auch darum, sorgfältiger als bisher die jeweils zeitgleichen
Bewegungen des Bistums, der Großkirche, der Stadt und des Reiches
zu beobachten, die stets in einem näheren oder entfernteren
Zusammenhang mit der Geschichte der Juden stehen.
2. Die Gemeinde der Würzburger Juden war wie alle Gemeinden der
Juden im Mittelalter eine "traditionelle Gesellschaft". Das meint:
sie war eine Gesellschaft, die auf eigenen Traditionen ruhte. Das
ließ es geraten erschienen, die "Halacha" – das geltende jüdische
"Gesetz" – ständig im Auge zu behalten, um auch von dort aus die
Reaktionen der Juden Würzburgs auf die Herausforderungen durch die
unterschiedlichen christlichen Machthaber zu verstehen.
3. Neu ist auch die Einbeziehung der 1508 Grabsteine und
Grabsteinfragmente, die 1987 aus dem Abriss eines Gebäudes im
Würzburger Stadtteil "Pleich" geborgen werden konnten. Es ist die
größte Hinterlassenschaft aus einem mittelalterlichen
Judenfriedhof weltweit.
4. Erstmals wird im Folgenden die Geschichte der "Würzburger
Judengemeinde im Mittelalter" mit allen erreichbaren
Einzelheiten bis zum Tod des Fürstbischofs Julius Echter
durchgeschrieben. Die ungewöhnliche Dehnung des ausgehenden
"Mittelalters" bis zum Jahr 1617 empfiehlt sich indessen, sobald
man berücksichtigt, dass Julius Echter das letzte Stück jüdischen
Mittelalters in der Stadt Würzburg liquidierte, indem er zwischen
1576 und 1578 gegen die Proteste der Juden und die Einsprüche des
Kaisers sein "Julius-Spital" über dem Friedhof errichten ließ, auf
dem seit 1147 die im Bistum Würzburg lebenden Juden ihre Toten
begruben. Erst damit endet die Geschichte der "Würzburger
Judengemeinde im Mittelalter" wirklich.
Auszug aus dem Vorwort
Zum Herausgeber
Spätestens seit dem Jahr 1100 spielen Juden in Würzburg eine
erhebliche Rolle. Die "Freunde Mainfränkischer Kunst und
Geschichte e.V." sind sich dessen immer bewusst gewesen. Sie haben
hier stets eine besondere Verantwortung verspürt: auf ganz
verschiedenen Ebenen ermutigten oder förderten sie einschlägige
Bemühungen um die Geschichte der Juden in Unterfranken und
wiederholt brachten sie monographische Studien zu diesem Thema auf
den Weg. Deshalb sagten sie auch gerne zu, als man ihnen die
verlegerische Betreuung und die Herausgabe der Arbeit von
Karlheinz Müller über "Die Würzburger Judengemeinde im Mittelalter
antrug.
Zum Autor
Prof. Dr. Karlheinz Müller lehrt Katholische Theologie am Institut
für Biblische Theologie der Universität Würzburg.
Verlagsinformation
Mehr Informationen:
-
Pressemitteilung
der Jüdischen Gemeinde und der Freunde Mainfränk.Kunst und
Geschichte e.V. (09.03.2004)
-
Buch-Tipp: Die Würzburger Judengemeinde im Mittelalter
(POW, 17.03.2004) |
|
|
Joachim Fildhaut: Würzburg.
Stadtgeschichten. Sutton-Verlag 2004. ISBN: 3-89702-648-1. |
|
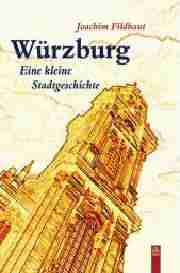
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Pünktlich zur 1300-Jahr-Feier der ersten urkundlichen Erwähnung
Würzburg spürt der freie Journalist Joachim Fildhaut mit der
Neugier des Zeitreisenden die zentralen Knotenpunkte der
Stadtgeschichte auf. Dabei stehen nicht nur Kaiserbesuche, Kriege
und Kirchenbauten im Mittelpunkt. Stets stellt Fildhaut auch die
Frage, wie sich diese "Staatsaktionen" auf das Leben des kleinen
Mannes auswirkten.
Der Leser betrachtet Wohlbekanntes aus neuen Blickwinkeln und
erfährt zahlreiche unbekannte Details: Wie wurden die Bischöfe zu
Fürsten? Wer konnte sich jeden Tag Brot leisten und wer nur
Hirsebrei? Wo floss der Main eigentlich früher durch Würzburg? Wie
wurde die mittelalterliche Stadt bis in die Metzgerstuben und die
dortigen Hygieneverhältnisse geregelt und verwaltet? Wann wäre
Würzburg beinahe evangelisch geworden? Wie hart mussten die
Stadtbürger ihrer Herrschaft jahrhundertelang bessere
wirtschaftliche Chancen abtrotzen?
Vom Marienberg herab blickt der Leser auf die unterfränkische
Metropole im Wandel der Jahrhunderte. Er folgt den Spuren der
berühmtesten Köpfe der Stadt wie Tilman Riemenschneider, Julius
Echter oder Balthasar Neumann und begleitet den Wandel von der
spätbarocken Residenz zur modernen Industrie- und
Universitätsstadt.
So konzentriert und kurzweilig wie Fildhaut, der seit über 20
Jahren der Kulturgeschichte Würzburgs mit feuilletonistischen
Mitteln nachspürt, hat noch niemand die Entwicklung der Stadt von
grauer Vorzeit bis in die Gegenwart beschrieben.
Zum Autor
Joachim Fildhaut, geboren 1956, lebt seit 1979 in Würzburg. Er
studierte Germanistik und Philosophie in Düsseldorf und Würzburg
und arbeitet seit 20 Jahren als Journalist für regionale
Zeitschriften. Neben populären historischen Abhandlungen
veröffentlichte er im Reisemagazin Globo, in Gute Fahrt, Kowalski,
WAZ, Main Post u.v.m.
Hinter und auf den Bühnen der Stadt taucht er als Mitorganisator
des Jazzfestivals sowie als Sänger und Rezitator eigener
Nonsenspoesie auf. Ursprünglich nur auf ein Gastsemester in
Würzburg eingerichtet, ist er "gern hier hängen geblieben." Mit
vielen Wahl-Würzburgern teilt er die Auffassung, dass die Stadt
"gerade die richtige Größe hat – weder zu provinziell noch zu
unübersichtlich".
Verlagsinformation |
|
|
Marianne Erben: Von Kilian
bis Kiliani. Den Frankenaposteln auf der Spur. Echter-Verlag
2004. ISBN: 3-429-02579-6. |
|
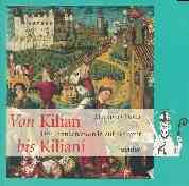
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Würzburg wird die Kiliansstadt genannt. Da steht
der Kiliansdom, gleich daneben Neumünster mit dem Kiliansschrein
über dem Kiliansgrab in der Kiliansgruft, und dazwischen der
Kiliansplatz mit einer Kiliansstatue und dem Kilianshaus. In der
Domstraße werden beim Kiliansbäck Kiliansweck angeboten, auf der
Alten Mainbrücke ist der hl. Kilian die meistfotografierte Figur,
und am 8. Juli, dem Kilianstag, kommen die Kilianswallfahrer und
besuchen nach dem Gottesdienst die Kiliansmesse auf dem Marktplatz
und das Kilianifest auf der Talavera. Wer also war Kilian? In
diesem Buch soll von ihm berichtet und erzählt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Tatsache – Legende
- Passio Sancti Kiliani
- Aus Irland ist Kilian gekommen
- Vom Aussehen irischer Wandermönche
- Das östliche Frankenland
- Wirciburc – der fremde Ort
- Warum Kilian, Kolonat und Totnan sterben mußten
- Das Martyrium
- Strafgericht und Ende der Herzogsfamilie
- Bischof Burkard
- Drei Heilige
- Wunder am Kiliansgrab
- Ein erster Dom
- Das Kiliani-Fest
- Wallfahrer – Steuerzahler
- Das Kiliansbanner
- Der Heilige mit dem Schwert
- Nicht immer hoch verehrt
- Eine besondere Wallfahrt
- Der neue Kiliansschrein
- Kilian wirkt fort
Verlagsinformation |
| |
|