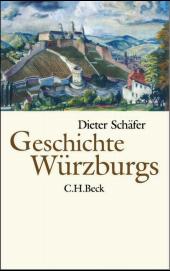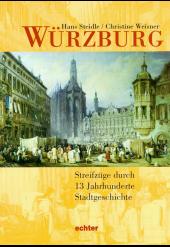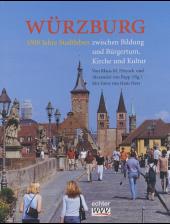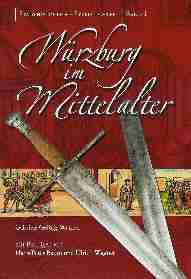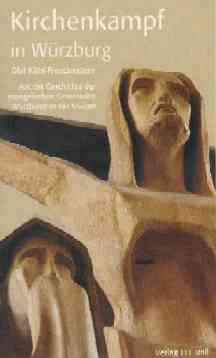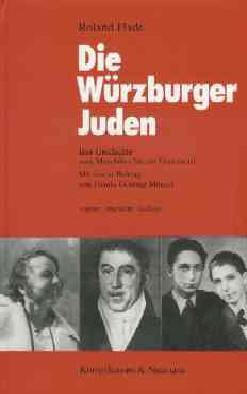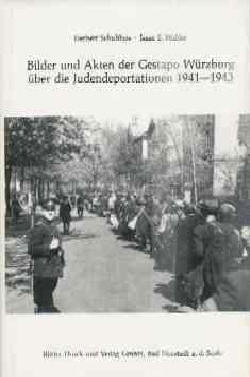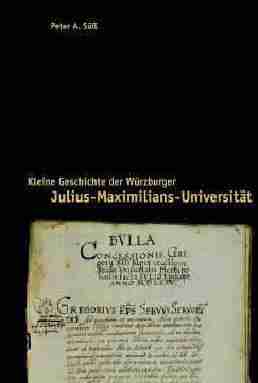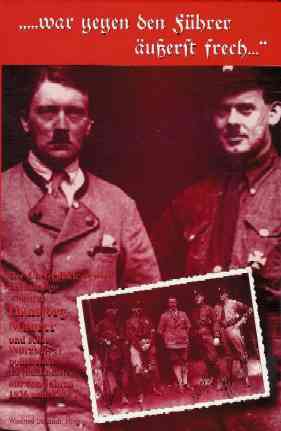|
Geschichte alt
(Bücher 1988-2003) |
|
|
|
Dieter Schäfer: Geschichte
Würzburgs. 1300 Jahre – die Stadtgeschichte zum Jubiläum. C.H.
Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-51011-6. |
|
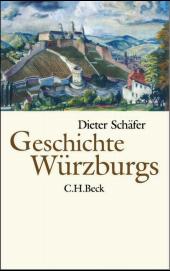
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Im Mai 2004 blickt Würzburg auf 1300 Jahre Stadtgeschichte zurück.
Dieter Schäfer erzählt in diesem reich illustrierten Band die
bewegte Geschichte der Stadt der Fürstbischöfe und schildert ihre
Entwicklung aus einer frühgeschichtlichen Ansiedlung an einer Furt
über den Main zu einer der schönsten Städte Europas.
In 22 Kapiteln wird
hier die Geschichte der Stadt Würzburg erzählt: von der ersten
urkundlichen Erwähnung im Jahre 704 bis
zur Gegenwart. Dieter Schäfer schildert den fast 1000 Jahre
währenden Einfluss der Fürstbischöfe und
die vergeblichen Emanzipationsbestrebungen der Bürger, die
Bedeutung von Wirtschaft und Handel, der Wissenschaften und des
Weines sowie die glanzvolle Epoche der Schönbornzeit, die für die
Baukunst des 18. Jahrhunderts Maßstäbe setzte und optimale
Voraussetzungen für die berühmtesten Künstler der Zeit schuf,
darunter Balthasar Neumann und Giovanni Battista Tiepolo. Aber
auch die dunklen Zeiten der Stadt als "Gauhauptstadt", der Umgang
mit der jüdischen Bevölkerung kommen hier zur Sprache.
Würzburg ist heute wirtschaftliches und kulturelles Zentrum
Unterfrankens und ein Wissenschaftszentrum von hohem Rang. Die
bedeutendsten Kunstdenkmäler konnten nach der Zerstörung wieder
aufgebaut werden, so dass der Besucher auch
heute noch den früheren Glanz der Stadt erahnen kann.
Zum Autor
Dieter Schäfer, promovierter Historiker, lebt seit 1953 in
Würzburg. 27 Jahre lang hat er als IHK-Hauptgeschäftsführer an der
Nachkriegsentwicklung Würzburgs mitgewirkt. Der Universität
Würzburg ist er als Lehrbeauftragter und seit 1972 als
Honorarprofessor für Wirtschaftsgeographie verbunden.
Verlagsinformation |
|
|
Hans Steidle/Christine Weisner:
Würzburg. Streifzüge durch 13 Jahrhunderte Stadtgeschichte.
Echter-Verlag 1999. ISBN: 3-429-02108-1. |
|
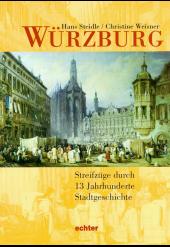
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Schon lange wurde nicht mehr
der Versuch unternommen, einem breiten, interessierten Publikum
die 1300-jährige Geschichte der Stadt
Würzburg anschaulich und lebendig nahe zu
bringen. Es ist ein Lesebuch entstanden,
das Geschichte spannend erzählt, die Lebenswelt im Wandel der Zeit
darstellt und dem Alltag der Bürgerinnen und Bürger nachspürt.
Ein Jahrtausend lang regierten die Bischöfe über Stadt und
Menschen. Das prägte weit über diesen Zeitraum
hinaus nicht nur das Gesicht und die Kultur der Stadt,
sondern auch die Mentalität ihrer Bewohner. Die Streifzüge durch
die Jahrhunderte beleuchten die Geschichte Würzburgs von vielen
Blickwinkeln, ordnen seine Entwicklung in die großen historischen
Zusammenhänge ein, setzen Schwerpunkte und werfen Fragen auf. In
der Bebilderung ihrer Darstellung kommt es den Autoren besonders
darauf an, den LeserInnen
Geschichte vor Ort an konkreten Objekten erlebbar zu machen.
"Die Axt an der Wurzel", so lautete das Bild des revolutionären
Freiheitskampfes in Würzburg 1525. Kampf um die Freiheit der
Bürger und die bürgerlichen Freiheiten hat eine alte Tradition in
Würzburg. Diese Stadt war nicht nur fürstliche Residenz oder gar
ein Nest kriecherischer Untertanen. Die Stadt hat eine Geschichte
des bürgerlichen und demokratischen Freiheitskampfes,
dem im Mittelalter der Zahn gezogen wurde und der
deshalb im Bewusstsein der heutigen Bürger nicht genügend
verankert ist. Demokratie musste seit 750 Jahren mit manchen
Siegen und vielen Niederlagen erkämpft werde. Personen, Ereignisse
und Perspektiven soll dieser Vortrag näherbringen und erhellen.
Zum Autor
Dr. Hans Steidle, Dr. phil., geboren 1951.
Historiker, Lehrer am städtischen Mozart-Gymnasium in Würzburg;
Publikationen zur mittelalterlichen und neuen Geschichte sowie zu
Literaturgeschichte; Schulbuchautor und Mitautor des Stadtführers
"Frauen in Würzburg". Hans Steidle hat zu
diesem Band über die Stadtgeschichte Würzburgs den ersten Teil
verfasst, der die Entwicklung bis zum Ende
der fürstbischöflichen Herrschaft (S. 149) darstellt.
Christine Weisner, M. A., geboren 1958.
Freie Historikerin; tätig in der Erwachsenenbildung, in
verschiedenen Projekten zur Frauen- und Regionalgeschichte;
Mitautorin und Redakteurin des Stadtführers "Frauen
in Würzburg".
Verlagsinformation |
|
|
Klaus M. Höynck/Alexander von Papp
(Hrsg.): Würzburg:
1300 Jahre Stadtleben zwischen Bildung und Bürgertum,
Kirche und Kultur. Mit Fotos von Hans
Heer. Echter-Verlag 2003. ISBN:
3-429-02532-X. |
|
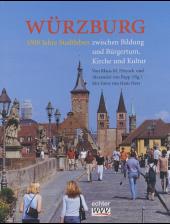
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Eine thematische Geschichte der Stadt
Würzburg
Die erste urkundliche Erwähnung im Jahre 704 ist für die Stadt
Würzburg Anlass auf 1300 Jahre Geschichte zurück zu blicken. Diese
bewegte und spannende Historie greift der opulent ausgestattete
Band "Würzburg – 1300 Jahre Stadtleben zwischen Bildung und
Bürgertum, Kirche und Kultur" auf und zeigt in 40 Beiträgen
ausgewiesener Fachleute vielfältige, zum Teil bisher unbekannte
Aspekte von Alltag, Politik, Kunst und Kultur auf. Dabei steht
nicht der chronologische Ablauf der Ereignisse im Vordergrund,
sondern – nach Themen gegliedert – die Entwicklung der Stadt von
einer frühen germanischen Siedlung hin zu einem modernen Zentrum
für Wirtschaft, Handel, Kultur und Wissenschaft.
Zu den Herausgebern
Alexander von Papp ist Kulturamtsleiter der Stadt Würzburg.
Klaus M. Höynck ist freier Autor und Träger des Publizistikpreises
des Verbandes Bayerischer Bezirke.
Verlagsinformationen |
|
|
Gabriele Geibig-Wagner (Hrsg.)/Hans-Peter Baum/Ulrich Wagner:
Würzburg im Mittelalter. Stadthistorische Streiflichter. Band
I. Elmar-Hahn-Verlag 2003. ISBN: 3-928645-29-3. |
|
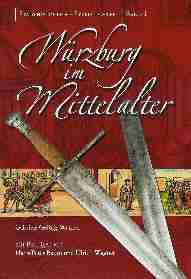
mehr Infos
bestellen
|
Von 704 bis 2004:
1300 Jahre Geschichte Würzburgs
"In castello Virteburch": mit einer am 1. Mai 704 auf der
Würzburger Burg ausgestellten Urkunde beginnt die offizielle
Geschichte der heutigen Mainmetropole, hier wird sie zum ersten
Mal mit gesichertem Datum genannt. Würzburg kann also im Jahr 2004
auf 1300 Jahre Geschichte zurückblicken, eine gewaltige
Zeitspanne, angefüllt mit politischen Ereignissen, kriegerischen
Auseinandersetzungen und persönlichen Schicksalen.
In diesem ersten Band wird die städtische Historie von ihren
schriftlich belegten Anfängen im frühen Mittelalter bis zum
Zeitalter der Reformation am Anfang des 16. Jahrhunderts in
kurzen, anschaulichen Texten sowie in der Gegenüberstellung von
zahlreichen historischen und aktuellen Abbildungen gleichermaßen
unterhaltsam wie auch wissenschaftlich fundiert dargestellt. Der
zweite Band wird sich an der Epoche vom Bauernkrieg bis 1814 und
der dritte am 19. und 20. Jahrhundert bis 2002 orientieren.
In zwölf Kapiteln haben Dr. Hans-Peter Baum und Dr. Ulrich Wagner
in diesem ersten Band Kurioses und Interessantes zusammengetragen,
das sie im Stadtarchiv gefunden haben. So lag in Würzburg schon
immer die Weisheit im Wein: Durch die Exportsteuer gelang es
Fürstbischof Rudolf von Scherenberg, das im 15. Jahrhundert schwer
verschuldete Hochstift Würzburg binnen drei Jahren aus seiner
finanziellen Krise zu befreien. Auch die Selbstjustiz der
Würzburger bleibt nicht unerwähnt: Hans Hase war als Informant des
kriegerischen Fürstbischofs Johann von Grumbach (1455-1466) der
Bevölkerung verhasst. Nach dem Tod des Bischofs wurde Hase von
einer aufgebrachten Menge gefesselt und von der Mainbrücke
geworfen.
Mit kurzen, verständlichen texten soll das Buch laut Herausgeberin
Dr. Gabriele Geibig-Wagner seinen Lesern die Würzburger
Stadtgeschichte nahe bringen. "Wir sollen diejenigen ansprechen,
die immer vor dicken Wälzern zurückschrecken." Der Band enthält
deswegen zahlreiche historische Illustrationen, die aktuellen
Fotografien gegenübergestellt sind. "So kann der Leser einen
Vergleich zwischen dem jetzigen Würzburg und dem des Mittelalters
ziehen", betont Geibig-Wagner.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
Würzburg im Mittelalter (Bistum Würzburg) |
| |
|
Olaf
Kühl-Freudenstein: Kirchenkampf in Würzburg.
Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinden Würzburgs in der
NS-Zeit. Mit Geleitworten von Dekan Dr. Günter
Breitenbach und Prof. Dr. Horst F. Rupp. J.H. Röll-Verlag 2003.
ISBN: 3-89754-218-8. |
|
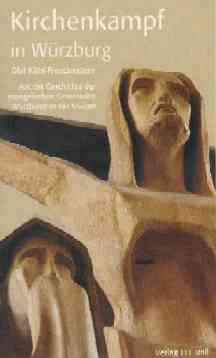
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Christus oder Hitler
– Kreuz oder
Hakenkreuz: Das waren die Entscheidungen, vor die sich die
evangelischen Christen in der NS-Zeit gestellt sahen und die
Auseinandersetzungen in den Gemeinden hervorriefen, die unter dem
Begriff "Kirchenkampf" in die Geschichte eingegangen sind.
Anlässlich des 200. Geburtstags der Evangelischen Kirche in
Würzburg im Jahr 2003 wird mit diesem Buch erstmals der Kampf um
das evangelische Bekenntnis in der Mainstadt dargestellt. In zwölf
mit zahlreichen Abbildungen illustrierten Kapiteln werden die
zunehmenden Bedrohungen nachgezeichnet, denen sich die Würzburger
evangelischen Christen damals ausgesetzt sahen. Manche Abwege
werden dabei zur Darstellung gebracht, aber auch zahlreiche
Beispiele für das mutige Festhalten am evangelischen Bekenntnis.
Klappentext
Das Buch "Kirchenkampf in Würzburg" enthält
–
sichtbar aus den Geleitworten des Würzburger Dekans Dr.
Breitenbach
–
die offizielle Sichtweise der protestantischen Amtskirche in
Würzburg auf ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus.
Dementsprechend geschönt fällt die Analyse und insbesondere die
Wertung am Ende des Bandes aus.
Fragwürdig ist bereits der Ansatz der Studie: Es wird lediglich
danach gefragt, wie stark die von Hitler gewünschte NS-Kirche, die
"Glaubensbewegung Deutsche Christen" (DC), in Würzburg und Bayern
verankert war. Doch viel entscheidender als die reine
Organisationszugehörigkeit wäre die Frage gewesen, inwiefern sich
führende Mitglieder der protestantischen Kirche in Würzburg und
Bayern persönlich schuldig gemacht haben durch ihr Schweigen
gegenüber oder sogar ihre Zustimmung und Unterstützung für die
Verbrechen des NS-Regimes. Dieser Aspekt wird großenteils
ausgeklammert, so z.B. die wichtige Frage, wie viele Priester
Mitglied der NSDAP waren.
Auch die unselige Rolle, die der bayerische Landesbischof und
überzeugte Antisemit Hans Meiser gegenüber dem Nationalsozialismus
spielte, wird unterschlagen. Meiser forderte bereits in der
Weimarer Republik, Ende der 20er Jahre, Maßnahmen gegen die "Verjudung
unseres Volkes" wie z.B. Berufsverbote, Kennzeichnung usw. 1931
erklärte er, "wir erwarten uns von der NSDAP viel". Später wehrte
er sich dagegen, auf kirchlichen Synoden über das Thema
"Judenverfolgung" zu sprechen. Über den Transport geistig
Behinderter aus den evangelischen Einrichtungen in die Gaskammern
wusste er Bescheid, doch sagte er nichts dazu. Der ihm
unterstellte evangelische Arzt im Kirchendienst forderte die Nazis
auf, dieses Leben "dem Schöpfer zurückzugeben".
Meiser konnte auch nach dem 2. Weltkrieg ungestört weiter
amtieren. In München ist sogar eine Straße nach ihm benannt. In
dem Buch wird Meiser jedoch als entschiedener Nazigegner und
glaubenstreuer Protestant dargestellt. Wenn dies angesichts der
geistigen und tatsächlichen Kollaboration Meisers mit dem
Nationalsozialismus der ethische Maßstab ist, dann müssten
allerdings auch die meisten geistigen Brandstifter des NS-Regimes
von Schuld freigesprochen werden, z.B. der Herausgeber des
antisemitischen STÜRMER, Julius Streicher. Dies kann doch nicht
das Ziel des Bandes sein?
An keiner Stelle wird auch darauf eingegangen, wie stark bereits
Martin Luther als Begründer der evangelisch-lutherischen Kirche
Traditionen gelegt hat, welche die protestantische Kirche mitsamt
einem Großteil ihrer Gläubigen direkt in die Arme des NS-Regimes
getrieben hat. Drei Viertel der deutschen Protestanten wählten
schon 1933 die NS-nahe "Glaubensbewegung Deutsche Christen" (DC)
in die protestantischen Kirchenvorstände. Erst als sich die
Gleichschaltung auch massiv gegen die Kirchen richtete, bahnte
sich erstes Misstrauen zwischen vielen Christen und dem Nazi-Staat
an.
Luthers fragwürdige bis menschenverachtende Ansichten zu Frauen,
Juden, gesellschaftlichen Randgruppen (z.B. Behinderte) und zum
Kadavergehorsam gegenüber der Obrigkeit waren derart
anschlussfähig an die nationalsozialistische Ideologie, dass sich
Adolf Hitler bereits 1923 und der STÜRMER-Herausgeber Julius
Streicher, sogar noch bei den Nürnberger Prozessen am 29. April
1946 in ihrem Antisemitismus auf Martin Luther beriefen.
All dies fehlt in dem kompakten Band, der jedoch zumindest einen
Anfang leistet bei der Vergangenheitsbewältigung der
protestantischen Kirche in Würzburg. Er ist nicht zuletzt aufgrund
der vielen zitierten Einzelquellen empfehlenswert – als Fundgrube
sowie als Grundlage für weitere, tiefer gehende Recherchen.
Michael Kraus
Zum Autor
Olaf Kühl-Freudenstein, 1965 in Berlin geboren, Lehramtsstudium
und Referendariat in Berlin, Wiss. Mitarbeiter an der Universität
Würzburg, Promotion 2002, zur Zeit Lehrbeauftragter und
Religionslehrer in Würzburg.
Klappentext
Weitere Informationen:
-
Martin
Luther und die Juden (Ursula Hohmann)
-
Der lange Weg zum
Holocaust (John Weiss)
-
Diskussion über Martin Luther (Wikipedia, die freie Enzyklopädie)
-
Luther –
ein reaktionärer Film im Kino (Indymedia)
-
Antisemitismus:
Vom religiösen Antijudaismus bis zur "Endlösung" (www.shoa.de)
-
Luther (Peter
Möllers Philolex)
-
Luther-Zitate (Rudolf O. Brändli)
-
Auge um Auge – 2000 Jahre christlicher Antijudaismus
(Telepolis) |
| |
|
Achim Laude/Wolfgang Bausch: Der
Sport-Führer. Die Legende um Carl Diem. Verlag
Die Werkstatt 2000. ISBN: 3-89533-295-X. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Dieses Buch hat im Vorfeld der Olympischen
Sommerspiele 2000 für Diskussionen
gesorgt. Carl Diem,
Olympia-Organisator von 1936 und Gründer der Sporthochschulen
Berlin und Köln, gilt bis heute als legendäre Figur der deutschen
Sportgeschichte. Weniger bekannt sind seine damaligen Annäherungen
an die nationalsozialistische Ideologie. Diems Mythos geriet ins
Zwielicht, als sich der ehemalige ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel
an eine pathetische Durchhalterede Diems vom März 1945 erinnerte.
Diem hatte sich im November 1944 zum
Volkssturm in Berlin gemeldet
– aus freien Stücken im Alter von 62
Jahren. Wenige Wochen vor Kriegsende hielt er eine letzte
Opferrede auf dem Berliner Reichssportfeld, in der er
Minderjährige aufforderte, für ihr Vaterland in den Tod zu ziehen.
Das Buch berichtet ausführlich über Diems Wirken während der
Nazi-Zeit. Erstmals veröffentlichte Dokumente belegen, dass Diem
jahrelang kriegsverherrlichende Propaganda und Durchhalteparolen
verbreitete. Bereitwillig hielt Diem Dutzende von Vorträgen im
Rahmen der Truppenbetreuung, um dabei den Opfertod für das
Vaterland nach dem antiken Vorbild des Spartaners Leonidas und
seiner Gefolgsleute am Thermopylenpass zu idealisieren. Das
offizielle Bild eines politisch integren Sportführers beruht auf
Fälschungen oder Unkenntnis. Der Fall Diem ist dabei exemplarisch
für eine unzulängliche Aufarbeitung der nationalsozialistischen
Vergangenheit im deutschen Sport.
Rezensionen
"Es gibt keine Person, anhand derer sich
die Geschichte der Lügen (Anm.: im deutschen Sport) besser
nachzeichnen lässt als am einflussreichsten deutschen
Sportpolitiker der Nachkriegszeit: Carl Diem, der 1936 die
Olympischen Spiele zu einer erfolgreichen Propaganda-Show für das
NS-Regime machte und vielen Kräften des Sportbetriebs heute noch
als Übervater gilt. ‘Der Sport-Führer’ ist dazu die erste
umfängliche Abhandlung, die sich an ein breiteres Publikum
richtet." (KONKRET, "Buch des Monats")
"Diems Aktivitäten im NS-Sport sind
Fachleuten bekannt, werden von den Autoren aber teilweise neu
gedeutet. Neu sind auch die detailliert vorgetragenen Aktivitäten
Diems nach 1936. Der Olympier wird hier geschildert als gerissener
Diplomat, der im NS-Auftrag die Olympische
Bewegung nicht nur vereinnahmen, sondern gleichschalten wollte und
damit der Propaganda der NSDAP enormen Vorschub leistete... Der
Streit um Diems geistiges Erbe ist noch nicht endgültig
ausgefochten." (Frankfurter Allgemeine
Zeitung)
"Das Buch über Carl Diem zeigt neue
Angriffspunkte in der Vita des Sportorganisators auf und sorgt für
Nährstoff emotionsgeladener Diskussionen. Doch nicht nur Diem
selbst wird angeklagt, sondern auch der Umgang mit dem Material
des von Karl Lennartz geleiteten Diem-Archivs, in dem Einzelheiten
um den Gründer der Sporthochschule aus der nationalsozialistischen
Zeit bewusst verschleiert worden seien.“ (taz –
Die Tageszeitung)
Zu den Autoren
Achim Laude, geboren 1972, ehemaliger
Leistungssportler (Zweiter bei Deutschen
Meisterschaften mit der 4x100-m-Staffel des ASV Köln). Absolvent
der Deutschen Sporthochschule, verfasste eine Diplom-Arbeit über
Carl Diem.
Wolfgang Bausch, geboren 1966, arbeitet
seit mehreren Jahren als freier Fernsehautor für den WDR,
vorwiegend für die Redaktion MONITOR mit dem Themenschwerpunkt
Sportpolitik.
Verlagsinformation |
| |
|
Roland Flade/Ursula Gehring-Münzel: Die
Würzburger Juden.
Ihre Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Königshausen & Neumann-Verlag
1996 (2., erweiterte Auflage;
vergriffen).
ISBN: 3-8260-1257-7. |
|
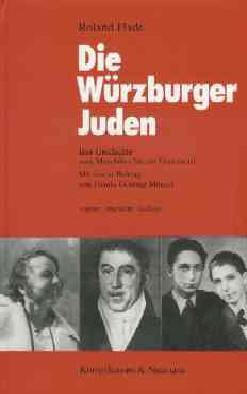
|
Zum Buch
Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 1987 gilt
das Buch "Die Würzburger Juden" als Standardwerk von
überregionaler Bedeutung. Für die zweite Auflage wurde ein Kapitel
über den Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion ergänzt.
Binnen weniger Jahre hat sich die Zahl der Juden in Würzburg von
100 bis 200 (1980er Jahre) auf 1.100 (Mai 2002) vervielfacht. Ihre
Eingliederung stellt die kleine jüdische Gemeinde in Würzburg vor
beträchtliche Probleme.
"Das Auschwitz-Tagebuch von Ernst Ruschkewitz [...] ist an
Dramatik kaum zu überbieten." (Süddeutsche Zeitung)
"Höchst informativ" (DIE ZEIT)
"Flüssig wie ein spannender Roman" (Main-Echo)
"Das vorliegende Buch dürfte die gründlichste und
zugleich auch die lesenswerteste Geschichte der Juden einer
mittelgroßen Stadt sein." (Aufbau-Verlag, New York)
Inhaltsverzeichnis:
-
I. MITTELALTER UND FRÜHE NEUZEIT (von
Roland Flade)
Die ersten beiden Kreuzzüge / Blüte der Gemeinde / Kaiser,
Bischof, Bürger – Die "Schutzmächte" der Würzburger Juden /
"Hostienfrevel" und "schwarzer Tod" – Die großen Verfolgungen
(1298-1349) / Woher kommt der mittelalterliche Judenhaß? / Leben
mit der Furcht vor der Vertreibung – Das Spätmittelalter / Die
Juden müssen Würzburg verlassen
-
II. EMANZIPATION (von Ursula
Gehring-Münzel)
Die Rückkehr der Juden nach Würzburg / Das "Hep-Hep"-Pogrom im
Jahre 1819 / Religiöses und geistiges Leben / Das Wirtschaftsleben
der Würzburger Juden / Das Ringen um politische Gleichberechtigung
und gesellschaftliche Anerkennung / Der "Würzburger Rav" Seligmann
Bär Bamberger
-
III. KAISERREICH (von Roland Flade)
Reichsgründung und Bevölkerungsentwicklung / Ausbau der
Gemeindeeinrichtungen / Politische Einstellung und Antisemitismus
/ Der Erste Weltkrieg
-
IV. WEIMARER REPUBLIK (von Roland
Flade)
Novemberumsturz, Freikorps und Mitarbeit in Parteien / Vier
Familien in der Stadt der sieben Synagogen / Berufliches Spektrum
/ Soziale Integration / Antisemitismus
-
V. DRITTES REICH (von Roland Flade)
Gewalt der Straße – Machtübernahme und Boykott / Gewalt in
Amtsstuben – Entrechtung und Unterdrückung / Jüdische Selbsthilfe
/ Auswanderung / Die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938
und ihre Folgen / "Wenn ich's noch erlebe, daß meine Biographie
noch einmal einen Sinn bekommt" – Die Geschichte des Arnold
Reinstein / Deportationen und Massenmord – Der Brief des Herbert
Mai / "Wenn man seine Lieben wiedersehen will, muß man all seine
Energie gebrauchen, um zu leben – Das Auschwitz-Tagebuch des Ernst
Ruschkewitz
-
VI. NACHKRIEGSZEIT (von Roland Flade)
Die Überlebenden / Vergangenheitsbewältigung / Die
wiedererstandene Gemeinde / Die zweite Rückkehr / Die
Herausforderung
Zu den AutorInnen
Der Historiker Dr. Roland Flade
leitet die Lokalredaktion der Würzburger
Main-Post. Mehrere Buchveröffentlichungen.
Dr. Ursula Gehring-Münzel ist Historikerin. Mehrere
Buchveröffentlichungen, u.a. "Vom
Schutzjuden zum Staatsbürger. Die
gesellschaftliche Integration der Würzburger Juden 1803-1871".
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
Literatur zur
jüdischen Geschichte in Unterfranken
Würzburger Autor
Max Mohr (1891-1937) neu
entdeckt
Max Mohr: Frau ohne Reue. Roman
Restexemplare sind im
Buchladen Neuer Weg erhältlich.
Bestellung per Mail: buchladen@neuer-weg.com |
| |
|
Dr. Herbert Schultheis/Isaac E. Wahler: Bilder und Akten der
Gestapo Würzburg über die Judendeportationen 1941-1943.
Rötter-Druck und Verlag 1988.
(vergriffen).
ISBN: 3-9800-482-7-6. |
|
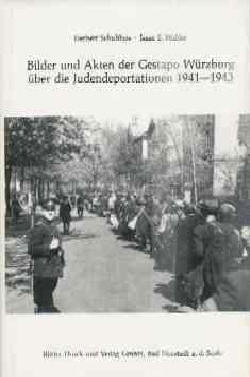
|
Zum Buch
In diesem Buch wird der Leidensweg der Juden im
nationalsozialistischen Deutschland aufgezeigt, wie ihn die Akten
der Würzburger Geheimen Staatspolizei überliefert haben. Am 16.
Juni 1933 lebten im Deutschen Reich (ohne Saarland) 499.682 Juden.
Dies entsprach einem Bevölkerungsanteil von 0,8 Prozent. In Bayern
mit etwa 7,7 Millionen Einwohnern gab es 41.989 Juden (0,5
Prozent). Im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken gehörten
von 796.043 Einwohnern 8.520 der jüdischen Religionsgemeinschaft
an. Zur jüdischen Gemeinde Würzburg, der größten in Unterfranken,
zählten sich 2.145 Personen (2,1 Prozent). In Aschaffenburg lebten
561 (1,6 Prozent), in Schweinfurt 363 (0,9 Prozent), in Kitzingen
360 (3,3 Prozent) und in Bad Kissingen 344 (4,4 Prozent).
In Unterfranken gab es keinen ländlichen Bezirk (Landkreis) mit
einem geringeren jüdischen Bevölkerungsanteil als 0,2 Prozent;
Bezirk Gemünden 1,9 Prozent, Brückenau 1,7 Prozent, Hofheim 1,7
Prozent, Mellrichstadt 1,5 Prozent, Bad Neustadt a.d. Saale 1,4
Prozent, Karlstadt 1,1 Prozent, Königshofen im Grabfeld 1,0
Prozent, Gerolzhofen 0,9 Prozent und Landkreis Würzburg 0,5
Prozent. Von November 1941 bis Juli 1943 fielen 2.063 Juden aus
Mainfranken (= Unterfranken) der Deportation zum Opfer. Nur
einzelne überlebten die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.
"Es handelt sich ... um ein herausragendes und sich von
vergleichbaren bildlichen Überlieferungen unterscheidendes
Bildkonvolut [...]." (Klaus Hesse/Philipp Springer: Vor aller
Augen. Fotodokumente des nationalsozialistischen Terrors in der
Provinz, S. 186)
Zu einem der Autoren
Herbert A. Schultheis hat mehrere Bücher veröffentlicht, u.a. "Juden
in Mainfranken 1933-1945 unter besonderer Berücksichtigung der
Deportation Würzburger Juden".
Verlagsinformation
Restexemplare sind im
Buchladen Neuer Weg erhältlich.
Bestellung per Mail: buchladen@neuer-weg.com |
| |
|
Sybille Grübel/Clemens Wesely:
Würzburg. 100 Jahre Stadtgeschichte in historischen
Fotografien. Sutton-Verlag 1998
(vergriffen). ISBN:
3-89702-039-4. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Die Fotografie ermöglicht uns heute einen
schnellen, unmittelbaren und realistischen Zugang zur
Vergangenheit. Diese Zeugnisse zu sammeln und zu bewahren gehört
zu den Aufgaben kommunaler Archive. Das Stadtarchiv Würzburg
verfügt über eine der bedeutendsten Sammlungen zur Würzburger
Geschichte. Für die "Reihe Archivbilder" des Sutton-Verlags Erfurt
haben die Autoren aus dem umfangreichen Bestand rund 220 besonders
interessante Zeitdokumente aus den wichtigsten Lebensbereichen der
Stadt ausgewählt und unter Oberbegriffen zusammengefasst, die
einen sinnvollen Rahmen ergeben und für Würzburg wichtige Bereiche
abdecken (Innenstadt / Stadtteile / Leben am Main / Wirtschaft und
Verkehr / Universität und Kliniken / Kirchen und religiöses Leben
/ Öffentliches Leben / Kultur und Sport).
Dabei ging es nicht um eine lückenlose Chronik mit
wissenschaftlichem Anspruch; das vorliegende Buch richtet sich an
einen breiten Leserkreis und will keine historische
Buchpublikation sein. Im Vordergrund sollen die Bilder und die von
ihnen ausgehende Atmosphäre stehen. Das Alltagsleben und seine
Veränderungen sowie die Entwicklung Würzburgs zur Großstadt seit
Ende des 19. Jahrhunderts stehen dabei im Vordergrund.
Insbesondere weniger bekannte Aspekte der Stadtgeschichte werden
genauer betrachtet. Aus diesem Grund ist auch der Zeitraum von
1945 bis 1960 nur dort berücksichtigt worden, wo es thematisch
sinnvoll schien. Der Leser wird in dem Bildband zu einer Zeitreise
in das Würzburg eingeladen, das seit 1945 nicht mehr existiert.
Nicht zuletzt durch die teilweise zum ersten Mal veröffentlichten
Bilder und seltenen Aufnahmen wird diese Reise zu einem besonderen
historischen Erlebnis.
Verlagsinformation |
| |
|
Peter A. Süß: Kleine Geschichte der Würzburger
Julius-Maximilians-Universität. Ferdinand-Schöningh-Verlag
Würzburg 2002. ISBN: 3-87717-707-7. |
|
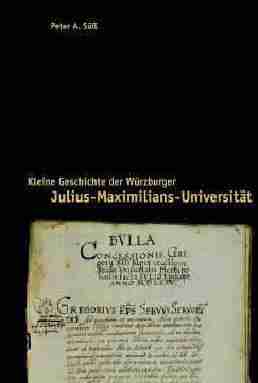
Vorderseite

Rückseite
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Im Jahr 2002 feierte die traditionsreiche
Würzburger Alma Mater im Rahmen eines Wissenschaftsjahres das
600-jährige Jubiläum ihrer Erstgründung durch Fürstbischof Johann
I. von Egloffstein 1402. Aus diesem Anlass wurde
die "Kleine Geschichte der Würzburger
Julius-Maximilians-Universität" vorgelegt, die eine umfassende
historische Gesamtschau der Entwicklung der Würzburger Hochschule
von ihren Wurzeln im 15. Jahrhundert bis heute bieten will. Dies
schien um so mehr geboten, da die Veröffentlichung der letzten
zusammenhängenden Darstellung der Würzburger
Universitätsgeschichte durch Franz Xaver von Wegele, die bereits
mit dem Jahr 1806 endet und zur Feier des 300. Geburtstages der
Echter'schen Gründung 1882 erschien, mehr als hundert Jahre
zurückliegt und seither nur zahlreiche mehr oder weniger
umfangreiche Einzelstudien publiziert wurden.
Die vorliegende Monographie
zeichnet ein facettenreiches Bild der Würzburger
Universität. So wird der
Weg dieser bedeutenden fränkischen Hochschule
geschildert, beginnend mit ihrer ersten Gründung 1402 über
die Errichtung des Gymnasiums unter Fürstbischof von Wirsberg, die
Wiederbegründung durch Julius Echter von Mespelbrunn und ihre
erste Blütezeit bis zum Einschnitt der Schwedenzeit im 17.
Jahrhundert. Neben dem anschließenden Wiederaufstieg der "Alma
Julia" vor allem zu Zeiten der katholischen Aufklärung im 18.
Jahrhundert werden auch die Umbrüche unter der Herrschaft des
bayerischen Kurfürsten und des Großherzogs von Toskana sowie die
in staatlicherseits gezogenen engen Grenzen verlaufende
Entwicklung der Hochschule bis zur Revolution von 1848 beleuchtet.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangt die Würzburger
Universität zu Weltruhm, nicht zuletzt wegen des Aufschwungs in
den Naturwissenschaften. Die Jahre des Ersten Weltkriegs, der
Weimarer Republik werden ebenso thematisiert wie die
Gleichschaltung der Hochschule im Nationalsozialismus. Den
Abschluss bilden die Kapitel, die die unmittelbaren
Nachkriegsjahre, die Zeit der Studentenbewegung und des
Universitätsausbaues sowie die aktuellen Entwicklungen und
Probleme einer heutigen Massenhochschule charakterisieren. Eine
Zeittafel, ein Hinweis auf weiterführende Literatur zur
Universitätsgeschichte sowie ein Orts- und Personenregister runden
den Band ab.
Als Überblicksdarstellung richtet sich das Buch an einen über die
Universität hinausgehenden breiten Leserkreis und gibt auch dem
interessierten Laien die Möglichkeit, sich ohne allzu viel Mühe
und Zeitaufwand über die Entwicklung der Würzburger Hochschule zu
informieren. Daher wurde auf Kürze und gute Lesbarkeit der
Darstellung besonderer Wert gelegt, was sich außer in dem Verzicht
auf einen wissenschaftlichen Apparat vor allem in einem
anschaulichen Text und zahlreichen Farb- und
Schwarzweiß-Abbildungen äußert.
Zum Autor
Peter A. Süß, M.A., geboren 1960 in Würzburg, studierte
Geschichte, Kunstgeschichte, Volkskunde, Philosophie und moderne
Fremdsprachen. Neben seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der
Würzburger Universität und der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
wirkt er als Autor, Referent sowie im Bereich des Kulturmanagement
und des Tourismus. Außerdem ist er bei wichtigen kulturellen
Vereinigungen wie u.a. dem "Frankenbund", den "Freunden
Mainfränkischer Kunst und Geschichte" und dem
"Verschönerungsverein Würzburg" im Vorstand, Beirat oder Ausschuss
engagiert. Seine zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigen sich
mit der Geschichte des 18. Jahrhunderts, der Universitäts- und
Studentengeschichte sowie der Geschichte Frankens und vor allem
Würzburgs. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten erschienen
aber auch populäre Werke wie zwei Würzburg-Bildbände und ein
Stadtführer.
Verlagsinformation |
| |
|
Winfried Schmidt: ... war gegen
den Führer äußerst frech...
G. Kralik-Verlag 1999. ISBN: 3-9804477-7-4. |
|
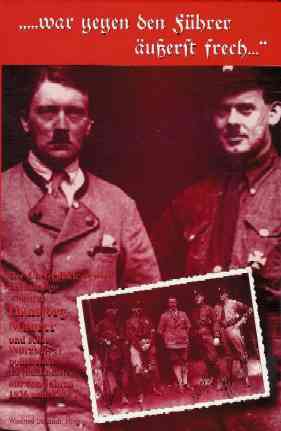
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Unter Gefahr für Leib und Leben informierte ein Würzburger
Journalist 1936 und 1937 einen amerikanischen Kollegen über
Untaten des "Dritten Reichs". Die Worten ließen nichts an Klarheit
zu wünschen übrig: 'Lüge, Diebstahl, Notzucht, Vergewaltigung,
widernatürliche Unzucht, Erpressung, Menschenmisshandlung bis
hinauf zum Mord, das ist die Skala nationalsozialistischer
"Kultur" und "Weltanschauung", wie sie in der Praxis aussieht.' So
schonungslos äußerte sich am 6. Juli 1936 in Würzburg der
Journalist Hansjörg Maurer, der von 1934 bis 1936 Chefredakteur
des "Fränkischen Volksblatts" gewesen war.
Maurer schrieb den hochbrisanten Text nicht für sich selbst,
sondern er schickte ihn per Reichspost dem amerikanischen
Journalisten Louis P. Lochner, der von Berlin aus für
Nachrichtenagentur "Associated Press" berichtete. "Er hielt es für
seine Pflicht", erklärte Lochner nach dem Krieg, "mir über die
Rechtsbrüche, Gewalttätigkeiten und Übergriffe der Nazis klaren
Wein einzuschenken." Ein lebensgefährliches Unterfangen. Wären die
Briefe entdeckt worden, hätte Maurer die Einlieferung ins KZ,
vielleicht der Tod gedroht.
Die Geschichte des mutigen Autors hat der Würzburger Winfried
Schmidt in einem jetzt erschienenen 358-Seiten-Band
nachgezeichnet. Der Titel beginnt mit einem Zitat des damaligen
mainfränkischen Gestapo-Chefs Josef Gerum über Maurer: "... war
gegen den Führer äußerst frech ...". Der Untertitel [lautet]: "Der
Chefredakteur und nachmalige Tierarzt Hansjörg Maurer und seine
Würzburger politischen Tagebuchblätter aus den Jahren 1936 und
1937". [...]
Vielleicht wollte Hansjörg Maurer auch die eigene Vergangenheit
aufarbeiten: In den 20er Jahren war er ein enger Vertrauter Adolf
Hitlers gewesen, einer der ersten Chefredakteure des "Völkischen
Beobachters", Autor fanatischer antisemitischer Artikel und als
32-jähriger im November 1923 Teilnehmer am Hitlerputsch in
München. Dass Maurer angesichts des Terrors des "Dritten Reiches"
innerlich eine 180-Grad-Wende durchmachte, zeigt auch sein Mut im
November 1938. Während der "Reichskristallnacht" gewährte er einem
jüdischen Rechtsanwalt und dessen Frau eine Woche lang Schutz in
seiner Wohnung – auch dies eine Tat, die Mut erforderte.
Zum Herausgeber
Herausgeber Schmidt war bis 1993 Leiter des Staatlichen
Veterinäramtes in Bad Kissingen. Hier fand er zufällig
Durchschriften jener Aufzeichnungen seines Kollegen. Denn:
Hansjörg Maurer studierte nach seiner Chefredakteurs-Zeit
Tiermedizin und wirkte von 1939 bis zu seinem Tod 1959 als
Tierarzt in Euerdorf im damaligen Landkreis Hammelburg.
Quelle: Dr. Roland Flade,
in: Main Post, 11.11.1999, Seite L1 |
|
|