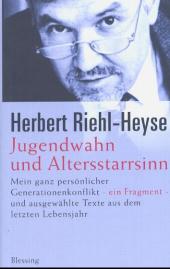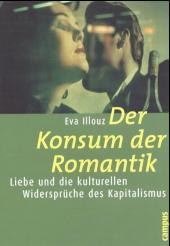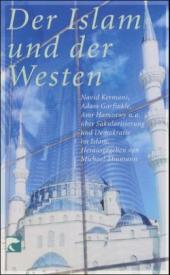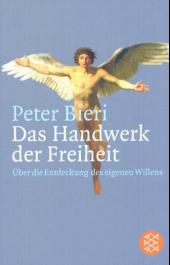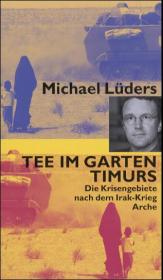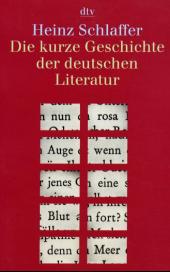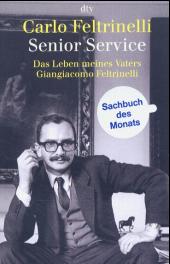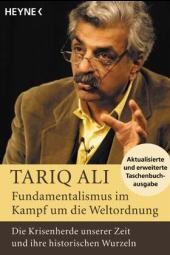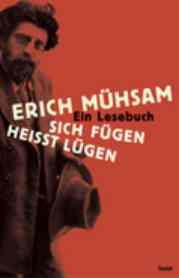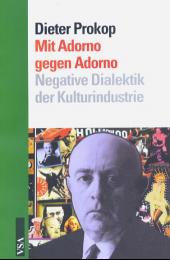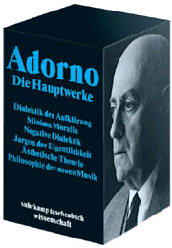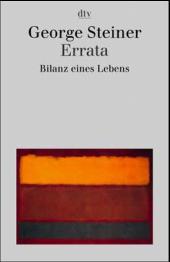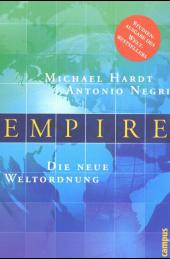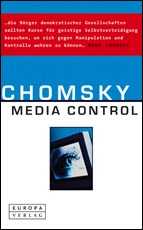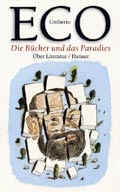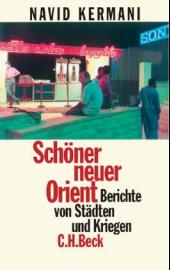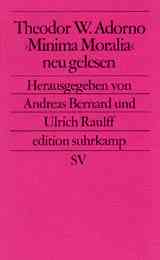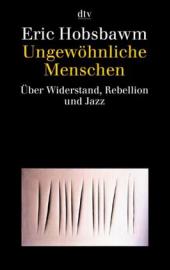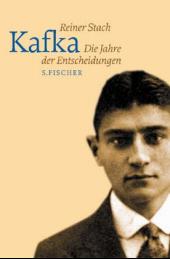|
Dezember
2003 |
|
|
|
Peter Kemper/Ulrich Sonnenschein (Hrsg.): Glück und
Globalisierung: Alltag in Zeiten der Weltgesellschaft.
Suhrkamp-Taschenbuch-Verlag
2003. ISBN: 3-518-45546-X. |
|

mehr Infos
bestellen
|
"Globalisierung" – DAS Zauberwort des ausgehenden 20. und
beginnenden 21. Jahrhunderts. Doch hinter der verheißungsvollen
Fassade einer weltumspannenden Kommunikationsgemeinschaft verbirgt
sich zunehmend Unsicherheit: Festgefügte Ordnungen scheinen zu
zerfallen, Sinnverluste allerorten! Zwar fasziniert das
Versprechen größerer Durchlässigkeit und Beweglichkeit durch eine
grenzenlose Vernetzung. Aber während die Menschen in ihrer neu
geschaffenen digitalen Welt Verbindung über Verbindung knüpfen,
erleben sie gleichzeitig eine beispiellose Zersplitterung ihrer
vertrauten Umgebung und sind nicht nur in ökonomischer, sondern
auch in psychologischer Hinsicht gefordert.
Nach dem erfolgreichen Reader "Globalisierung
im Alltag", der mit Grundlagentexten
das Neue Funkkolleg des Hessischen Rundfunks "Glück und
Globalisierung" begleitete, fasst dieser Band nun die Ergebnisse
der Sendereihe zusammen: 26 Autoren gehen in ihren
Originalbeiträgen der Frage nach, welche Zumutungen, aber auch
überraschende Chancen der globalisierte Alltag für den Einzelnen
bereithält.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
|
November
2003 |
|
|
|
Ulrich Beck/Natan Sznaider/Rainer Winter (Hrsg.): Globales
Amerika? Die kulturellen Folgen der Globalisierung. Cultural
Studies Vol. 4. Transcript-Verlag 2003. ISBN: 3-89942-172-8.
|
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Seit einigen Jahren wird in den Sozial- und Kulturwissenschaften
international kaum ein Phänomen so lebhaft diskutiert wie das der
Globalisierung. Nachdem die zu Anfang vorherrschende Sichtweise
von Globalisierung als Entwicklung einer homogenen Weltkultur
zunehmend an Evidenz verlor, rücken die lokal unterschiedlichen
kulturellen Praktiken und Perspektiven als Teil von Globalisierung
ins Zentrum des Interesses. Diese Neujustierung des Fokus erlaubt
auch längst überfällige neue Lesarten des vermeintlich einfachen
Verhältnisses von "Amerikanisierung" und Globalisierung.
Dabei wird deutlich, dass die oft als "Amerikanisierung"
wahrgenommene Globalisierung weltweit heterogene Resonanzen
erzeugt, hybride Kulturen, Fluchtlinien und Gegenbewegungen treten
gleichermaßen hervor. Der Band "Globales Amerika?", in dem sich
einige der prominentesten Denker der Globalisierung zu Wort
melden, präsentiert anregende Lektüren dieser bislang wenig
beleuchteten Seite der Globalisierung und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zum Verständnis des Problems insgesamt. Für das
21. Jahrhundert erweist sich die Perspektive eines
"methodologischen Kosmopolitismus" (Ulrich Beck) als
richtungweisend.
Zu den Herausgebern
Ulrich Beck ist Professor für Soziologie an der Universität
München und Visiting Centennial Professor an der London School of
Economics and Political Science.
Natan Sznaider lehrt Soziologie am Academic College in Tel-Aviv.
Rainer Winter ist Professor für Medientheorie und Cultural Studies
sowie Direktor des Instituts für Medien und Kommunikationsstudien
an der Universität Klagenfurt.
Verlagsinformation |
|
|
Herbert Riehl-Heyse: Jugendwahn und Altersstarrsinn. Mein ganz
persönlicher Generationenkonflikt – ein Fragment – und ausgewählte
Texte aus dem letzten Lebensjahr. Blessing-Verlag 2003. ISBN:
3-89667-193-6.
|
|
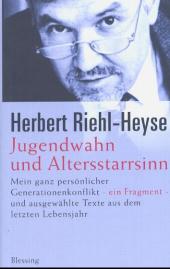
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Das Älterwerden fiel Herbert Riehl-Heyse in den letzten Monaten seines
Lebens zunehmend schwerer, auch bedingt durch die lebensbedrohende
Krankheit. Und doch hat er sich in seiner unnachahmlichen Art der
ironischen Bewertung eigener Befindlichkeiten mit dem Thema seines
Buches beschäftigt.
"Manche üben sich im Grabenkrieg", so der Autor, "so verhärtet
sind die Fronten zwischen Jung und Alt. Manche haben sich einfach
nichts zu sagen oder reden bedeutungsschwer aneinander vorbei,
sind starrsinnig und besserwisserisch (so der Vorwurf der Jungen),
sind uneinsichtig und undankbar (so der Vorwurf an die Jungen)."
Die Texte des Autors zeigen, dass es schwierig ist, in Würde älter
zu werden und es nicht zu merken beziehungsweise dem
Jugendkultigen zu verfallen und es auch nicht zu merken.
Unbestreitbar ist, dass wir es hier mit einem Thema des
beginnenden 3. Jahrtausends zu tun haben. Auch der Autor schien
verunsichert, denn er schrieb: "Komisch – gerade war ich doch noch
jung. Und jetzt lese ich nur noch Zeitungsartikel und Bücher, aus
denen hervorgeht, dass ich den wirklich Jungen im Wege stehe.
Schon habe ich ein schlechtes Gewissen, gleich darauf aber fühle
ich einen gewissen Zorn in mir hochsteigen: Ist es in Wahrheit
nicht so, dass die undankbare Generation Golf ein schlechtes
Gewissen haben müsste? Wenn die in Jugendwahn ausbricht, dann
reagiere ich jedenfalls schnell mit dem mir zustehenden
Altersstarrsinn. Führt aber auch nicht weiter."
Das hier vorliegende Fragment seines letzten Buches zeigt, was
geschieht, wenn Welten aufeinander prallen. Es ist geschrieben in
einem eleganten Stil, teils satirisch, oft selbstironisch,
durchaus nachdenklich, auf keinen Fall wehleidig.
Zum Autor
Herbert Riehl-Heyse, 1940 in Oberbayern geboren, studierter Jurist, war
ab 1968 Journalist und arbeitete zuletzt als Leitender Redakteur der
Süddeutschen Zeitung in München. Er hat diverse journalistische
Auszeichnungen für seine Arbeiten erhalten, u. a. den
Theodor-Wolff-Preis, den Kisch-Preis und den Medienpreis des
Deutschen Bundestages. Mehrere Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation |
|
|
Eva Illouz: Der Konsum der Romantik. Liebe und die
kulturellen Widersprüche des Kapitalismus. Frankfurter Beiträge
zur Soziologie und Sozialphilosophie, Band 4. Campus-Verlag 2003.
ISBN: 3-593-37201-0.
|
|
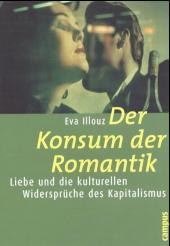
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Romantische
Liebe gilt als letztes Refugium in einer kommerzialisierten Welt.
Dieses Buch dagegen beleuchtet, wie sich die Paarbeziehung unter
dem Einfluss des totalen Konsums verändert hat.
Zu den
kulturellen Widersprüchen, die den Kapitalismus kennzeichnen
sollen, gehört der Gegensatz von romantischem Liebesideal und der
kalten Welt der Ökonomie. Das in den USA preisgekrönte Buch zeigt
dagegen auf, inwiefern die beiden Sphären sich längst
wechselseitig beeinflussen und ineinander übergehen: So, wie die
Konsumsphäre in wachsendem Maße auf die Erzeugung romantischer
Gefühlszustände abzielt, so geraten die Intimbeziehungen immer
stärker in Abhängigkeit von der Inszenierung und dem Erlebnis des
Konsums. Die kollektive Utopie der Liebe, einst als
Transzendierung des Marktes idealisiert, ist im Prozess ihrer
Verwirklichung zum bevorzugten Ort des kapitalistischen Konsums
geworden.
Rezension
"Was mich an diesem Buch am stärksten beeindruckt, ja fasziniert hat,
ist die Souveränität, mit der hier kühle Beobachtungsgabe und
soziologisches Ethos wieder miteinander verknüpft worden sind:
Gestützt auf Interviews, Werbekampagnen, Frauenmagazine und
Ratgeberliteratur gelingt es Eva Illouz, detailliert die wachsende
Kolonialisierung der Liebe durch Kommerz und Konsum aufzuzeigen,
ohne dabei die hartnäckigen Bemühungen der Subjekte um die
Verwirklichung der romantischen Utopie zu verraten." (Axel Honneth)
Zur Autorin
Eva Illouz ist Dozentin am Fachbereich für Soziologie und
Anthropologie der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zu ihren
Forschungsschwerpunkten gehören die Soziologie der Emotionen, der
Konsumgesellschaft und der Medienkultur. Zuletzt erschien von ihr
"Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: An Essay on Popular
Culture" (Columbia University Press, 2003).
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Oktober 2003 |
|
|
|
Michael Thumann (Hrsg.): Der Islam und
der Westen: Navid Kermani, Adam
Garfinkle, Amr Hamzawy u.a. über Säkularisierung und Demokratie im
Islam. Berliner Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN:
978-3-8333-0075-2. |
|
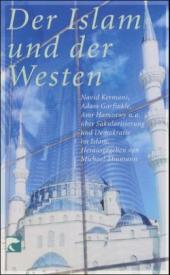
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Seit dem 11. September 2001 und dem Irakkrieg 2003 ist das
Verhältnis des Westens zur islamischen Welt stark belastet.
Misstrauen und bisweilen Hass verstellen den Blick. Die Anschläge
gegen die USA und der Sturz Saddam Husseins haben viele Fragen
aufgeworfen: Muss nicht der Rechtsstaat vor freien Wahlen
aufgeworfen. Muss nicht der Rechtsstaat vor freien Wahlen kommen?
Lässt sich der Nahe Osten mit Gewalt demokratisieren? Ist der
Islam mit der säkularen Moderne und damit auch mit der Demokratie
vereinbar? Sind Religion und pluralistische Toleranz unaufhebbare
Gegensätze? Lässt sich die Realität muslimischer Gesellschaften
aus dem Koran ableiten?
Diese Fragen stellten internationale Wissenschaftler und
Journalisten in einer Serie der Wochenzeitung "DIE ZEIT" über
Säkularisierung und Demokratie, die in diesem Buch erweitert und
aktualisiert präsentiert wird. Mit Beiträgen von Navid Kermani,
Adam Garfinkle, Ronald D. Asmus, Abbas Beydoun, Amr Hamzawy, Georg
Brunold, Mordechai Lewy, Bassam Tibi, Yasar Nuri Öztürk, Nasr
Hamid Abu Zayd und Michael Thumann.
Zum Herausgeber
Michael Thumann, geboren 1962, studierte Geschichte, Politik und
Slawistik in Berlin, New York und Moskau. Seit 1992 berichtete er
als Korrespondent der ZEIT über Südosteuropa, von 1997 bis 2001
als deren Moskauer Korrespondent über Russland und Zentralasien. Heute koordiniert Michael Thumann in Hamburg die
außenpolitische Berichterstattung der ZEIT.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
September
2003 |
|
|
|
Peter Bieri: Das Handwerk der Freiheit.
Über die Entdeckung des eigenen Willens. Fischer-Taschenbuch-Verlag
2003. ISBN: 3-596-15647-5. |
|
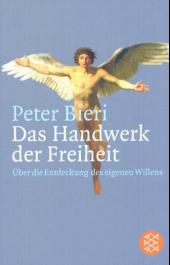
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was bedeutet es, frei zu sein? Gibt es eine absolute Freiheit des
Willens? Der Philosoph Peter Bieri präsentiert die
unterschiedlichsten Antworten auf die Frage der Willensfreiheit
wie auf einer Bühne: In kleinen, immer wieder abgewandelten Szenen
verstrickt er scheinbar zwingende Vorstellungen von Freiheit so
lange in Widersprüche, bis sich am Ende die Prinzipien einer
wirklichen Freiheit erkennen lassen.
Rezensionen
"Als philosophischer Schriftsteller hat Bieri ein
gedanklich-erzählerisches Gespinst gesponnen, das seine Leser zu
fesseln vermag ..." (Manfred Geier,
Süddeutsche Zeitung)
"Fragt man Wissenschaftslektoren, auf welches Buch eines anderen
Verlags sie in diesem Herbst eifersüchtig werden könnten, so kommt
die Sprache bald auf Peter Bieris neuen Band 'Das Handwerk der
Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens'.
[Das Buch ist] außerordentlich hilfreich bei dem Versuch,
die aufgeworfenen Grundfragen des Selbstverständnisses zu
vertiefen." (Christian Geyer, FAZ)
"Peter Bieri ist seit Jahren dabei, die uralte philosophische
Zwickmühle der Willensfreiheit zu enträtseln. Nun hat er darüber
ein kluges, spannendes Buch geschrieben, das nirgendwo ins
Fachchinesisch abgleitet und zudem (...) verblüffend aktuell ist."
(Johannes Saltzwedel, DER SPIEGEL)
"Ist über Freiheit nicht schon viel, allzu
viel, gesagt worden?
Nein. Das Buch von Peter Bieri entdeckt die Freiheit, die wir
haben – ob wir wollen oder nicht –, wieder neu. Es ist klar bis
zur Schönheit, spannend wie ein Roman, mit Anschauung gesättigt.
Ein notwendiges Buch auch, weil zur Zeit die Versuche, Freiheit
wegzuerklären, hohe Konjunktur haben. Ein befreiendes Buch."
(Rüdiger Safranski)
Verlagsinformation |
|
|
Angela Hausner (Hrsg.): Denkanstöße 2004:
Ein Lesebuch aus Philosophie, Kultur und Wissenschaft.
Piper-Verlag 2003. ISBN: 3-492-23897-1. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Zum zwanzigsten Mal erscheint diese charmanteste Einladung zum
Lesen, seit es Bücher gibt. Das erfolgreiche und beliebte Jahrbuch
präsentiert Denkimpulse der namhaftesten Autoren aus dem aktuellen
Sachbuch- und Wissenschaftsprogramm des Verlages. Übersichtlich
nach Themen gegliedert, bringen die Texte Wichtiges und
Wissenswertes – unter anderem von Hans Küng, Sir Karl R. Popper,
Walter Krämer, Peter J. D'Adamo und Gilles Kepel.
Zum Autor
Angela Hausner lebt und arbeitet nach einem
Sprachen- und Journalistikstudium als Herausgeberin, Übersetzerin
und Journalistin in München. Sie gibt die
jährlich erscheinenden "Denkanstöße"
in der Serie Piper heraus.
Verlagsinformation
|
|
|
|
|
August 2003 |
|
|
|
Michael Lüders: Tee im Garten Timurs. Die Krisengebiete nach dem Irak-Krieg. Arche-Verlag
2003. ISBN: 978-3-7160-2321-1. |
|
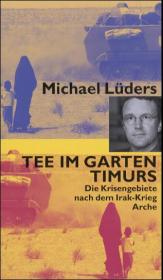
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Von den Staaten Zentralasiens über Afghanistan/Pakistan und den
Irak bis Israel/Palästina – wird es in Zukunft einen
durchgehenden Krisenbogen geben und damit eine Zone islamistischer
Gewalt? Der Publizist und gefragte politische Kommentator Michael Lüders
("'Wir hungern nach dem Tod.' Woher kommt die Gewalt im Djihad-Islam?") informiert jenseits der gängigen Parolen und Gewissheiten.
Zum Autor
Michael Lüders, geboren 1959 in Bremen, Studium der arabischen
Literatur in Damaskus sowie der Islamwissenschaft, Politologie und
Publizistik in Berlin. Promotion über das ägyptische Kino. Langjähriger
Nahost-Redakteur der ZEIT, mehrere Buchveröffentlichungen. Der
Autor lebt in Berlin.
Verlagsinformation
Rezension
Entlang der Pipeline: Michael Lüders bereist die Krisenherde
Zentralasiens (Frankfurter Rundschau, 29.08.2003) |
|
|
|
|
Juli
2003 |
|
|
|
Heinz Schlaffer: Die kurze Geschichte der deutschen Literatur.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN: 3-423-34022-3. |
|
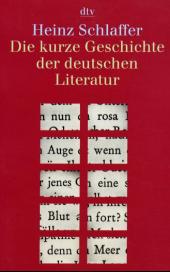
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Erst von 1750 an – lange also nach den klassischen Epochen der italienischen, spanischen oder französischen Literatur
– entstehen in Deutschland Werke, die zur Weltliteratur zählen: die Literatur des klassisch-romantischen Zeitalters.
In diesem Buch geht Heinz Schlaffer den Gründen für die Verspätung und für die kurze Dauer der glücklichen Konstellation nach. Gedanke und Stil verbinden sich in dieser provokativen Literaturgeschichte
– die vom Mittelalter bis zur Gegenwart reicht
– so, dass die Fachleute zum Nachdenken über verdrängte Fragen bewegt werden, die Liebhaber aber zu neuer Beschäftigung mit den eigenwilligen und fast schon vergessenen
Werken der deutschen Literatur. Für sie vor allem ist dieses Buch geschrieben.
Zum Autor
Heinz Schlaffer, Jahrgang 1939, ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Stuttgart.
Verlagsinformation |
|
|
Carlo
Feltrinelli: Senior Service. Das Leben meines Vaters Giangiacomo Feltrinelli. Aus dem Italienischen von Friederike Hausmann. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2003.
ISBN: 3-423-34016-9. |
|
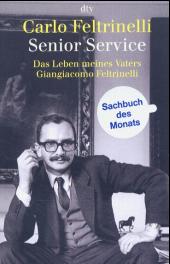
mehr Infos
bestellen
|
Millionär, Verleger, Kommunist, Freund Fidel Castros und Henry Millers, am Ende einsamer Kämpfer im Untergrund: Giangiacomo Feltrinelli hat die Geschichte des Jahrhunderts geprägt. Sein Sohn, Carlo
Feltrinelli, legt nun eine fulminant geschriebene Biographie seines Vaters vor
– Zeitgeschichte, Familiengeschichte und Bildungsroman in einem.
Am 14. März 1972 wird ein Mann neben einem Hochspannungsmast in der Nähe von Mailand aufgefunden. Bis heute weiß man nicht, was zum Tod von Giangiacomo Feltrinelli geführt hat. Sein einziger Sohn rekonstruiert in diesem Buch das Leben eines Mannes, der zu den schillerndsten Figuren der italienischen Nachkriegszeit gehörte. Er entstammt einer der reichsten Familien Italiens, wird Kommunist, dann Verleger. Seine zwei größten Coups sind die Veröffentlichung von Lampedusas großem Roman Der Leopard und von Pasternaks Doktor
Schiwago, und die politischen Texte, die der Verlag veröffentlicht, sind von immenser Bedeutung für das intellektuelle Leben Italiens. Die letzten Jahre seines kurzen Lebens verbringt
Feltrinelli, der Lebemann, der Exzentriker, der Millionär, im Untergrund, schreibt Briefe an die Roten Brigaden, bastelt, vielleicht, an Sprengsätzen. Bei seiner Beerdigung tragen Buchhändler
den Sarg, der Guevara-Freund Régis Debray hält die Leichenrede, und hinterher beschreibt Uwe Johnson die ganze Zeremonie. "Senior Service ist eine englische Zigarettenmarke (auf der Packung sieht man ein weißes Schiff auf blauem Grund), aber auch eine Familiengeschichte. Es ist keine nostalgische Biographie und kann auch nicht als Bildungsroman durchgehen. Es ist einfach die speziellste Geschichte, die ich kenne."
(Carlo Feltrinelli)
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Juni 2003 |
|
|
|
Tariq
Ali: Fundamentalismus im Kampf um die Weltordnung. Die
Krisenherde unserer Zeit und ihre historischen Wurzeln. Heyne-Verlag
2003 (Aktualisierte und erweiterte Ausgabe). ISBN: 3-453-86910-9. |
|
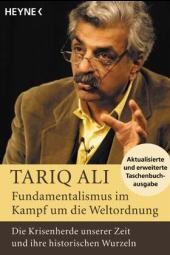
mehr Infos
bestellen
|
Der in London lebende pakistanische
Publizist Tariq Ali ist ein Grenzgänger zwischen der westlichen und der arabischen Welt. Er kennt wie kein anderer die auf beiden Seiten bestehenden Konflikte und ihre historischen Wurzeln. Gestützt auf seine eigenen Erlebnisse und auf seine persönlichen Begegnungen mit den Machthabern in
Afghanistan, Pakistan, Indien und Kaschmir gelingt dem überzeugten Atheisten eine ideologisch ungefärbte und dabei sehr persönliche Bewertung der politisch-religiösen Machtkämpfe. Dabei sieht er den Aufstieg des islamischen Fundamentalismus ebenso wie die neu erwachten Formen des westlichen Kolonialismus und entlarvt den "Kampf der Kulturen" als einen Kampf der Fundamentalisten, gleich welcher ideologischen oder religiösen Gesinnung.
Verlagsinformation
|
|
|
Erich
Mühsam: Sich fügen heißt lügen. Steidl-Verlag 2003. ISBN:
3-88243-886-X. |
|
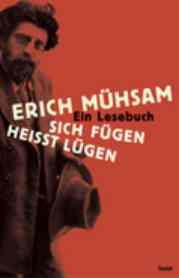
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Erich Mühsam wird von jeder Generation neu entdeckt und gelesen.
Der Schriftsteller, Anarchist und Bohemien war ein Querdenker,
dessen gelebte Subkultur, gedankliche Radikalität und
Unmittelbarkeit im poetischen Ausdruck immer wieder provozieren
und faszinieren. Der "Gefühlsanarchist" Mühsam war geprägt von
einem Hass auf Autoritäten und einer tief
empfundenen Verbundenheit mit den sozial Benachteiligten. Dies
spiegelte sich in seiner "privaten" Lyrik, in Streitschriften,
tagespolitischer Satire und seiner Autobiographie.
Auf zwei Wegen ist Erich Mühsam hier neu zu entdecken: über ein
Lesebuch mit seinen interessantesten Texten und einen Bildband,
der Leben und Werk anschaulich dokumentiert in Briefen und
Manuskripten, Plakaten und Karikaturen, Fotografien und
bildnerischen Werken. Die Jahre der Schwabinger Boheme werden
nachgezeichnet, die Zeit des ersten Weltkriegs, der Münchner
Räterepublik, die Festungshaft in Bayern und die politische Arbeit
in der Weimarer Republik, schließlich die Inhaftierung und
Ermordung des politisch missliebigen
"Revoluzzers".
Zum
Autor
Erich
Mühsam, geboren 1878 in Berlin, verbrachte Kindheit und
Jugend in Lübeck, war ab 1901 freier Schriftsteller und
anarchistischer Agitator. 1919 Mitglied der Münchner Räterepublik,
1926 gründete er in Berlin die Monatszeitschrift
"Fanal". 1933 wurde er von den Nazis verhaftet, in
verschiedenen Gefängnissen misshandelt und 1934 im
Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Er schrieb Gedichte und
Dramen, Rezensionen, Essays und die zeitgeschichtlich bedeutende
Autobiographie "Unpolitische Erinnerungen".
Verlagsinformation |
|
|
Dieter
Prokop: Mit Adorno gegen Adorno. Negative Dialektik der Kulturindustrie.
VSA-Verlag 2003. ISBN: 3-89965-000-X. |
|
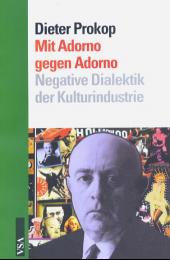
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Dieter Prokops Interesse gilt der Erneuerung der Kulturindustrie-Thesen der Frankfurter Schule. Er wirft ihr vor, dass sie ihr eigenes Programm nicht eingelöst hat und entwickelt die Grundzüge einer Negativen Dialektik der Kulturindustrie: Mit Adorno gegen Adorno.
Im September 2003 jährt sich der hundertste Geburtstag von Theodor W. Adorno. Adorno verkörperte den Typus eines "nonkonformistischen Intellektuellen" im Nachkriegsdeutschland. Im Zentrum seiner Arbeiten aus dieser Zeit standen immer wieder die Motive einer Kritik der Kulturindustrie, wie er sie schon in den 40er Jahren im amerikanischen Exil in der »Dialektik der Aufklärung« zusammen mit Max Horkheimer formuliert hatte. Seine Diagnose: eine jeglicher Kreativität enteignete standardisierte Subjektivität.
Dieter Prokop unternimmt den Versuch, die Warensprache der Kulturindustrie unvoreingenommen zu analysieren und wirft der kritischen Theorie der Kulturindustrie vor, dass sie ihr eigenes Programm nicht eingelöst hat. Die wichtigsten Dimensionen einer neuen Kritik der Kulturindustrie sind für ihn gerade nicht in den Veröffentlichungen Horkheimers und Adornos zu finden, die sich explizit mit Kulturindustrie befassen.
Prokop baut auf den entscheidenden Feldern der kritischen Theorie auf: Identisches und Nichtidentisches, Tauschabstraktion und Produktivkräfte, Positivismuskritik und Theorie kritischer Erfahrung. Er will über der Kritik am "Denken in abstrakter Allgemeinheit" die kreativen Kräfte nicht vergessen, die es in der Kulturindustrie gibt, und nicht nur den "Kult des Faktischen" kritisieren. Doch: "Wenn wir die Kulturindustrie-Kritik kritisieren, folgt daraus kein Lob der Kulturindustrie. Unsere Negation der Negation endet nicht im Positiven. Die Negation muss weitergehen. Sie geht weiter, indem man genau beobachtet" – mit Adorno gegen Adorno!
Zum Autor
Dieter Prokop ist Professor für kritische Medienforschung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften – Schwerpunkt Kulturindustrie – der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Verlagsinformation |
|
|
Theodor
W. Adorno: Die Hauptwerke, 5 Bände. Dialektik der Aufklärung; Minima Moralia; Negative Dialektik; Ästhetische Theorie; Philosophie.
Suhrkamp-Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN: 3-518-06699-4. |
|
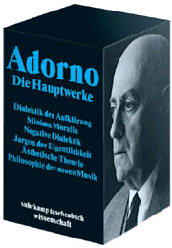
mehr
Infos
bestellen
|
Theodor W. Adorno (1903–1969) ist einer der bedeutendsten
Philosophen des 20. Jahrhunderts. Als Vertreter der Kritischen
Theorie und der Frankfurter Schule, als Vordenker der
Studentenbewegung, als Essayist, Musikkritiker, Komponist und
Hochschullehrer hat er die Geistesgeschichte nicht nur der
Bundesrepublik entscheidend geprägt. Sein pointierter Stil und die
Vielfalt seiner Themen haben ihn über die engen Fachgrenzen der
Philosophie hinaus bekannt und zu einem der führenden
Intellektuellen gemacht, dessen Schriften, Aphorismen und Gedanken
derart Teil der Kultur geworden sind, dass
sie sich nicht mehr daraus wegdenken lassen.
Zum 100. Geburtstag von Theodor W. Adorno am 11. September 2003
versammelt diese Kassette seine Hauptwerke und bietet somit eine
preisgünstige Ausgabe der großen Monographien.
Zudem sind nun erstmals alle Bücher der zwanzigbändigen
Taschenbuchausgabe der Gesammelten Schriften auch einzeln
lieferbar.
Verlagsinformation |
|
|
George
Steiner: Errata. Bilanz eines Lebens. Deutscher
Taschenbuch-Verlag 2002. ISBN: 3-423-30855-9. |
|
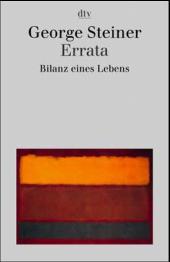
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Autor
Die Autobiographie eines der letzten intellektuellen Kosmopoliten.
Aufgewachsen in Paris und Wien, studierte und lehrte George
Steiner an den renommiertesten amerikanischen und europäischen
Universitäten. Ein Leben lang hat er sich dem Druck der
Spezialisierung entzogen. Dieser konsequenten Haltung verdanken
wir ein eindrucksvolles Oeuvre, das sich mit zentralen Fragen von
Sprache und Literatur, Philosophie und Religion, Musik und
bildender Kunst auseinandersetzt. Dies persönliche Buch George
Steiners macht den inneren Zusammenhang seines Werks anschaulich.
Rezension
"George Steiner ist nicht nur ein Meister der
Kunstbetrachtung und Muster der Gelehrsamkeit, er ist ein
Schriftsteller von hohen Graden. Ein Buch, das kein Leser
unbelehrt wieder zuschlagen wird." (DIE ZEIT)
Zum Buch
George Steiner, geboren 1929 in Paris, hat seit 1994 den
Lord-Weidenfeld-Lehrstuhl für Komparatistik an der Universität
Oxford inne. Von ihm sind
u.a. erschienen: "Martin
Heidegger" (1989), "Von realer Gegenwart" (1990) und
"Der Garten des Archimedes" (1997).
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Mai
2003 |
|
|
|
Slavoj
Žižek: Die Revolution
steht bevor. Dreizehn Versuche nach Lenin.
Suhrkamp-Verlag 2002. ISBN: 3-518-12298-3. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Wie erscheint uns die gegenwärtige
Gesellschaft aus einer leninistischen Perspektive? Hierbei handelt
es sich keineswegs um eine Rückkehr zu Lenin, sondern um den
Versuch, eine kritische Perspektive auf die gegenwärtige
politische Situation zu gewinnen.
Zum
Autor
Slavoj Žižek, 1949 in Ljubljana geboren, Psychoanalytiker und
Professor für Philosophie, rief schon früh eine Gruppe von
Theoretikern ins Leben, die ihr Denken an den Thesen von Jacques
Lacan schärfte. Die slowenische Lacan-Schule war ein geistiges
Widerstandsnest im orthodoxen Ex-Jugoslawien, und Slavoj Žižek
ging als global operierender Philosophie-Entertainer daraus
hervor. Zahlreiche Publikationen (u.a. "Die Grimassen des
Realen", "Die Metastasen des Genießens", "Das Unbehagen im
Subjekt", "Ein Plädoyer
für die Intoleranz") machten ihn international bekannt.
Verlagsinformation
Rezension:
Friede den Hüten, Krieg den Konzernen (taz, 25.04.2003) |
|
|
Raimund
Fellinger (Hrsg.): Kleine Geschichte der Edition Suhrkamp. 40
Jahre Edition Suhrkamp. Suhrkamp-Verlag 2003 (Sonderdruck). ISBN:
3-518-06719-2. |
|

mehr
Infos
bestellen |
Zum
Buch
"Wer über das Programm einer ganzen Reihe zu schreiben hat,
entgeht selten dem Pathos des Programmatischen. Einen Satz in
unserer Ankündigung habe ich bewusst dieser Gefahr ausgesetzt
(obschon meine Freunde mich vor ihm warnten): 'Die edition
suhrkamp leistet sich Luxus und Leidenschaft einer Linie."
(Siegfried Unseld)
Seit ihrer Gründung durch Siegfried Unseld im Mai 1963 ist die
edition suhrkamp wie kaum eine andere Buchreihe Spiegelbild und
Motor der literarischen und intellektuellen Entwicklung der
Bundesrepublik. "Die edition suhrkamp leistet sich Luxus und
Leidenschaft einer Linie", so lautet das Programm dieser
Reihe der Erstausgaben: ständig in neue Bereiche vorzustoßen,
also eine entdeckerische Funktion auszuüben und dabei ihre Linie
zu verfolgen. Durch die legendäre Umschlaggestaltung von Willy
Fleckhaus in den Regenbogenfarben mit Linien hebt sie sich nicht
nur inhaltlich von den anderen Taschenbuchreihen ab. Seit dem 2.
Mai 1963, dem "Revolutionstag des deutschen
Taschenbuchs" (Wolfgang Werth), sind über 2.300 Bände
erschienen, insgesamt wurden mehr als 40 Millionen Exemplare
gedruckt. Die Kleine Geschichte der edition suhrkamp erzählt
anhand von Zeitzeugnissen, wie die programmatische Linie der Reihe
entstand und wie sie sich im Lauf von vier Jahrzehnten entwickelt
hat.
Zum Autor
Raimund Fellinger arbeitet seit 1979 als Lektor im Suhrkamp-Verlag
und war seit 1980 für die Edition Suhrkamp verantwortlich.
Wolfgang Schopf ist Archivar des Archivs der Suhrkamp-Stiftung an
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Verlagsinformation |
|
|
Jan
Philipp Reemtsma: Warum Hagen Jung-Ortlieb erschlug. Unzeitgemäßes
über Krieg und Tod. C.H. Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-49427-7. |
|

mehr
Infos
bestellen |
Zum
Buch
Jan Philipp Reemtsma zeigt in diesem Buch anhand ausgewählter
Beispiele unterschiedliche Formen der Darstellung und
Interpretation von Gewalt in der Literatur. Von den Epen
vormoderner Gesellschaften wie der Odyssee bis zu Imre Kertesz'
Roman-Gedanken über das Überleben spannt sich der Bogen seiner
Analysen, in deren Mittelpunkt eine exemplarische Deutung des
Krieges im Werk von Heinrich von Kleist steht.
Zum Autor
Jan Philipp Reemtsma, geboren am 26. November 1952 in Bonn, ist
unter Geisteswissenschaftlern und Intellektuellen ein fester
Begriff. Er lebt und lehrt in Hamburg, ist Professor für Neuere
Deutsche Literatur an der Universität Hamburg und Vorstand des
Hamburger Instituts für Sozialforschung sowie der
Arno-Schmidt-Stiftung. Er ist Mitherausgeber der Werke Arno
Schmidts und Autor zahlreicher Bücher.
1997 erhielt er den Lessing-Preis der Freien Hansestadt Hamburg.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
April 2003 |
|
|
|
Michael
Hardt/Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung.
Campus-Verlag 2003 (Durchgesehene Studienausgabe). ISBN:
3-593-37230-4. |
|
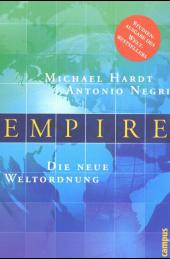
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Nach einem
Vierteljahrhundert politischer Theoriemüdigkeit haben Hardt und
Negri mit ihrer brillanten, provokanten und heiß diskutierten
Analyse des postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der
Globalisierung das Denken wieder in Bewegung gebracht. Der
Hoffnung auf die politische Gestaltbarkeit einer neuen,
gerechteren Weltordnung haben sie damit ein anspruchsvolles
theoretisches Fundament gegeben. Die nun erschienene, günstige
Studienausgabe des Buches macht Empire auch für den kleineren
Geldbeutel interessant.
Rezensionen
"Die
Autoren wollen nichts weniger als Marx' Erzählung der
Weltgeschichte fortsetzen und auf den neuesten Stand ... bringen.
Das ist ihnen so gut gelungen, dass es auch einen überzeugten
Nichtmarxisten ... erfreut, zumal der Versuch handwerklich
hervorragend gearbeitet ist." (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
"Empire (ist) eine grandiose Gesellschaftsanalyse ..., die
unser Unbehagen bündelt und ihm eine Richtung gibt, für die in
der Geschichte
der Philosophie das Wort vom 'guten Leben' steht." (DIE ZEIT)
"Das Jahrzehnt linker Melancholie ist vorüber." (NZZ)
"The next big theory. Empire füllt eine Lücke in den
Humanwissenschaften." (New York Times)
"... ein probates Mittel gegen die neoliberale Depression
..." (literaturen)
"Empire bringt die Geschichte der humanistischen Philosophie,
des Marxismus und der Moderne in einem großartigen politischen
Entwurf zusammen." (The Observer)
Zu den Autoren
Antonio Negri
war Professor für Philosophie in Padua und Paris und Abgeordneter
im italienischen Parlament. Er ist seit den sechziger Jahren einer
der führenden Theoretiker der italienischen Linken und lebt heute
in Rom.
Michael Hardt
ist Professor für Literaturwissenschaft an der Duke University
Durham.
Verlagsinformation
Weitere Informationen
-
Leseprobe aus dem 1. Kapitel
-
Weiterführende Links
(Rosa-Luxemburg-Stiftung)
Rezensionen
-
Empire,
Neue Weltordnung
oder alter Imperialismus?
(Conne Island, Leipzig)
-
"Empire" befriedigt
das Bedürfnis nach linker Welterklärung, erklärt aber wenig
(jungle world, 04.09.2002) |
|
|
Noam
Chomsky: Media Control. Übersetzt von Michael Haupt.
Europa-Verlag 2003. ISBN: 3-203-76015-0. |
|
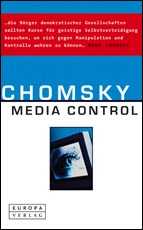
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Noam Chomsky begibt sich in seinem neuen Buch in ein
unerhörtes Spannungsfeld: "Media Control" –
Kontrolle der Medien. Zum einen sind die Medien – ohne
direkter staatlicher Kontrolle zu unterliegen –
Propagandainstrumente der Außenpolitik, zum anderen dienen sie
der gesellschaftlichen Herstellung von Konsens, unterdrücken
Nachrichten, die die Bevölkerung verunsichern könnten, mildern
sie ab, so dass an der Einstellung der politischen Führung kein
Zweifel aufkommt. Dazu gehört die Methode, Verbrechen des
Feindes, wer immer es gerade sein mag, akribisch zu beleuchten und
mit dem Vergrößerungsglas zu untersuchen, während eigene
Untaten oder die verbündeter Staaten in das milde Licht alles
rechtfertigender Nachsicht getaucht werden.
Zum Autor
Noam Chomsky hat seit den sechziger Jahren unsere Vorstellungen über
Sprache und Denken revolutioniert. Zugleich ist er einer der schärfsten
Kritiker der gegenwärtigen Weltordnung und des US-Imperialismus.
Der heute 71-Jährige ist als "der einflussreichste westliche
Intellektuelle" und als "der bekannteste Dissident der
Welt" bezeichnet worden.
Verlagsinformation
Rezension
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen
(Jörg Seiler, April 2003) |
|
|
Nikolai
P. Anziferow: Die Seele Petersburgs. Aus dem Russischen von
Renata von Maydell. Mit einem Vorwort von Karl Schlögel.
Hanser-Verlag, März 2003. ISBN: 3-446-20317-6. |
|

mehr
Infos
bestellen |
Sankt
Petersburg entdecken mit den Augen der Dichter! Von Puschkin über
Gogol und Lermontow bis zur Achmatowa hat diese Stadt die größten
Autoren Russlands zu Gedichten und Erzählungen inspiriert.
Nikolai Anziferow, unvergleichlicher Chronist Petersburgs, folgt
auf der Suche nach der Seele seiner Stadt der Literatur ebenso wie
seiner eigenen Beobachtungsgabe. 1922 erschienen und jetzt zum
ersten Mal ins Deutsche übersetzt, ist das Buch eine Entdeckung für
Liebhaber der russischen Literatur und für alle, die Petersburg
bereisen möchten.
Verlagsinformation |
|
|
Umberto
Eco: Die Bücher und das Paradies. Über Literatur. Aus dem
Italienischen von Burkhart Kroeber. Hanser-Verlag, März 2003.
ISBN: 3-446-20313-3. |
|
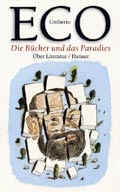
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Ohne
Bücher kein Paradies
–
niemand weiß das besser als Umberto Eco:
so schreibt er fesselnd und gelehrt über sein ureigenstes Thema:
die Literatur, die Phantasie und das Erzählen. Von Don Quixote,
von einer Lesart von Dantes Paradies oder von den Paradoxien von
Oscar Wilde handeln seine Aufsätze. Und manchmal nimmt Eco sein
eigenes Werk und sein eigenes Erzählen zum Bezugspunkt seiner Überlegungen
und wirft damit ein deutliches Licht auf sein eigenes Schreiben.
Zum Autor
Umberto Eco
wurde 1932 in
Alessandria geboren und
lebt heute in Mailand. Er studierte Pädagogik und Philosophie und
promovierte 1954 an der Universität Turin. Anschließend
arbeitete er beim Italienischen Fernsehen und war als freier
Dozent für Ästhetik und visuelle Kommunikation in Turin, Mailand
und Florenz tätig. Seit 1971 unterrichtet er Semiotik in Bologna.
Eco erhielt neben zahlreichen Auszeichnungen den Premio Strega
(1981) und wurde 1988 zum Ehrendoktor der Pariser Sorbonne
ernannt.
Er verfasste
zahlreiche Schriften zur Theorie und Praxis der Zeichen, der
Literatur, der Kunst und nicht zuletzt der Ästhetik des
Mittelalters. Seine Romane
"Der Name der Rose"
und "Das
Foucaultsche Pendel"
sind Welterfolge geworden.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
März
2003 |
|
|
|
Navid
Kermani: Schöner neuer Orient. Berichte von Städten und
Kriegen. C.H. Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-50208-3. |
|
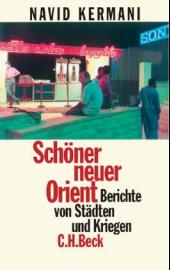
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Erhellend, ernüchternd, irritierend: Navid Kermanis brillante
Reportagen machen das scheinbar Irrationale des Orients verständlich,
das Fremde beängstigend vertraut. Sie führen uns zwischen Ägypten
und Indonesien in all jene Regionen der islamischen Welt, die
heute im Brennpunkt stehen: der Nahe Osten ebenso wie
Zentralasien, Iran ebenso wie Pakistan. So präzise er einzelne
Situationen und Menschen schildert, so weisen doch die Schlüsse,
die er zieht, immer über den Gegenstand seiner Reportage hinaus.
Es sind Analysen auch unserer Welt, die aus der konkreten
Erfahrung erwachsen.
Der Krieg als Wirtschaftsunternehmen, Städte, die ihren Zerfall
organisieren, die Hauptstadt des größten muslimischen Landes als
Tempel des Konsums, der religiöse Extremismus als die perfideste
Form der Globalisierung – der Orient, den Navid Kermani bereist,
hat mit den hübschen Märchen aus tausendundeiner Nacht so wenig
zu tun wie mit den finsteren Klischees von Allahs bärtigen
Kriegern. Die Welt, die sich in seinen Reportagen auftut, ist
modern, erschreckend modern sogar: In vielen Aspekten nimmt sie
vorweg, was auch unseren Wohlstandsgesellschaften droht, wenn ihre
Fliehkräfte übermächtig werden sollten. Immer umfassendere
Ordnungsstrukturen regulieren unser Leben wirtschaftlich,
technologisch und politisch und führen zu einer Angleichung der
Lebensverhältnisse und Werte. Zugleich wächst die Kluft zu jenen
Ländern, Regionen oder Stadtvierteln, die mit der Entwicklung
nicht mehr mithalten, bis sie gänzlich von unserer Realität
abgekoppelt sind – um am Ende um so gewaltsamer in unser Bewusstsein
zurückzukehren.
Zum Autor
Dr. Navid Kermani, geboren 1967, Publizist und
Islamwissenschaftler, ist Long Term Fellow am Wissenschaftskolleg
Berlin. Er arbeitete einige Jahre am Theater, zuletzt als
Dramaturg am Theater an der Ruhr und am Schauspielhaus Frankfurt,
sowie als Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (1995-2000). Für
sein bei C.H. Beck erschienenes Buch "Gott ist schön. Das ästhetische
Erleben des Koran" (Sonderausgabe 2000) erhielt er den
Ernst-Bloch-Förderpreis. Zuletzt erschien von ihm bei C.H. Beck
"Iran.
Die Revolution der Kinder" (Neuauflage in der bsr 2002).
Verlagsinformation |
|
|
Andreas
Bernard/Ulrich Raulff (Hrsg.): Theodor W. Adorno 'Minima Moralia'
neu gelesen. Suhrkamp-Verlag 2003. ISBN: 3-518-12284-3. |
|
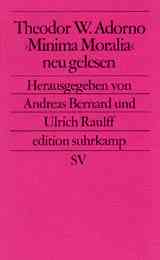
mehr
Infos
bestellen |
Zum Buch
Theodor W. Adorno hat den Deutschen mit den "Minima Moralia"
eines der ganz wenigen und vermutlich das
letzte der philosophischen Volksbücher geschenkt. Wie kaum ein
anderes Buch haben die "Minima Moralia" von Theodor W.
Adorno, 1944 bis 1947 im kalifornischen Exil verfasst, die
intellektuelle Landschaft der jungen Bundesrepublik geprägt.
50 Jahre nach dem ersten Erscheinen haben sich 24 Autoren jeweils
eines der 153 Stücke ausgewählt und mit einem individuellen
Kommentar versehen. So verschieden diese Texte auch ausfallen,
beweisen sie doch zweierlei: die ungebrochene Aktualität von
Adornos schon damals unzeitgemäßem Ansatz, Philosophie zu
betreiben als "Lehre vom richtigen Leben", und: es gibt kein
richtiges Lesen, aber falsche Lektüren.
Zu den
Herausgebern
Andreas Bernard ist Literaturwissenschaftler und fester
Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung, Ulrich Raulff ist
leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung und lehrt
Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin.
Klappentext |
|
|
|
|
Februar
2003 |
|
|
|
Eric
J. Hobsbawm: Ungewöhnliche Menschen. Über Widerstand,
Rebellion und Jazz. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN:
3-423-30873-7. |
|
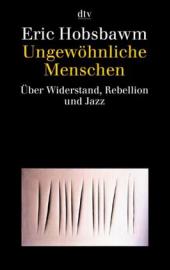
mehr Infos
bestellen
|
Eric
Hobsbawm, den großen Unruhestifter unter den Historikern, haben
sein Leben lang Rebellen beschäftigt. Kein Wunder, dass er nun
Rebellen,
Revolutionäre und Widerständler aus einem halben Jahrtausend
Welt- und Kulturgeschichte versammelt. Dabei geht es ihm nicht um
schlichte Revolutionsmythen, sondern um den Akt des Widerstands,
seinen Erfolg und sein Scheitern und um die rebellischen
Techniken, die von ganz gewöhnlichen Menschen entwickelt wurden:
von wandernden Schustern, vergessenen Verbrechern oder großen
Jazzern.
Verlagsinformation |
|
|
Manuel
Castells: Das Informationszeitalter. Wirtschaft, Gesellschaft,
Kultur. Band 3: Jahrtausendwende. Leske + Budrich-Verlag 2002.
ISBN: 3-8100-3225-5. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der Fall der Sowjetunion, Ausgangspunkt des dritten Bandes der
Trilogie Das Informationszeitalter, zeigt die Unfähigkeit
zentralistischer Staatswirtschaften, mit der Transformation zum
Informationszeitalter fertig zu werden. Aber Ungleichheit,
Polarisierung und sozialer Ausschluss als Folgen der
Globalisierung zeigen sich dem Autor weltweit, u.a. an städtischer
Armut, an der Not der Kinder. Zugleich zeigt Castells, dass und
wie eine global organisierte Kriminalität Wirtschaft und Politik
vieler Länder bedroht. Schließlich lenkt er den Blick auf den
asiatisch-pazifischen Raum als einen der wichtigsten
Einflussfaktoren der Weltwirtschaft.
Im dritten Band liefert Castells das Resümee der Trilogie Das
Informationszeitalter. Es bietet auf der Basis einer
ungeheuren Materialfülle und -analyse die systematische
Interpretation unserer Welt zur Jahrtausendwende.
"Wir leben in einem Zeitalter intensiven und rätselhaften Übergangs,
das vielleicht Veränderung über das Zeitalter der Industrie
hinaus einläutet. Aber wo sind die großen soziologischen Werke,
die diesen Übergang kartieren? Intellektuell schwächliche Erzählungen
über die Informationsgesellschaft und leeres Gerede über die
Post-Moderne und substanzielle gesellschaftliche Interpretationen.
Daher kommt die Wichtigkeit von Manuel Castells dreibändigem
Werk, in dem er versucht, die gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Dynamiken des Informationszeitalters zu
skizzieren. Es ist nicht zu hoch gegriffen, dieses Werk mit Max
Webers 'Wirtschaft und Gesellschaft' zu vergleichen."
(Anthony Giddens, Direktor der London School of Economics, The
Times Higher Education Supplement, London)
Zum
Autor
Manuel
Castells, Jahrgang 1942, ist Professor für Soziologie
sowie
für Stadt- und Regionalplanung an
der University of California, Berkeley (USA), und Mitglied der
European Academy. Er lehrte und forschte an zahlreichen Universitäten
in Europa, Asien, und Lateinamerika und ist Autor von über
zwanzig Büchern, darunter auch der berühmten Trilogie The
Information Age
(deutsch: Das Informationszeitalter).
Verlagsinformation
Weitere Informationen
-
Leseproben und Rezensionen
(Leske + Budrich-Verlag)
-
Rezensionen
(Leske + Budrich-Verlag)
-
Horizont ohne Silberstreif. Noch einmal: Manuel
Castells' "Informationszeitalter"
(NZZ, 29.04.2003) |
|
|
|
|
Januar 2003 |
|
|
|
Reiner Stach: Kafka.
Die Jahre der Entscheidungen.
Fischer-Verlag 2002. ISBN: 3-10-075114-0. |
|
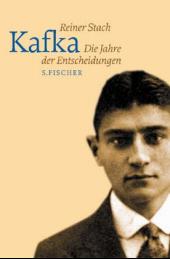
mehr
Infos
bestellen
|
1910
bis 1915: Dies sind die Jahre, in denen sich der junge,
ungebundene, beeinflussbare Kafka verwandelt in den
verantwortungsbewussten Beamten und zugleich in den Meister des präzisen
Alptraums und des "kafkaesken" Humors. In kürzester
Frist entstehen "Das Urteil", "Die
Verwandlung", "Der Verschollene" und "Der
Process", und in rascher Folge werden alle Weichen gestellt,
die Kafkas weiteren Weg bis zum Ende bestimmen werden: die
Begegnung mit dem religiösen Judentum, die ersten Schritte in die
Öffentlichkeit, die Katastrophe des Kriegsausbruchs und vor allem
die verzweifelt umkämpfte und dann doch scheiternde Beziehung zu
Felice Bauer. Es sind Jahre beispielloser Intensität: das Zentrum
von Kafkas Existenz.
Stachs Schilderung ist atmosphärisch dicht und bietet
Panoramablicke über Kafkas Welt ebenso wie Nahaufnahmen aus
seinem Alltag, wobei auch neueste, bisher unveröffentlichte
Forschungsergebnisse aufgenommen werden. Die bildhafte Erzählweise,
die den Leser alle Entscheidungssituationen fast filmisch
miterleben lässt, setzt neue Maßstäbe in der deutschsprachigen
Biographik.
Verlagsinformation |
|
|
Günter Helmes/Werner Köster: Texte zur Medientheorie. Reclam-Verlag
2002. ISBN: 3-15-018239-5. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Medien
beeinflussen Erfahrungsmöglichkeiten und Deutungsmuster und sind
Gegenstand und Instrumente von gesellschaftlichen Konflikten.
Anhand von Quellentexten aus zweieinhalb Jahrtausenden wird das
Nachdenken und das Wissen über Medien in seinen Kontexten repräsentiert:
vom alttestamentlichen Bilderverbot bis zu aktuellen Debatten über
Internet, Hypertext und Cyberspace. Die Texte folgen chronologisch
der Medienentwicklung und geben zugleich ein Bild der sie
begleitenden Ideengeschichte.
Verlagsinformation |
|
|