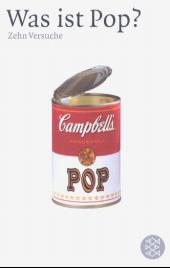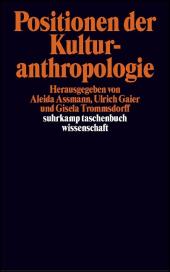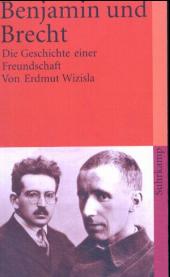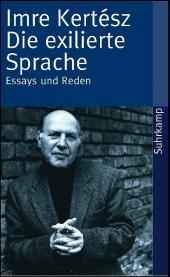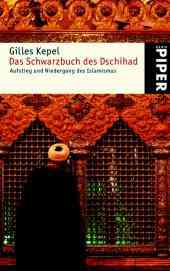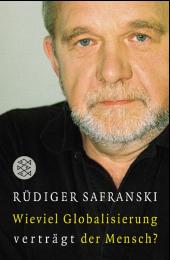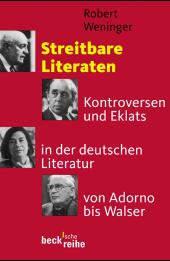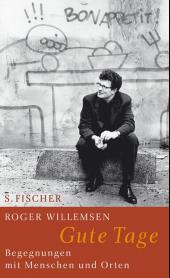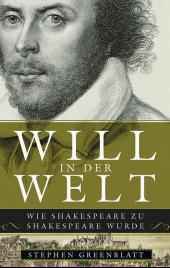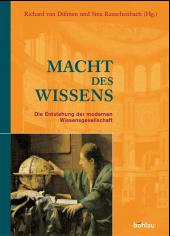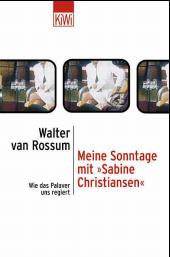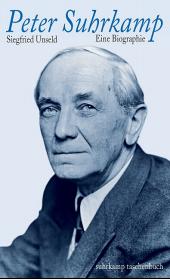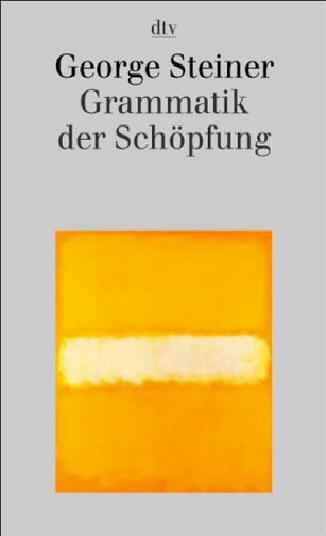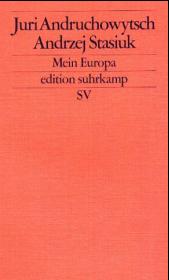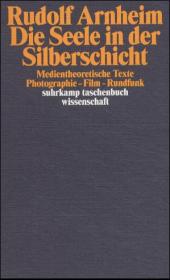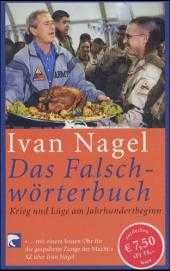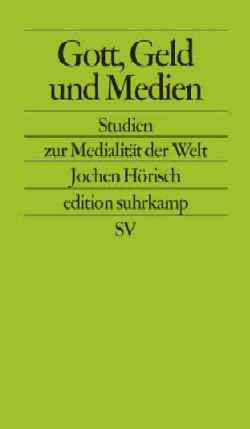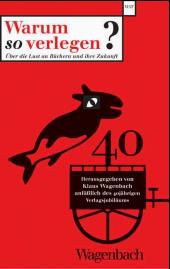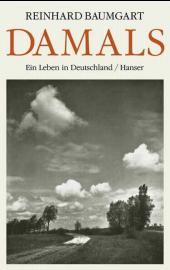|
Dezember 2004 |
|
|
Walter Grasskamp/Michaela Krützen/Stephan Schmitt (Hrsg.): Was ist
Pop?
Zehn Versuche. Fischer Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN 3-596-16392-7. |
|
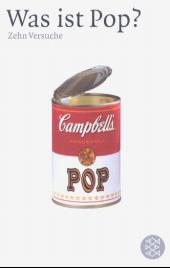
mehr Infos
bestellen |
Pop ist
nicht zu entgehen. Doch das beantwortet noch nicht die Frage, womit
man es beim Phänomen Pop zu tun hat. Zumal das Spektrum seiner
Bedeutungen von der klassischen Pop-Art bis zum populären Geschmack in
Film, TV und Musik reicht. Den verschiedenen Facetten widmen sich: Ulf
Poschardt, Boris Groys, Rudolf Zwirner, Beat Wyss, Harry Walter/Rene
Straub, Michaela Krützen, Peter Wicke, Enjott Schneider, Lorenz Engell
und Elisabeth Bronfen.
Verlagsinformation |
| |
|
Aleida Assmann/Ulrich Gaier/Gisela
Trommsdorff (Hrsg.): Positionen der Kulturanthropologie.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-29324-9. |
|
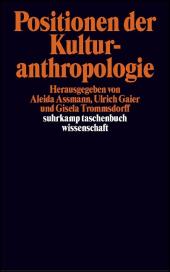
mehr Infos
bestellen |
Anders als
die klassische Anthropologie geht es der noch jungen Disziplin der
Kulturanthropologie nicht um den Menschen im allgemeinen und sein
unabhängig von historischen und kulturellen Prägungen konstituiertes
"Wesen", sondern um die unterschiedlichen Menschenbilder, die sich im
Verlauf der Diskursgeschichte herausgebildet haben. Im Vordergrund
stehen dabei die materiellen, ideellen und medialen Grundlagen ihrer
Entstehung, ihre Wirkung und ihre mitunter gewaltsame Durchsetzung.
Darüber hinaus interessiert sich diese literarisch informierte und
kulturwissenschaftlich interessierte Anthropologie auch für die
Körpergeschichte, d. h. für die physischen und psychischen
Voraussetzungen des Menschen, die den verschiedenen kulturellen
Forderungen und Formungen immer wieder Grenzen setzen. Aus dieser
doppelten Perspektive widmen sich die Aufsätze dieses interdisziplinär
angelegten Bandes dem Zusammenhang zwischen "Literatur" und
"Anthropologie". Als Leitmotiv fungiert dabei die Frage, wie sich das
Studium der Literatur für die Grundfrage nach dem Menschen in seinen
historischen und kulturellen Bedingungen fruchtbar machen lässt.
Verlagsinformation |
| |
|
Erdmut Wizisla: Benjamin und Brecht.
Die Geschichte einer Freundschaft. Mit einer Chronik und den
Gesprächsprotokollen des Zeitschriftenprojekts 'Krise und Kritik'.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-39954-3. |
|
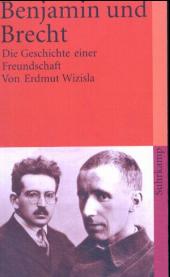
mehr Infos
bestellen |
Die
Freundschaft zwischen Walter Benjamin und Bertolt Brecht gehört zu den
ästhetisch und politisch folgenreichen des 20. Jahrhunderts. Hannah
Arendt nannte die Freundschaft "einzigartig", "weil in ihr der größte
lebende deutsche Dichter mit dem bedeutendsten Kritiker der Zeit
zusammentraf". Andere Freunde teilten dieses Urteil nicht. Ihr Argwohn
hat zu Fehldeutungen geführt, die sich bis heute halten.
Das Buch sichert die Spuren der Begegnung und räumt dabei Vorurteile
aus dem Weg. Zahlreiche unveröffentlichte Dokumente ermöglichen neue
Wertungen. Erstmals analysiert werden die Gesprächsprotokolle des
Zeitschriftenplans "Krise und Kritik" (1930/31), die dem Band als
Faksimile beigegeben sind.
Anhand von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Notizen werden die
Themen der Zusammenarbeit aufbereitet. Eigene Kapitel widmen sich
sowohl Benjamins Arbeiten über Brecht als auch Brechts Äußerungen über
Benjamin.
Verlagsinformation |
| |
|
Imre Kertesz: Die exilierte Sprache.
Essays und Reden. Vorwort von Peter Nadas. Aus dem Ungarischen von
Kristin Schwamm, György Buda, Geza Dereky u. a. Suhrkamp-Verlag 2004.
ISBN: 3-518-45655-5. |
|
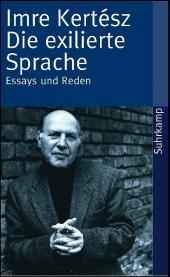
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Bald nach der europäischen Wende, nachdem sein erzählerisches Werk
endlich die erste Würdigung erfahren hatte, begann Imre Kertesz, sich
auch in Reden und Essays, die von der Erfahrung des Überlebenden,
Zeugen und Wächters inspiriert waren, zur ethischen und kulturellen
Bedeutung des Holocaust zu äußern. Die hier versammelten Essays,
Betrachtungen und Reden über den Umgang mit dem Holocaust, das
totalitäre 20. Jahrhundert, über Überleben und Exil, die Erscheinungen
der Wende und das zu erneuernde Europa bilden die Summe eines
unerbittlichen Nachdenkens.
Zum Autor
Imre Kertesz, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 nach Auschwitz
deportiert und 1945 in Buchenwald befreit. Er gilt seit dem späten
Erfolg seines "Roman eines Schicksallosen" als einer der großen
europäischen Schriftsteller. Die jahrelange Arbeit an diesem Roman,
der 1975 in Ungarn erschien, finanzierte er durch Musicals und
Unterhaltungsstücke. Er betätigte sich als Übersetzer von Freud,
Nietzsche, Hofmannsthal, Canetti, Wittgenstein und anderen. 2000
erhielt er den "Welt"-Literaturpreis, 2002 den Nobelpreis für
Literatur und 2004 den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten
und den Corine –
Internationaler Buchpreis 2004 für sein Lebenswerk.
Verlagsinformation |
| |
|
November 2004 |
|
|
|
Gilles
Kepel: Das Schwarzbuch
des Dschihad. Aufstieg und Niedergang des Islamismus. Mit einem
Vorwort zur deutschen Ausgabe. Piper-Verlag 2004. ISBN: 3-492-24248-0. |
|
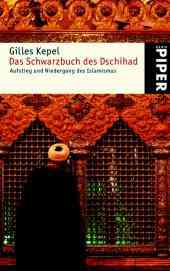
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Seit dem terroristischen Angriff auf die USA im Herbst 2001 fragt sich
die Welt, was der Islamismus ist und welche Gefahr von ihm ausgeht.
Gilles Kepel zieht aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema
einen aufsehenerregenden Schluss: Die Expansion des militanten
Islamismus hat ihren Höhepunkt überschritten, er ist im Niedergang
begriffen. Mit bestechender Sachkenntnis stellt Kepel in diesem Buch
die Entwicklung aller wichtigen radikal-islamistischen Organisationen
weltweit dar und gibt tiefe Einblicke in die fremde und so wichtige
Welt des islamischen Fundamentalismus. Wer wissen will, wie sich die
islamische Welt entwickeln wird, für den ist dieses kompetente und
höchst lesenswerte Buch unverzichtbar.
Rezension
"Ein fundierter und detaillierter Überblick über die Entwicklung
und die regionalen Ausformungen des Islamismus." (NZZ)
Zum Autor
Gilles Kepel, geboren 1955, studierte Soziologie und Arabistik, ist
Professor für Politische Studien am Institut d'Etudes Politique in
Paris und hatte zahlreiche Gastprofessuren inne. Er gilt als einer der
renommiertesten Forscher zum Thema des islamischen Fundamentalismus.
Verlagsinformation |
| |
|
Rüdiger Safranski: Wieviel
Globalisierung verträgt der Mensch? Fischer-Taschenbuch-Verlag
2004. ISBN: 3-596-16384-6. |
|
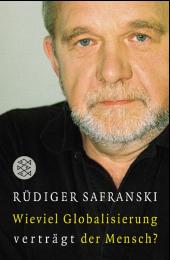
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Das Denken selbst gerät in eine Globalisierungsfalle: Wie beherrscht
man das Globale, fragen die einen, und wie rettet man es, fragen die
anderen. Rüdiger Safranski ermutigt, Freiräume für Gleichgewicht und
Handlungsfähigkeit zu schaffen, denn Globalisierung lässt sich nur
gestalten, wenn darüber nicht die andere große Aufgabe versäumt wird:
das Individuum, also sich selbst zu gestalten.
Zum Autor
Rüdiger Safranski, geboren 1945, Philosoph und Schriftsteller, lebt in
Berlin. Er veröffentlichte Biographien über E. T. A. Hoffmann,
Schopenhauer (2001) und Heidegger sowie den großen philosophischen
Essay "Wie
viel Wahrheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und Lebbare"
(1990). In der Reihe "Philosophiejetzt!" ist von ihm der Band über
Schopenhauer (1998) erschienen.
Verlagsinformation |
| |
|
Robert Weninger: Streitbare
Literaten. Kontroversen und Eklats in der deutschen Literatur von
Adorno bis Walser. Originalausgabe. C.H. Beck-Verlag 2004. ISBN:
3-406-51132-5. |
|
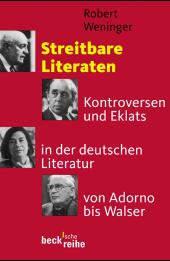
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
In zwölf ausführlich dokumentierten Kapiteln beschreibt der britische
Germanist Robert Weninger spannungsreich und nachvollziehbar den
Verlauf von zwölf der wichtigsten deutschsprachigen Literaturdebatten
seit 1945, die mit den Namen Thomas Mann, Theodor W. Adorno, Rolf
Hochhuth, Emil Staiger, Heinrich Böll, Rainer Werner Fassbinder,
Thomas Bernhard, Christa Wolf, Botho Strauß, Peter Handke, Martin
Walser und Günter Grass verknüpft sind. Anhand dieser zwölf "Fälle"
entsteht eine kleine Skandalgeschichte der deutschsprachigen Literatur
seit 1945, die sowohl die Umbrüche als auch die Konstanten und
Kontinuitäten in den mehrfachen Krisen der gesellschaftlichen
Selbstreflexion und Identitätsfindung in diesem Halbjahrhundert
anschaulich nacherlebbar macht.
Zum Autor
Robert Weninger ist Professor für Neuere Deutsche Literatur am
King's College der Universität London.
Verlagsinformation |
| |
|
Oktober 2004 |
|
|
|
Roger
Willemsen: Gute Tage.
Begegnungen mit Menschen und Orten. S. Fischer-Verlag 2004. ISBN:
3-10-092100-3. |
|
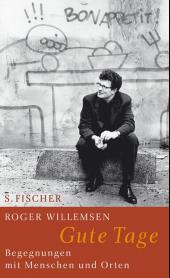
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Eine Orang-Utan-Forscherin im Dschungel Borneos – Madonna sprachlos in
Paris – John le Carré und der KGB in Cornwall – Yassir Arafat und die
Schokoladenprinten in Tunis – Margaret Thatcher und ihr alter Globus
in London – John Malkovich auf der Burg des Marquis de Sade – Jean
Seberg im Film und in Paris – Timothy Learys letzte Worte in Hollywood
– Tina Turner auf der Plantage und in Monte Carlo – Vivienne Westwood
untragbar in der Welt der Mode – der Dalai Lama beim Essen in
Nordindien ... und Harald Schmidt, Mikis Theodorakis, Sinead O'Connor,
Papa Wemba und Jane Birkin an guten Tagen.
Zum Autor
Roger Willemsen,
geboren 1955, beendete sein Studium mit einer Promotion über die
Ästhetik Robert Musils. Nach Tätigkeiten als Übersetzer und
Korrespondent hatte er 1991 seine erste eigene Fernsehsendung bei
"Premiere", der sich "Willemsens Woche", "Nachtkultur mit Willemsen"
und "Willemsens Musikszene" anschlossen. Außerdem veröffentlichte er
mehrere Bücher, drehte und produzierte zahlreiche Filme und zeichnete
verantwortlich für das EXPO-Projekt "Welcome home. Künstler sehen
Deutschland".
Verlagsinformation |
| |
|
Stephen Greenblatt: Will in der
Welt.
Wie Shakespeare zu Shakespeare wurde. Berlin-Verlag 2004. ISBN:
3-8270-0438-1. |
|
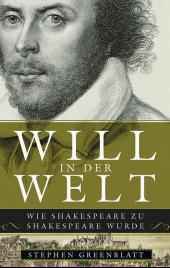
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Eine Lebensbeschreibung des berühmtesten Dichters der abendländischen
Literatur aus der Feder eines der besten Shakespeare-Kenner der
Gegenwart. Mit enormer Geschichtskenntnis und großem Scharfsinn
entwirft Stephen Greenblatt ein überzeugendes Bild des großen
Shakespeare in seiner Zeit.
Rezension
"Dies ist, endlich,
das Buch, das Shakespeare verdient hat: ein brillantes Buch,
geschrieben von einem virtuellen Augenzeugen, der versteht, wie ein
Dramatiker den Stoff seines Lebens in Theater verwandelt." (Charles
Mee, Dramatiker)
Verlagsinformation |
| |
|
Richard van Dülmen/Sina
Rauschenbach u.a. (Hrsg.): Macht des Wissens:
Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft. Böhlau-Verlag 2004.
ISBN: 3-412-13303-5. |
|
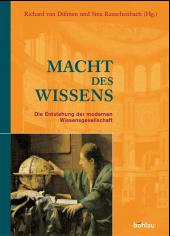
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
In diesem großzügig bebilderten Band wird eine Kulturgeschichte des
Wissens entworfen. Das Buch geht der Frage nach, wie sich die moderne
Wissensgesellschaft von der Frühen Neuzeit bis zum Beginn des 19.
Jahrhunderts herausbildete. In einer Gesamtschau wird erstmals
beschrieben, wie sich im Laufe der Jahrhunderte das Wissen in den
verschiedenen Bereichen des Denkens änderte und wie es schließlich
dazu kam, dass sich in der Neuzeit rational begründete
Wissenschaftssysteme etablieren konnten.
Das Wissen, so scheint es, hat in der globalisierten Welt des 21.
Jahrhunderts als Schlüssel zu Wohlstand, Einfluss und Macht eine
überragende Bedeutung erlangt. Unsere Gesellschaft bezeichnet sich
gerne als "Wissensgesellschaft", um sich von der
"Industriegesellschaft" der Moderne abzusetzen. Doch auch schon vor
unserer Zeit, eigentlich seit jeher, haben sich die Menschen in den
verschiedensten sozialen, kulturellen und politischen Verhältnissen
auf "Wissen" berufen. Und immer schon galt, dass derjenige, der über
Wissen verfügte, auch Macht hatte. Aber das Wissen, um das es ging,
war nicht zu allen Zeiten dasselbe. Insbesondere in der Frühen Neuzeit
entstand etwas Neues, ein Wissen, das zunehmend an Bedeutung gewann
und durch das sich neue Mächte und Machtverteilungen in Staat und
Gesellschaft entwickelten. Dieses Wissen steht im Mittelpunkt der
folgenden Darstellung. Es war verbunden mit den Kenntnissen und
Konsequenzen, die sich aus einer ebenfalls neuartigen
wissenschaftlichen Forschung ergaben, und es wurde grundlegend für das
moderne Weltbild, die Verständigung der Menschen in immer
universaleren Zusammenhängen, schließlich allgemein für die Begründung
von sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen. Das vorliegende
Unternehmen knüpft an eine moderne Wissenschaftsgeschichte an, die
sich auch und gerade der wissenschaftlichen Praxis, den verschiedenen
und einander beeinflussenden Wissenskulturen sowie der Herkunft und
Funktion der Wissenschaften widmet.
Die Beiträge sind von einer interdisziplinären Gruppe von
Wissenschaftern und Wissenschafterinnen geschrieben. Sie wenden sich
an eine breite und vielfältig interessierte Leserschaft.
Zum Autor
Richard van Dülmen
ist Professor für Geschichte an der Universität des Saarlandes in
Saarbrücken. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift "Historische
Anthropologie", die seit 1993 im Böhlau-Verlag erscheint.
Verlagsinformation |
| |
|
Juni 2004 |
|
|
|
Walter van Rossum: Meine Sonntage mit 'Sabine
Christiansen'. Wie das Palaver uns regiert. Kiepenheuer &
Witsch-Verlag 2004. ISBN: 3-462-03394-8. |
|
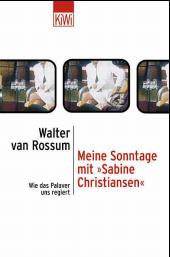
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Allsonntäglich entfaltet sich ab 20 Uhr die neue deutsche
TV-Dreifaltigkeit: Tagesschau, Tatort, Talk mit Sabine Christiansen.
Nach den Mythen der Tagesschau (Staatsmänner, Kriege, Katastrophen,
Sport) und den tröstlichen Gewissheiten des Tatorts (Alle haben Dreck
am Stecken) sondiert Sabine Christiansen das Gesellschaftsterrain.
Unerbittlich stellt sie Fragen, die in das Dunkel unserer Zukunft
weisen. Es treten auf: die Lobbyisten und ihre Statthalter im
Parlament. Multimillionäre warnen davor, dass es kurz vor zwölf sei.
Aber, bitte sehr, man könne ja auch ins Ausland gehen. Politiker
führen entschlossen das Drama der Sachzwänge auf. Die große Koalition
der Dauerreformer gibt sich die Ehre. Fast noch wichtiger als das, was
gesagt wird, ist, was systematisch nicht gesagt wird. Komplexe Themen
werden dramatisch vereinfacht und fortan in diese Richtung öffentlich
diskutiert. Insofern eignet sich diese Sendung wie keine andere, um zu
begreifen, wohin die Deutschland AG steuert.
In 'Meine Sonntage mit "Sabine Christiansen"' schreibt Walter van
Rossum hellsichtig, intelligent und bitterböse über eine
Medienlandschaft, die die Politik im eigentlichen Sinne längst zu
überwuchern droht.
Zum Autor
Walter van Rossum, Jg. 1954, lebt in Köln und Marokko. Studium der
Romanistik, Philosophie und Geschichte in Köln und Paris, Promotion
1989. Seit 1981 freier Autor für WDR, Deutschlandfunk, Die Zeit, FAZ
und Freitag. Für den WDR moderiert er unter anderem die
"Funkhausgespräche". 1988 erhielt er den Ernst-Robert-Curtius-Preis
für Essayistik. Letzte Buchveröffentlichung: "Simone
de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Die Kunst der Nähe" (1998).
Verlagsinformation |
| |
|
Siegfried Unseld u.a.: Peter Suhrkamp. Zur
Biographie eines Verlegers in Daten, Dokumenten und Bildern.
Suhrkamp-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-518-45597-4. |
|
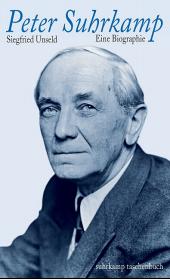
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Peter Suhrkamp, geboren 1891, wächst im oldenburgischen Dorf
Kirchhatten als Sohn eines Landwirts auf. Nach einer Lehrerausbildung
meldet er sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst, nach dem Ersten
Weltkrieg arbeitet er bis 1929 als Lehrer. Im Januar 1933 tritt er in
den S. Fischer-Verlag ein, und als 1936 die Erben von Samuel Fischer
Deutschland verlassen müssen, leitet Peter Suhrkamp den Verlag bis zu
seiner Verhaftung im April 1944. Im Februar 1945 wird er todkrank aus
der KZ-Haft entlassen und erhält im Oktober als erster deutscher
Verleger in Berlin eine Verlagslizenz. 1950 kommt es zur Trennung vom
S. Fischer-Verlag und, von Hermann Hesse gedrängt, gründet Suhrkamp im
Juli 1950 den Suhrkamp-Verlag. Im März 1959 stirbt er in Frankfurt am
Main.
"Das Buch ist eine unausschöpfliche Fundgrube über das verlegerische
und persönliche Leben des großen Menschen Peter Suhrkamp, der zu den
bedeutendsten Persönlichkeiten im deutschen Verlagsleben zählte und
dessen Lebenswerk einem durch schwere Krankheit und fast permanentes
Leiden geschwächten und lädierten Körper abgerungen werden musste. Nur
mit großer Erschütterung und Bewunderung folgt man diesem
Lebensbericht, dessen geistiger Gehalt im Rahmen einer knapp
bemessenen Besprechung kaum adäquat dargestellt werden kann. Kein
anderer Verleger hatte in den Zeiten der nationalsozialistischen
Herrschaft auf so schwierigem Posten einen so gefährdeten Verlag zu
führen und ihm kompromisslos mit aller nur denkbaren Zähigkeit die
Unabhängigkeit gegenüber drohender politischer Eingriffe zu erhalten.
Diese einmalige Tat und der darauf folgende Aufbau eines eigenen
Verlags mit Weltgeltung sind ein Sonderfall in der deutschen
Verlagsgeschichte." (Hans-Otto Mayer)
"Peter Suhrkamps Vorrat an Zähigkeit, an Erdnähe, an Ordnungssinn und
duldender Kraft lag zeitlebens im Streit mit seinem individuellen
Temperament und Charakter, die ihn gezwungen haben, das väterliche
Bauernerbe auszuschlagen, die Heimat zu meiden, öfter den Beruf zu
wechseln und als Lehrer, Soldat, Offizier, Dramaturg, Redakteur,
Verleger und Schriftsteller sich allein und unabhängig die Welt zu
erobern.
Zum Autor
Siegfried Unseld, geboren 1924 in Ulm, promoviert 1951 mit einer
Arbeit über Hermann Hesse und wird 1959 in der Nachfolge Peter
Suhrkamps der Verleger des Suhrkamp-Verlags, später auch des
Insel-Verlags. Er stirbt 2002 in Frankfurt am Main.
Helene Ritzerfeld, geboren 1914 in Köln, arbeitet sie 1950 als Peter
Suhrkamps Assistentin. Seit 1959 bis zu ihrem Tod im Jahr 2000 leitet
sie im Suhrkamp-Verlag die Abteilung Rechte und Lizenzen.
Verlagsinformation |
| |
|
|
|
Mai
2004 |
|
|
|
George Steiner: Grammatik der Schöpfung.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-423-34095-9. |
|
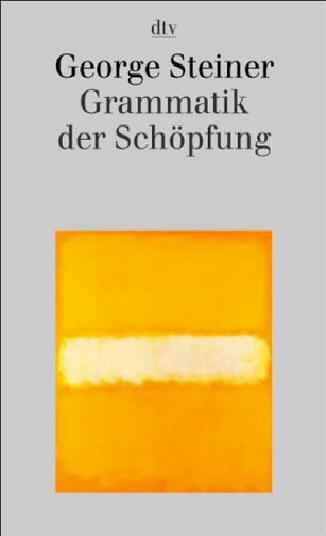
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
George Steiners neues Buch handelt von der Idee der Schöpfung, wie sie
sich in der westlichen Kultur von der Bibel über Literatur und Kunst
bis in die Philosophie und die Wissenschaftsgeschichte verbreitet hat.
Und es zeigt, dass vom 20. Jahrhundert, mit seinem Glauben an
Wissenschaft und Technik, keine Antworten mehr auf die großen Fragen
der Moral, der Politik und der Ästhetik zu erwarten sind. Eine
Entwicklung, die in ihren Konsequenzen – laut Steiner – ungeheure
Verluste in Kauf nimmt.
Zum Autor
George Steiner, geboren 1929 in Paris, lehrt seit 1994 auf dem
Lord-Weidenfeld-Lehrstuhl für Komparatistik an der Universität Oxford
Englische und Vergleichende Literaturwissenschaft. Von ihm sind u.a.
erschienen: "Martin
Heidegger" (1989), "Von
realer Gegenwart" (1990) und "Der
Garten des Archimedes" (1997). Steiner wurde 2003 mit dem
Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet.
Verlagsinformation |
| |
|
George Steiner: Nach Babel. Suhrkamp-Verlag
2004. ISBN: 978-3-518-29284-6. |
|

mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
"Nach Babel" postuliert die These, dass das Übersetzen Tei eines jeden
Kommunikationsaktes ist und somit der zentrale Ansatzpunkt für das
Verstehen von Sprache. In seiner Analyse der Übersetzung verbindet
George Steiner die verschiedenen Gebiete von Rhetorik,
Literaturgeschichte und -wissenschaft sowie der Linguistik wie auch
der Sprachphilosophie und beleuchtet ihre wechselseitigen
Beeinflussungen. Für George Steiner birgt der Mythos von Babel, also
der Verlust der einen Sprache, ein schöpferisches Potential für
die Menschheit. Denn wer übersetzt, interpretiert notwendigerweise,
und so spiegeln Sprachen die Mechanismen der Welterschließung wider.
Zum Autor
George Steiner, geboren 1929 in Paris, lehrt seit 1994 auf dem
Lord-Weidenfeld-Lehrstuhl für Komparatistik an der Universität Oxford
Englische und Vergleichende Literaturwissenschaft. Von ihm sind u.a.
erschienen: "Martin
Heidegger" (1989), "Von
realer Gegenwart" (1990) und "Der
Garten des Archimedes" (1997). Steiner wurde 2003 mit dem
Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet.
Verlagsinformation |
| |
|
Juri Andruchowytsch/Andrzej
Stasiuk: Mein Europa. Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12370-X. |
|
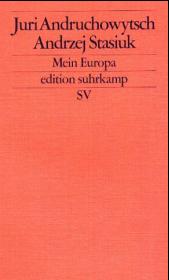
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
"Zwei Essays über das so genannte Mitteleuropa" nennen Juri
Andruchowytsch und Andrzej Stasiuk ihr literarisches Doppelporträt
einer Landschaft, die sie gemeinsam durchreist haben. Zu Fuß und im
Auto zwischen den Beskiden und der Bukowina unterwegs, auf polnischem,
slowakischem, tschechischem, ungarischem, rumänischem und ukrainischem
Territorium, erschaffen sie – Ethnografen, Kartenleser, Reporter und
Dichter zugleich – ein neues Gelände: das literarische Mitteleuropa.
Während Andruchowytsch in den Ruinen des früheren Galizien auf
Fragmente einer versunkenen Welt stößt und eine "Familiensaga"
erzählt, tritt Stasiuk als wahrnehmungsbesessener, mit einem magischen
Auge begabter Landvermesser auf. Ihre "Geopoetik" ist ein
unentbehrlicher Beitrag zur Entdeckung des neuen Europa und zur
Überwindung jener Grenze, die mit der Erweiterung der EU im Mai 2004
Polen und die Ukraine voneinander zu trennen droht.
Zu den Autoren
Juri Andruchowytsch, geboren 1960, lebt in Iwano-Frankiwsk/Westukraine.
Zuletzt erschien von ihm "Das
letzte Territorium" (2003).
Andrzej Stasiuk, geboren 1960, lebt seit 1986 in Wolowiec/Südpolen.
Zuletzt erschien "Die
Mauern von Hebron" (2003).
Verlagsinformation |
| |
|
Rudolf Arnheim: Die Seele in der Silberschicht.
Medientheoretische Schriften: Fotografie – Film – Rundfunk.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-29254-4. |
|
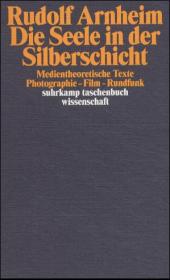
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Rudolf Arnheim, der am 15. Juli 2004 seinen 100. Geburtstag feiert,
hat sich zeit seines Lebens intensiv mit den Medien künstlerischer
Produktion auseinandergesetzt. Seine wichtigsten medientheoretischen
Aufsätze, entstanden über einen Zeitraum von 74 Jahren, stellen eine
maßgebliche Ergänzung seiner Hauptwerke "Film als Kunst" und "Rundfunk
als Hörkunst" dar und sind hier erstmals vollständig versammelt.
Arnheims medientheoretische Überlegungen nehmen dabei in der Regel
ihren Ausgang beim einzelnen Medium – bei der Fotografie, dem Rundfunk
und insbesondere beim Film – und belegen in eindrucksvoller Weise
seine produktive Auseinandersetzung mit konstruktiven formästethischen
Fragen.
Zu den Autoren
Rudolf Arnheim, geboren 1904 in Berlin, war u.a. von 1928 bis 1933
Kulturredakteur der Weltbühne. Nach seiner Emigration unterrichtete er
an zahlreichen US-Universitäten und widmete sich dabei insbesondere
Fragen der Wahrnehmungs- und Medientheorie. Er lebt heute in Ann Arbor
(Michigan/USA). Bei Suhrkamp sind von ihm erschienen: "Rundfunk
als Hörkunst" (2001) und "Film
als Kunst" (2002).
Helmut H. Diederichs, geboren 1948, ist Professor für Medienpädagogik
am Fachbereich Soziales der Fachhochschule Dortmund.
Verlagsinformation |
| |
|
|
|
April 2004 |
|
|
|
Ivan Nagel:
Das Falschwörterbuch. Krieg und Lüge am Jahrhundertbeginn.
Berliner Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-8333-0105-8. |
|
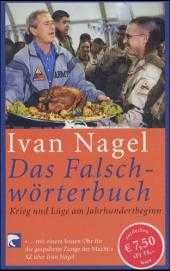
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
George W. Bushs Truppenbesuch im Irak zum Erntedankfest ("Thanksgiving
Day") am 29. November 2003 steigerte die Zahl der Parteigänger unter
den Wählern von 56% auf 61%. Die wirkungsvollste Fotografie (d8ie die
Nöte der Besatzungsarmee in einer herzerwärmenden US-amerikanischen
Familienszene auflöst) hatte einen Fehler: Der prächtige Truthahn, den
der Präsident seinen Soldaten darbrachte, war nur zur
Kantinendekoration, nicht zum Verzehr hergestellt.
In einer Reihe von Einsprüchen und Analysen versucht Ivan Nagel, einer
der gewichtigsten Kulturkritiker unserer Zeit, alte und neue Formen
des Krieges nach dem 11. September 2001 zu begreifen. Werden sich
künftig Herrschaft und Terror (die weltweite US-Hegemonie und der
Widerstand ihrer erbitterten Gegner) ausschließen oder gegenseitig
steigern? Ist eine Reihe von Kriegen gegen die "Achse des Bösen"
unvermeidlich – oder kann eine Minderung der globalen Ungleichheit
auch die Kriegsgefahr vermindern? Ivan Nagel zeigt auf, wie der Beginn
dieses Jahrhunderts gespickt ist mit "Falschwörtern" – und wie die
Lügen der internationalen und der deutschen Politik uns eine Zukunft
von Konflikten, Aggressionen, Kriegen aufzwingen.
"Die Sprache ist so poetisch, dass Ivan Nagels Sätze zugleich
besänftigend wirken, wo sie dennoch Wut artikulieren ... Sie weisen
immer wieder darauf hin, dass enthemmte Spießigkeit im Denken zu
politischen Katastrophen führt." (Christina Weiss in LITERATUREN über
"Streitschriften")
"Ivan Nagel hat widersprochen und ist selbst ein Widerspruch,
bestechlich nur in der Liebe für die Sache, die er zu der seinen
gemacht hat. Er ist wohl der außenseiterischste Insider der Kultur,
ein Einzeldoppelgänger mit einem feinen Ohr für die gespaltene Zunge
der Macht." (Christopher Schmidt, Süddeutsche Zeitung)
Zum Autor
Ivan Nagel, geboren 1931 in Budapest, emigrierte nach der Verfolgung
in der Nazizeit siebzehnjährig aus Ungarn. Er studierte Philosophie,
Soziologie und Germanistik in Paris, Heidelberg, Durham und Zürich
sowie ab 1953 Philosophie bei Adorno in Frankfurt am Main. Nagel war
Chefdramaturg der Münchner Kammerspiele 1961-69, Intendant des
Deutschen Schauspielhauses in Hamburg 1971-79, Begründer und Leiter
der internationalen Festspiele "Theater der Welt" sowie Theater- und
Musikkritiker. 1989-96 übte er eine Professur für "Geschichte und
Ästhetik der Darstellenden Künste" an der Hochschule der Künste in
Berlin aus. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören
"Autonomie und Gnade - Über Mozarts Opern" (1985) und "Streitschriften"
(2001).
Verlagsinformation |
| |
|
Jochen Hörisch: Gott, Geld und Medien. Studien zur Medialität der Welt.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12363-7. |
|
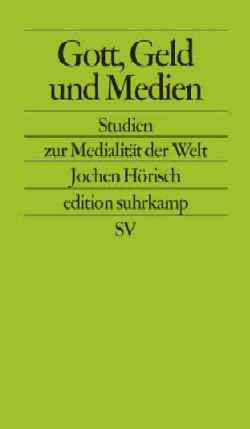
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Am 11. September 2001 wurden mit terroristischer Überdeutlichkeit drei
voneinander weit entfernt scheinende Sphären aufeinander bezogen: Im
Namen Gottes wurde das hochsymbolische Zentrum des internationalen
Geldverkehrs medientauglich in Schutt und Asche gelegt. Gott, Geld und
Medien stehen aber nicht erst seit diesem Terrorakt in einem intimen
Spannungsverhältnis zueinander. Die Studien von Jochen Hörisch gehen
der Geschichte und der Tiefenstruktur theologischer, monetärer und
medialer Grammatiken nach und vertiefen die Analysen, die in den
Bänden "Brot und Wein – Die Poesie des Abendmahls" , "Kopf oder Zahl –
Die Poesie des Geldes" und "Ende der Vorstellung – Die Poesie der
Medien" vorgestellt wurden.
Ihr Befund ist frappant: Gott, Geld und Medien stehen deshalb in einem
so scharfen Konkurrenzverhältnis zueinander, weil sie so viele
Gemeinsamkeiten haben: "Die drei leistungsstarken, weil
paradoxie-sensiblen Leitmedien Religion, Geld und Medien bzw., um in
metonymischer Verdichtung zu formulieren, Hostie, Münze und CD-ROM
sorgen für die elastischen und ineinander konvertierbaren Integrale,
die die abendländisch-christlichen bzw. westlichen Gesellschaften und
Kulturen zusammenhalten." (Jürgen Hörisch, Ausschnitt)
Zum Autor
Jochen Hörisch, geboren 1951 in Bad Oldesloe, ist Professor für Neuere
Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim.
Verlagsinformation |
| |
|
Klaus Wagenbach (Hrsg.): Warum SO verlegen?:
Über die Lust an Büchern und ihre Zukunft. Herausgegeben anlässlich
des 40jährigen Verlagsjubiläums. Wagenbach-Verlag 2004. ISBN:
3-8031-2487-5. |
|
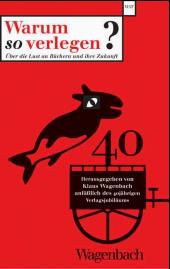
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Warum SO verlegen und nicht anders? Diese Frage versucht der Almanach
ganz praktisch zu beantworten, anhand eines nahe liegenden Beispiels:
Warum und wie überlebt ein Verlag, der Bücher ausschließlich nach
bestem Wissen und Gewissen veröffentlicht, 40 Jahre?
David packt den Stein aus, und Sie dürfen mitlachen: über
gesamtdeutsche Projekte, Träume vom Kollektiv oder den Fredenbeker
Bananenaufstand. Über Polizisten, die den Verlag stürmen, und
Staatsanwälte, die ihm den Bankrott an den Hals wünschen. Oder
mitdenken: über Geschichtsbewusstsein, Anarchie und Hedonismus. Über
Karnickel, Kollegen, Kafka. Oder über den berüchtigten SALTO zwischen
Schwarzer Kunst und Neuer Mitte. Dazwischen können Sie lesen: die
schönsten Texte aus 40 Jahren.
Zum Herausgeber
Klaus Wagenbach, geboren 1930, gründete 1964 den bis heute
unabhängigen Verlag Klaus Wagenbach. Wagenbach ist berüchtigte,
dienstälteste Witwe Kafkas, Autor und Herausgeber von Anthologien und
erhielt zahlreiche, insbesondere italienische Ehrungen.
Verlagsinformation |
| |
|
|
|
März
2004 |
|
|
|
Reinhard Baumgart: Damals.
Ein Leben in Deutschland 1929-2003. Hanser-Verlag 2003. ISBN:
3-446-20451-2. |
|
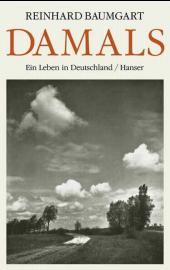
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Reinhard Baumgart ist ein Erzähler von hohen Gnaden.
In seiner Autobiografie schildert er
die Geschichte seines Lebens und des Jahrhunderts:
von der Familie und der verlorenen Kindheits- und Jugendlandschaft in
Schlesien, von der Zerstörung dieser Welt durch Nazismus und Krieg,
von Flucht und Vertreibung, vom Neubeginn im amerikanisch besetzten
Allgäu. Und dann die neu entstehende Literatur der Nachkriegszeit: die
Begegnung mit Thomas Mann und die Gründung der Gruppe 47, die
wachsenden Freundschaften mit Ingeborg Bachmann und Uwe Johnson, die
Arbeit und Konflikte mit Verlegern und Kollegen, mit Rudolf Augstein
oder Marcel Reich-Ranicki – all das zeichnet
ein Bild von fünfzig Jahren Literatur aus erster Hand.
"Wir werden ihn sehr vermissen", schrieb Iris
Radisch in der ZEIT nach Baumgarts plötzlichem Tod. Und Baumgarts wohl
bedeutendstes Buch muss nun postum erscheinen: Noch im Sommer hatte er
seine Lebenserinnerungen abgeschlossen, mit denen wir nun noch einmal
seine unverwechselbare Stimme hören. Mit "Damals" ist Baumgart
die lebendige Lebens- und Literaturgeschichte eines
Schriftstellers gelungen, der sich seinen
unabhängigen Blick bewahrt hat.
"Ohne diese dreißiger und vierziger Jahre, verstrickt in die deutsche
und großdeutsche Zeit, ohne den Verlust der Heimat, ohne das früh so
vage wie heftig einsetzende Gefühl, ich könnte unter dem Druck der
großen Zeit nicht mein eigenes Leben führen, es wäre mir enteignet
– ohne diese Verlusterfahrungen hätte ich meine
Lebensgeschichte kaum aufschreiben wollen. Und womöglich wäre ich ohne
sie überhaupt nie zum Schreiben gekommen, nicht Schriftsteller
geworden.
Leseprobe
Zum Autor
Reinhard Baumgart, 1929 in Breslau geboren, war
Lektor, Literaturwissenschaftler und Kritiker und lebte bis zu seinem
Tod 2003 in Berlin und München. Zahlreichen Publikationen, u.a.
"Deutsche Literatur der Gegenwart" (1994), "Addio
– Abschied von der Literatur"
(1995), "Liebesspuren"
(2000) und "Glück
und Scherben" (Erzählungen, 2002).
Verlagsinformation |
| |
|
|
|
Februar
2004 |
|
|
|
Christian Schulte/Brigitte
M. Mayer (Hrsg.): Der Text ist der Coyote:
Heiner-Müller-Bestandsaufnahme.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN:
3-518-12367-X. |
|

mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Heiner Müllers Werk ist voll gesogen mit Geschichte.
Einer barbarischen Geschichte allerdings, die sich als Wiederkehr des
immergleichen zu erkennen gibt. Noch jeder revolutionäre Eingriff
führte die Bedingungen, die überwunden werden sollten, nur unter
veränderten Vorzeichen fort. Es ist deshalb, so Müller, die Aufgabe
der Kunst, die Wirklichkeit unmöglich zu machen.
Das kann sie aber nur durch Subversion, indem sie sich mit der
stärksten unterdrückten Klasse, den Toten, verbündet, ihren Stimmen
Raum gibt und so der Utopie ihr Gedächtnis zurückerstattet. "Wie der
Apfel vom Baum der Erkenntnis noch einmal gegessen werden muss, damit
der Mensch in den Stand der Unschuld zurückfindet, muss der
Babylonische Turm neu gebaut werden, damit die Verwirrung der Sprachen
ein Ende hat. Die Befreiung der Toten findet in der Zeitlupe statt.
Zu den AutorInnen
19 Beiträge, allesamt von bekannten Müller-Forschern bzw. -Freunden,
fragen der Aktualität des Werkes von Heiner Müller im 21. Jahrhundert
nach.
Verlagsinformation |
| |
|
Martin L. Hofmann/Tobias
F. Korta/Sibylle Niekisch
(Hrsg.): Culture Club.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN:
3-518-29268-4. |
|

mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
"Kultur" ist zur
Zauberformel unserer Gegenwart geworden. Von Popkultur über
Unternehmenskultur bis zur Kultur des Krieges hat sich der Begriff in
die verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhänge eingeschlichen.
Für ein genaueres Verständnis der Bedeutung des Kulturbegriffs ist
allerdings eine Kenntnis seiner pluralen Traditionslinien von
entscheidender Bedeutung. Der vorliegende Band bietet eine
Orientierung durch einen Überblick in das Werk und Denken zentraler
Kulturtheoretiker von Freud, Simmel und Cassirer bis hin zu Luhmann,
Bourdieu, Butler und Latour.
Zu den HerausgeberInnen
Martin Ludwig Hofmann ist Soziologe und Journalist,
Tobias E. Korta Soziologe und Verwaltungsbeamter.
Sibylle Niekisch, geboren 1973,
studierte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Soziologie
und Ethnologie. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Medientheorie,
Populärkultur, Kultursoziologie, Ethnologie und Cultural Studies.
Verlagsinformation |
| |
|
|
|
Januar
2004 |
|
|
|
Helmut H. Diederichs (Hrsg.):
Geschichte der Filmtheorie:
Kunsttheoretische Texte von Melies bis Arnheim. Suhrkamp-Verlag
2004. ISBN: 3-518-29252-8. |
|

mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Kann Film Kunst sein? Und wenn Film die Potenz zur Kunst hat,
unter welchen Bedingungen wird Film zur Kunst? Was ist das Material
der Filmkunst, welches sind ihre künstlerischen Mittel?
Seit seinen aufsehen erregenden und höchst folgenreichen Anfängen ist
der Film Gegenstand theoretischer Überlegungen gewesen. Die
vorliegende Sammlung macht die zentralen Texte der Theoriegeschichte
des Films zugänglich und ordnet die Originaldokumente sowohl zeitlich
wie auch nach unterschiedlichen Themengebieten.
Dabei wird eine Entwicklung deutlich, die von der Frage nach der
Abbildung der Wirklichkeit über die Theorie der Schauspielkunst bis
hin zu Fragen des Schnitts und der Montage reicht. Ein ausführliches
Vorwort zeichnet die Zusammenhänge der unterschiedlichen Texte nach
und gibt weiterführende Informationen. Mit diesem Band liegt ein
umfassendes Kompendium der ersten fünfzig Jahre der Filmtheorie vor.
Zum Autor
Helmut H. Diederichs ist Professor für Medienpädagogik am
Fachbereich Soziales der Fachhochschule Dortmund.
Verlagsinformation |
| |
|
|
|
Januar
– Dezember
2003 |
|
|
|