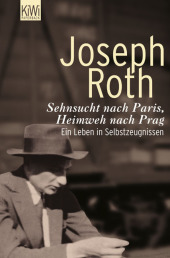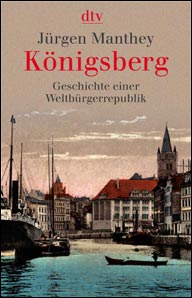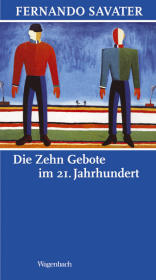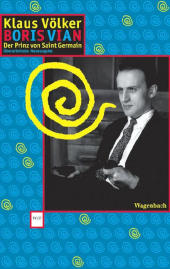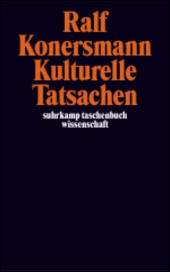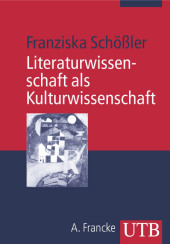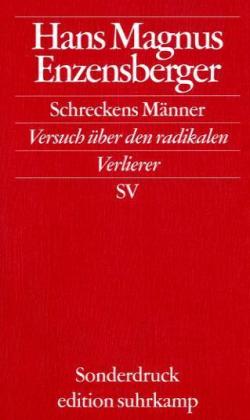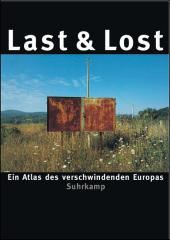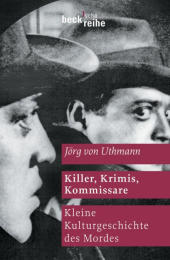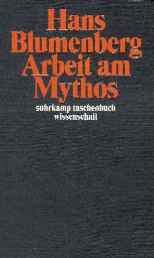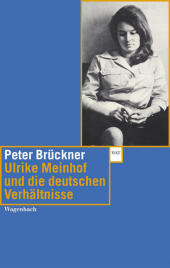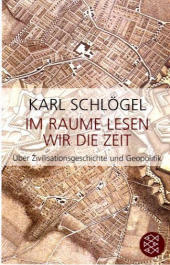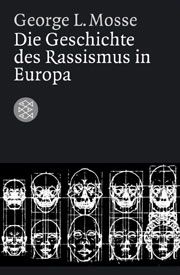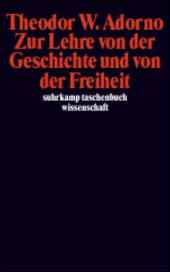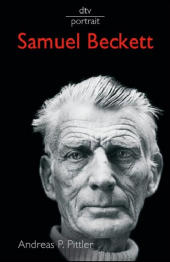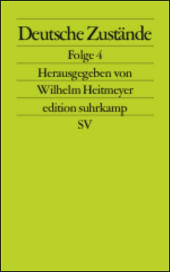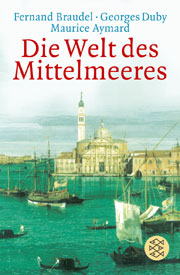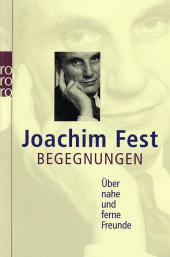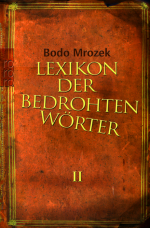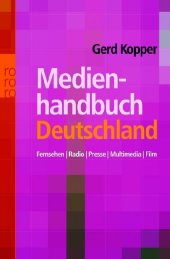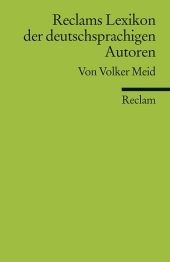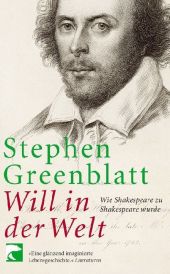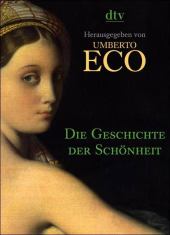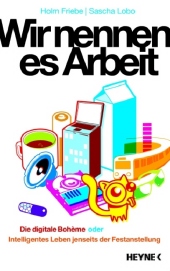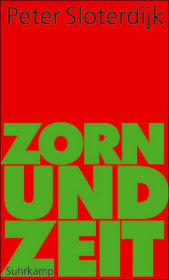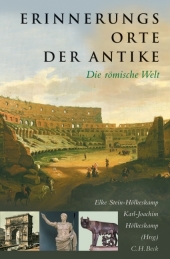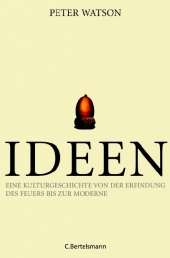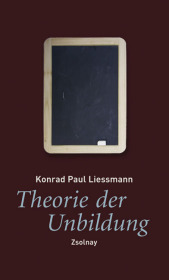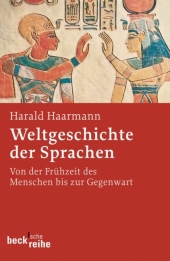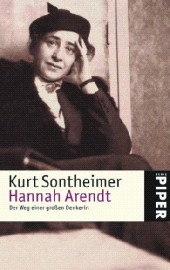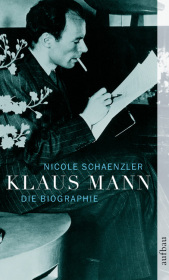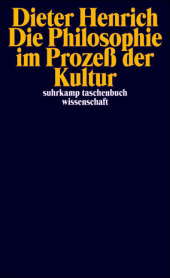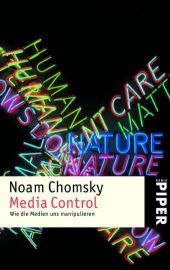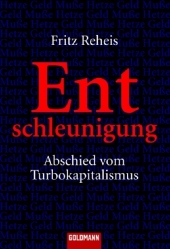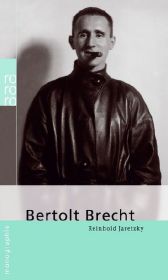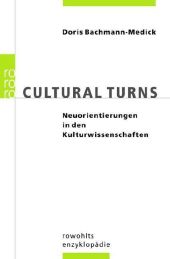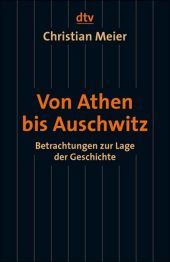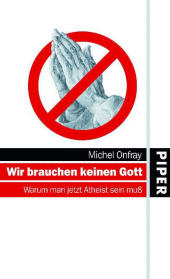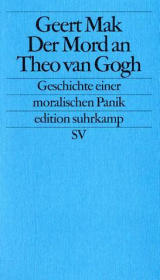|
Dezember
2006 |
|
|
|
Bodo Mrozek: Lexikon der
bedrohten Wörter, Bd. 2.
Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 978-3-499-62193-2. |
|
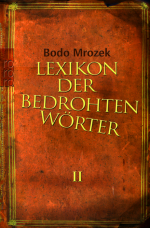
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Sie wissen nicht, was eine "Schütteltenne" ist? Ein Tanzlokal, in
dem "Schnitten" schon mal "inkommodiert" werden? Als Bodo Mrozek
zur Rettung bedrohter Wörter aufrief, erreichten ihn viele tausend
Zuschriften. Nun setzt er den Kampf gegen das Vergessen fort, mit
neuen unterhaltsamen Wortgeschichten.
In unserer Sprache sind Wörter lebendige Wesen. Sie kommen, sie
sind da, und manchmal verschwinden sie auch wieder. Sie erzählen
Geschichten, sie haben eine Geschichte. Im Idealfall, so hofft der
Wörtersammler, entsteht "so etwas wie eine kleine Geschichte des
Alltags oder des privaten Lebens". Fuchtel und Fidibus, Galoschen
und Gänsewein, Haderlump und Handeule, Kamarilla und Kaputnik,
Orlog und Oschek: Hier können Sie Ihren Wortschatz … nein, nicht
upgraden (gelbe Karte!), sondern kulturell ansprechend
weiterentwickeln.
Mrozeks Lexika durchzublättern ist ein wahres Vergnügen. Der
Berliner Journalist versteht es, sein Wissen um Etymologie und
Gefährdungen von Wörtern in klugen, amüsanten Miniaturen zu
präsentieren. Wer bei Jauch & Pilawa ordentlich absahnen will,
kommt an den beiden LBWs nicht vorbei. Dass der Anorak, der gute
alte Wetterschutz unserer Kindheit, der Eskimosprache entlehnt ist
(annoraacq, meist aus wärmendem Robbenfell), das hätte man
vielleicht ja noch erraten. Aber dass der Kummerbund aus dem Hindi
kommt (von kamarband, Hüftgürtel) – wer hätte da nicht den
Wett-K.o. riskiert?
Mausetot und vergessen, um mal eine traurige Verlustmeldung zu
lancieren, ist der gute alte Meuchelpuffer. Der barocke
Sprachpurist (und Fremdworthasser) Philip von Zesen (1619–1689)
hat ihn als Ersatz für das Fremdwort Pistole in die deutsche
Sprache hineinkatapultiert, wo es leider heute nicht mehr
anzutreffen ist. Schade eigentlich. "Es ist vorbei, und Sie wissen
Sie das. Mich interessiert nur noch eins: Wo haben Sie den
Meuchelpuffer versteckt?", das wäre doch ein großartiges
Derrick-Schlusswort, oder?
Zum Autor
Bodo Mrozek, geboren 1968, arbeitet als freier Journalist für
verschiedene Zeitungen, u. a. F.A.Z., Neue Zürcher Zeitung, taz,
Tagesspiegel.
Verlagsinformation
|
|
|
Gerd G. Kopper: Medienhandbuch Deutschland. Fernsehen,
Radio, Presse, Multimedia, Film. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006.
ISBN: 978-3-499-61938-0. |
|
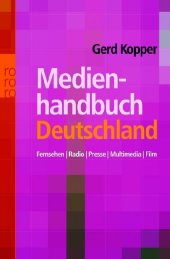
mehr Infos
bestellen
|
Sie prägen unser
Weltbild, beeinflussen unsere Politik und sind zur vierten Macht
im Staate avanciert, die Medien. Doch wie funktioniert unser
komplexes Mediensystem? Welches sind seine Hauptakteure, seine
Gesetze, wo liegen Konfliktpotenziale? Dieses fundierte Handbuch
verschafft einen umfassenden und leicht verständlichen Überblick.
Dieses Handbuch ist eine gut verständliche, knappe und präzise
Einführung in die Grundlagen des Systems der Massenmedien in
Deutschland. Die nahezu 400 Stichworte/Artikel werden in
Einführungsbeiträgen zu Politik, Wirtschaft und Recht der
Massenmedien sowie weiteren Schwerpunktbereichen wie Recherchen im
Internet sinnvoll vernetzt. Dadurch lässt sich dieses
Nachschlagewerk zugleich als allgemeine Einführung, als Lehrbuch
und als knappes Grundlagenwerk verwenden.
Verlagsinformation
|
|
|
Volker Meid: Reclams Lexikon der
deutschsprachigen Autoren.
2., aktualisierter und erweiterter Auflage. Reclam-Verlag,
Ditzingen 2006. ISBN: 978-3-15-017664-1. |
|
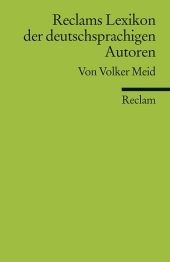
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Wer sich einen ersten knappen, zugleich fundierten Überblick über
Leben und Werk der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen und
Autoren verschaffen will, bekommt ihn hier in 900 Artikeln, die
lexikalische Konzentration mit Lesbarkeit verbinden. Auf eine
biographische Skizze folgt jeweils ein Überblick über das
literarische Werk.
Jeder Eintrag enthält außerdem ein Verzeichnis der Erstdrucke der
selbständigen Veröffentlichungen jedes Autors, sowie der
Werkausgaben. Für die Neuausgabe des Bandes in der
Universal-Bibliothek wurden ca. 20 Autoren neu aufgenommen und die
Einträge zu Gegenwartsautoren aktualisiert.
Zum Autor
Volker Meid, geboren 1940, lehrte von 1970 bis 1982 als Professor
für deutsche Literatur an der University of Massachusetts in
Amherst/USA. Seither arbeitet er als freier wissenschaftlicher
Schriftsteller; er ist Autor zahlreicher Studien und Monografien
zur Literatur der frühen Neuzeit.
Verlagsinformation
|
|
|
November
2006 |
|
|
|
Stephen Greenblatt: Will in der
Welt.
Wie Shakespeare zu Shakespeare wurde. Aus dem Amerikanischen von
Martin Pfeiffer. BVT Berliner Taschenbuch Verlag 2006. ISBN:
3-8333-0386-7. |
|
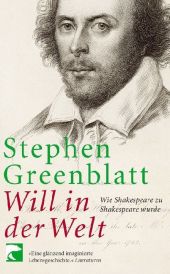
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Eine Lebensbeschreibung des berühmtesten Dichters der
abendländischen Literatur aus der Feder eines der besten
Shakespeare-Kenner der Gegenwart. Mit enormer Geschichtskenntnis
und großem Scharfsinn entwirft Stephen Greenblatt ein
überzeugendes Bild des großen Shakespeare in seiner Zeit.
Rezension
"Dies ist, endlich, das Buch, das Shakespeare verdient hat: ein
brillantes Buch, geschrieben von einem virtuellen Augenzeugen, der
versteht, wie ein Dramatiker den Stoff seines Lebens in Theater
verwandelt." (Charles Mee, Dramatiker)
Verlagsinformation
|
|
|
Umberto Eco (Hrsg.): Die Geschichte
der Schönheit.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-423-34369-9. |
|
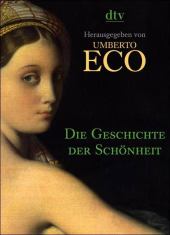
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was ist Schönheit? Umberto Eco erzählt in seinem großen, reich
illustrierten Buch, dass Schönheit nie etwas Absolutes und
Unveränderliches ist, sondern je nach Zeiten und Kulturen ganz
verschiedene Gesichter hat. Von der Antike bis zu den abstrakten
Formen der Gegenwartskunst, von Licht und Farbe im Mittelalter bis
zur Malerei der Romantik: ein umfassendes Kompendium über die
Kunst der Welt.
Zum Autor
Umberto Eco wurde 1932 in Alessandria geboren und lebt heute in
Mailand. Er studierte Pädagogik und Philosophie und promovierte
1954 an der Universität Turin. Anschließend arbeitete er beim
Italienischen Fernsehen und war als freier Dozent für Ästhetik und
visuelle Kommunikation in Turin, Mailand und Florenz tätig. Seit
1971 unterrichtet er Semiotik in Bologna. Eco erhielt neben
zahlreichen Auszeichnungen den Premio Strega (1981) und wurde 1988
zum Ehrendoktor der Pariser Sorbonne ernannt.
Er verfasste zahlreiche Schriften zur Theorie und Praxis der
Zeichen, der Literatur, der Kunst und nicht zuletzt der Ästhetik
des Mittelalters. Seine Romane 'Der Name der Rose' und 'Das
Foucaultsche Pendel' sind Welterfolge geworden.
Verlagsinformation
|
|
|
Holm Friebe/Sascha Lobo: Wir nennen
es Arbeit.
Die digitale Bohème oder: Intelligentes Leben jenseits der
Festanstellung. Heyne-Verlag 2006. ISBN: 3-453-12092-2. |
|
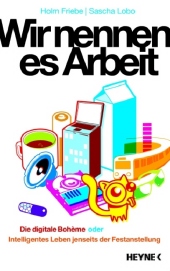
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Sie verzichten dankend auf einen Arbeitsvertrag und verwirklichen
den alten Traum vom selbstbestimmten Leben. Mittels neuer
Technologien kreieren sie ihre eigenen Projekte, Labels und
Betätigungsfelder. Das Internet ist für sie nicht nur Werkzeug und
Spielwiese, sondern Einkommens- und Lebensader: die digitale
Boheme. Ihre Ideen erreichen anders als bei der früheren Boheme
vor allem über das Web ein großes Publikum und finanzieren sich
damit. Ein zeitgemäßer Lebensstil, der sich zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor entwickelt.
Auf Angestellten-Frust kann man mit der Entdeckung der Faulheit
reagieren, wie es Corinne Maier in ihrem Bestseller fordert:
Arbeitszeit absitzen, sicheres Gehalt einstreichen. Die digitale
Boheme repräsentiert die mutigere Alternative: Immer mehr junge
Kreative entscheiden sich für das Leben in Freiheit. Ihr Hauptziel
ist nicht das Geldverdienen, sondern ein selbst bestimmter
Arbeitsstil, der den eigenen Motiven folgt in unsicheren Zeiten
vielleicht die überlegene Strategie. Denn ihre enge Einbindung in
soziale, künstlerische und digitale Netzwerke bringt ständig neue,
teilweise überraschende Erwerbsmöglichkeiten mit sich. Sie
schalten Werbebanner auf ihren Websites, handeln mit virtuellen
Immobilien, lassen sich Projekte sponsern oder verkaufen eine Idee
an einen Konzern. Ihre Produkte und ihre Arbeitsweise verändern
den Charakter der Medien und des Internets, bald auch den der
Gesellschaft.
Holm Friebe und Sascha Lobo porträtieren die digitale Boheme: Sie
stellen erfolgreiche Konzepte und innovative Ansätze vor und
erklären wirtschaftliche, technische und soziale Entwicklungen und
Hintergründe. Ihre spannende Analyse einer zukunftsgewandten
Daseinsform inspiriert dazu, so zu arbeiten, wie man leben will.
Rezension
"Das Buch 'Wir nennen es Arbeit' von Holm Friebe und Sascha Lobo
[...] berichtet von intelligenten Versuchen 'jenseits der
Festanstellung' zu leben. Die beeindruckenden Geschichten aus der
'digitalen Bohème' erzählen von neuen Formen der Arbeitswelt, von
denen, die weder ALG II noch ein festes Gehalt beziehen,
selbstbewusst und ideenreich darauf reagieren, dass es dramatisch
weniger feste Stellen gibt. [...] Als Bericht über die
Bloggerszene und die Welt der Computerspiele ist das Buch hoch
willkommen. Es enthält glänzende Beobachtungen." (Süddeutsche
Zeitung)
Verlagsinformation
|
|
|
Oktober 2006 |
|
|
|
Peter Sloterdijk: Zorn und
Zeit.
Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN:
3-518-41840-8. |
|
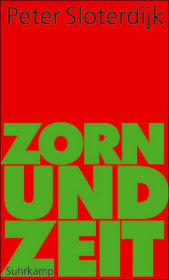
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Unverwechselbares Kennzeichen des Denkens und Schreibens von Peter
Sloterdijk ist die Einbettung aktuellster Fragen in ihre lange
Geschichte. Dadurch gelangt er zu Neubestimmungen der
gegenwärtigen "condition humaine", kann sie durch eine bisher
unbekannte Perspektive sichtbar machen und unerwartete oder
ungewollte Zusammenhänge nachweisen. In seinem neuen Essay geht er
auf den Zorn ein, dessen Folgen sich als Kampf, Gewalt, Aggression
äußern.
Am Anfang des ersten Satzes der europäischen Überlieferung, die
mit der Ilias beginnt, steht das Wort "Zorn". Er gilt dort als
unheilbringend – und wird deshalb hoch geschätzt, auch weil er
Helden hervorbringt. Wie kommt es, dass Zorn schon relativ bald
danach in der Polis nur in eng umgrenzten Situationen zugelassen
wird? Wie kommt es in späteren kulturellen Traditionen zur
Herausbildung des "heiligen Zorns" und damit zugleich eines ersten
Begriffs von Gerechtigkeit? Wie ist eine kommunistische Weltbank
des Zorns denkbar?
Wie kam es dazu, dass die Gesellschaften mit Gerechtigkeit als
Grundwert den Zorn in allen Kontexten ausgeschlossen haben? Und
wie ist seiner Wiederkehr zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu
begegnen? Peter Sloterdijk formuliert eine Antwort: "Große Politik
geschieht allein im Modus von Balanceübungen. Die Balance üben
heißt keinem notwendigen Kampf ausweichen, keinen überflüssigen
provozieren. Es heißt auch, den Wettlauf mit der Umweltzerstörung
und der allgemeinen Demoralisierung nicht verloren geben."
Zum Autor
Peter Sloterdijk, 1947 in Karlsruhe geboren, ist dort seit 1992
Professor für Philosophie und Medientheorie an der Hochschule für
Gestaltung und seit 2001deren Direktor. Seit 2002 leitet er
zusammen mit Rüdiger Safranski die ZDF-Sendung "Im Glashaus – Das
Philosophische Quartett". 1993 erhielt er den den
Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik, 2001 den
Christian-Kellerer-Preis für die Zukunft philosophischer Gedanken
und 2005 den Sigmund-Freud-Preis.
Verlagsinformation |
|
|
Elke
Stein-Hölkeskamp/Karl-Joachim Hölkeskamp (Hrsg.): Erinnerungsorte
der Antike.
Die römische Welt. C.H. Beck-Verlag 2006. ISBN: 3-406-54682-X. |
|
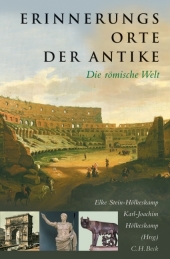
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Vom Lateinischen als Weltsprache bis zu Caesars Gallischem Krieg;
von Neros brennendem Rom bis zu den letzten Tagen von Pompeji, vom
Tod des Gladiators bis zur Christenverfolgung, von Augustus' Rom
aus Marmor bis zu Theodor Mommsens Römischer Geschichte: In
insgesamt 38 glänzend geschriebenen Beiträgen präsentieren
herausragende Autorinnen und Autoren die wichtigsten Erinnerungsorte der römischen Geschichte. Aus kleinsten dörflichen
Anfängen hervorgegangen, entwickelte sich die Stadt am Tiber zur
gewaltigen Metropole, ja, zur Herrin der antiken Welt.
So gewaltig Raum und Zeit römischer Herrschaft waren, so
einzigartig und wirkungsmächtig erscheint das kulturelle und
materielle Erbe, das Rom uns hinterlassen hat. Die Autorinnen und
Autoren der "Erinnerungsorte" laden ein, die wichtigsten Weg- und
Wendemarken der Geistes- und Religionsgeschichte, der Ereignis-
und Politikgeschichte, der Kultur- und Rechtsgeschichte und nicht
zuletzt der Archäologie des römischen Erdkreises kennen- und in
ihrer überzeitlichen Bedeutung verstehen zu lernen.
So ist ein Buch entstanden, das nichts mit nostalgischer
Beschwörung von Altbekanntem zu tun hat, sondern ein Buch der Neu-
und Wiederentdeckungen und vor allem ein überzeugendes Beispiel
lebendiger Erinnerungskultur, kurz: ein faszinierendes, spannend
zu lesendes Geschichts- und Geschichtenbuch zur römischen Antike.
Zu den HerausgeberInnen
PD Dr. Elke Stein-Hölkeskamp lehrt am Seminar für Alte Geschichte
der Universität Münster.
Professor Dr. Karl-Joachim Hölkeskamp hat den Lehrstuhl für Alte
Geschichte am Institut für Altertumskunde der Universität Köln
inne.
Verlagsinformation |
|
|
Peter Watson: Ideen.
Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur
Moderne. Bertelsmann-Verlag, München 2006. ISBN: 3-570-00626-3. |
|
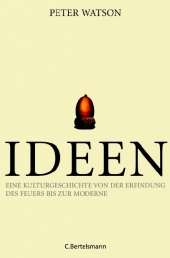
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Vom Abenteuer des Denkens, Entdeckens und Erfindens: Die große
Kulturgeschichte der Menschheit ist ein Leseschmöker und
Denkabenteuer, Fundgrube und Ideen-Kompendium. Peter Watson bietet
nach "Das Lächeln der Medusa" erneut Geistesgeschichte zum
Anfassen. Beginnt die Ideengeschichte der Menschheit, als die
Frühmenschen erstmals Feuer machen, vor ca. 1,8 Millionen Jahren?
Oder schon mit dem ersten Faustkeil vor etwa 2,5 Millionen Jahren?
Warum entwickelte sich vor 40.000 Jahren eine komplexe Sprache?
Wie kamen das Minus- und das Plus-Zeichen in die Vorstellungswelt,
und wie entstand das Bild vom Paradies?
Peter Watson lädt ein zu einer Expedition durch die abenteuerliche
Welt menschlicher Ideen. Vom ersten Feuer, dem ersten Werkzeug und
den ersten Worten über die Geburt der Götter, die ersten Gesetze
und die Entwicklung großer Zentren von Wissen und Weisheit bis hin
zu den umwälzenden Ideen der Moderne: das Größte und das Kleinste,
das Selbst-Bewusstsein des Individuums und die Entdeckung des
Unbewussten.
Dabei ordnet Watson die riesige Materialfülle nach drei zentralen
Ideen, die für ihn die Geschichte der Menschheit prägen: die
Seele, mehr als die Idee von einem Gott; Europa, mehr als das
Gebiet auf der Landkarte; und das Experiment als Motor aller
Entwicklung. Wie schon in seinem erfolgreichen Standardwerk "Das
Lächeln der Medusa" über die Ideen des 20. Jahrhunderts gelingt es
dem begnadeten Wissensvermittler, den Leser in den Kosmos des
Denkens und Erfindens zu locken.
Voller Staunen verfolgt man das Auftauchen und Verschwinden von
Ideen, Denkern und Kulturen, erkennt ungeahnte Zusammenhänge und
sieht schließlich die eigene Welt als Produkt eines gewaltigen
Prozesses aus Mut, Erfindungsgeist und Erkenntnislust.
Zum Autor
Peter Watson, geboren 1943, studierte an den Universitäten von
Durham, London und Rom. Er war stellvertretender Herausgeber von
"New Science", arbeitete vier Jahre lang für die "Sunday
Times", war Korrespondent in New York für die "Times" und
schrieb für den "Observer", die "New York Times", "Punch" und "Spectator".
Watson hat bisher dreizehn Bücher veröffentlicht und war an einigen
TV-Produktion zum Thema Kunst beteiligt. Seit 1989 ist er als
Lehrbeauftragter am McDonald Institute for Archaeological Research
der Universität Cambridge tätig.
Verlagsinformation |
|
|
Konrad P. Liessmann: Theorie der
Unbildung.
Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Zsolnay-Verlag 2006. ISBN:
3-552-05382-4. |
|
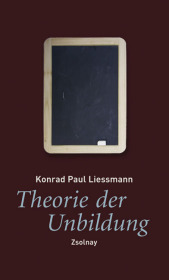
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was weiß die Wissensgesellschaft? Wer wird Millionär? Wirklich
derjenige, der am meisten weiß? Wissen und Bildung sind, so heißt
es, die wichtigsten Ressourcen des rohstoffarmen Europa. Debatten
um mangelnde Qualität von Schulen und Studienbedingungen –
Stichwort Pisa! – haben dennoch heute die Titelseiten erobert. In
seinem hochaktuellen Buch entlarvt der Wiener Philosoph Konrad
Paul Liessmann vieles, was unter dem Titel Wissensgesellschaft
propagiert wird, als rhetorische Geste: Weniger um die Idee von
Bildung gehe es dabei, als um handfeste politische und ökonomische
Interessen. Eine fesselnde Streitschrift wider den Ungeist der
Zeit.
Leseprobe
Wer wird Millionär – oder: Alles, was man wissen muss
Die in Deutschland von einem Privatsender ausgestrahlte Quizshow
"Wer wird Millionär", die in Österreich unter dem Titel
"Millionenshow" vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet
wird, gehört seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten
Formaten dieser Art. Neben dem Erfolg von Dietrich Schwanitz’
Sachbuch-Bestseller "Bildung. Alles, was man wissen muss" und den
Harry-Potter-Romanen von Joanne K. Rowling gehören diese Shows für
viele Kulturoptimisten zu jenen Indizien, die zeigen, dass die
Bildungs- und Leselust der Menschen ungebrochen ist.
Dass sich immer wieder und immer noch Menschen finden, die sich –
durch das Studium von Lexika und einschlägigen Handbüchern mehr
oder weniger gut vorbereitet – vor einem Millionenpublikum einem
Wissenstest stellen, ist in der Tat bemerkenswert. Verantwortlich
dafür mag nicht nur die Aussicht auf den Gewinn sein, auch nicht
nur die Simulation einer Prüfungssituation, deren Beobachtung
immer schon mit beträchtlichem Lustgewinn verbunden war, sondern
auch die Sache selbst, um die es geht: das Wissen. Genau in diesem
Punkt demonstriert diese Show, kulturindustrielles Produkt par
excellence, einiges davon, wie es um das Wissen in der
Wissensgesellschaft bestellt ist.
Die Konstruktion der Show ist denkbar einfach. Einem Kandidaten,
der es nach verschiedenen Vorauswahlverfahren bis ins Zentrum des
Geschehens geschafft hat, werden bis zu fünfzehn Fragen gestellt,
deren Schwierigkeitsgrad mit dem für die richtigen Antworten
ausgesetzten Preisgeld steigt. Im Gegensatz zur herrschenden
Ideologie der Vernetzung wird in dieser Show einzig nach einem
punktuellen Wissen gefragt. Die aus Multiple-Choice-Verfahren
bekannten vorgegebenen Antworten, aus denen eine auszuwählen ist,
ermöglichen nicht nur eine rasche und unmittelbare Reaktion,
sondern zeigen auch in nuce, wo die Grenzen zwischen Raten,
Vermuten, Wissen und Bildung verlaufen.
Dort, wo Kandidaten ihre Wahl mit Formeln wie "Das kommt mir
bekannt vor" oder "Davon habe ich schon einmal gehört" begründen,
triumphiert das Bekannte über das Gewusste, dort, wo mit
Wahrscheinlichem oder Plausibilitäten gearbeitet wird, regieren
Ahnungen und dunkle Erinnerungen, und wenn jemand tatsächlich
etwas weiß, wird als Begründung für die Wahl der Antwort dann auch
folgerichtig gesagt: Das weiß ich.
Ein Hauch von Bildung schleicht sich schließlich dann ein, wenn es
einem Kandidaten gelingt, aufgrund seiner Kenntnisse etwa des
Lateinischen oder gar Griechischen die Bedeutung von ihm an sich
nicht geläufigen Fachausdrücken zu erschließen. Die Show, und das
mag ihre Attraktivität mit bedingen, simuliert so Bewegungen im
Wissensraum, die jeder kennt und nachvollziehen kann: Nur sehr
wenig haben wir verstanden, einiges wissen wir, manches kann
vermutet werden, das meiste ist uns aber nicht geläufig und kann
höchstens erraten werden.
Zum Autor
Konrad Paul Liessmann, geboren 1953 in Villach, studierte
Germanistik, Geschichte und Philosophie in Wien. Er arbeitet als
Professor (am Institut für Philosophie der Universität Wien),
Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Liessmann
veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und Essays
aus den Bereichen der Ästhetik, Kunst- und Kulturphilosophie,
Gesellschafts- und Medientheorie, Technikphilosophie sowie der
Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts.
Verlagsinformation |
|
|
Harald Haarmann:
Weltgeschichte der Sprachen.
Von der Frühzeit des Menschen bis zur Gegenwart. C.H. Beck-Verlag
2006. ISBN: 3-406-55120-3. |
|
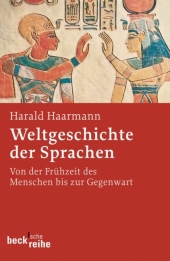
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Harald Haarmann legt hier erstmals eine moderne
Universalgeschichte der Sprachen vor. Er beschreibt, was wir über
die Sprachfähigkeit der frühesten Menschen wissen, in welchen
Stufen sich die komplexe Sprache des Homo sapiens entwickelte und
wie die vergleichende Sprachforschung das Nostratische als älteste
bekannte Sprachfamilie rekonstruiert hat. Haarmann versteht es
meisterhaft, seinen Lesern die oft verschlungenen Wege der
Herausbildung von Sprachfamilien, der Transformation und
Aufgliederung alter und der Entstehung neuer Sprachen zu
vermitteln. Ein Ausblick auf gegenwärtige Entwicklungen rundet den
Band ab.
Zum Autor
Harald Haarmann, Dr. phil. habil., geboren 1946, studierte
Allgemeine Sprachwissenschaft und verschiedene philologische
Einzeldisziplinen an den Universitäten Hamburg, Bonn, Coimbra
(Portugal) und Bangor (Wales). Er lehrte und forschte an
diversen deutschen und japanischen Universitäten. Er ist
Mitglied im Forscherteam des Research Centre on Multilingualism
(Brüssel). Für seine Arbeit erhielt er diverse Preise: Prix logos
(1999) der Association européenne des linguistes et des
professeurs de langues (Paris) und den Premio Jean Monnet (1999)
im Bereich Essayliteratur. Harald Haarmann lebt und arbeitet in
Finnland.
Verlagsinformation
|
|
|
Thomas Wild: Hannah Arendt.
Leben, Werk, Wirkung. Suhrkamp-Basisbiographien Bd.17.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-18217-X. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Ein spannendes Leben, ein beeindruckendes Werk, eine bleibende
Wirkung – in drei Teilen und im überschaubaren Umfang von 160
Seiten erzählen die Suhrkamp-Basisbiographien von Leben, Werk und
Wirkung großer Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Ein Konzept,
das überzeugt: Bei Hoffmann und Campe erscheinen sie ab dem
Frühjahr 2006 als Hörbuchreihe.
Zum Autor
Thomas Wild
promovierte über die Wirkung von Person und Werk Hannah
Arendts auf das literarisch-intellektuelle Feld der Bundesrepublik
seit den sechziger Jahren.
Verlagsinformation
|
|
|
Kurt Sontheimer: Hannah
Arendt. Der Weg einer großen Denkerin. Piper-Verlag 2006.
ISBN: 3-492-24824-1. |
|
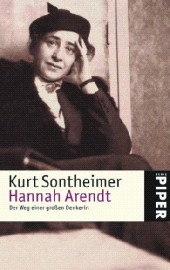
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Hannah Arendt (1906-1975) ist in ihrem Denken unglaublich aktuell
geblieben. Kurt Sontheimer, dem bedeutenden
Politikwissenschaftler, gelingt es in seinem letzten Buch, die
Leser auf die deutsch-jüdische Denkerin und ihre außergewöhnliche
Lebensgeschichte neugierig zu machen und zugleich eine
verständliche Leseanleitung für ihre Bücher zu geben. Denn ob sie
über Totalitarismus, Revolution, das "tätige Leben" oder Adolf
Eichmann und die Banalität des Bösen geschrieben hat – die
Auseinandersetzung mit Arendts unabhängigem Denken ist immer
lohnend.
Rezension
"Eine klügere und zugleich wärmere Einführung lässt sich kaum
denken." (Süddeutsche Zeitung)
Zum Autor
Kurt Sontheimer (1928-2005) war von 1969 bis 1993 Professor für
Politische Wissenschaft an der Universität München.
Verlagsinformation
|
|
|
Nicole Schaenzler: Klaus Mann.
Eine Biographie. Aufbau-Taschenbuch-Verlag 2006 (2. Auflage).
ISBN: 3-7466-1749-9. |
|
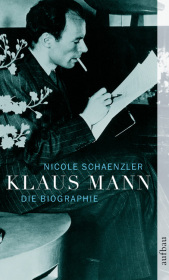
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
In dieser bislang umfangreichsten Klaus-Mann-Biographie beschreibt
Nicole Schaenzler den schwierigen Lebensweg einer facettenreichen
Künstlerpersönlichkeit. Klaus Mann, 1906 als zweites Kind von
Thomas und Katia Mann geboren, stand dank seiner ungewöhnlichen
schriftstellerischen Begabung schon früh im Rampenlicht. Doch
hinter dem eloquenten und selbstsicheren jungen Mann, als der er
sich in der Öffentlichkeit präsentierte, verbarg sich ein
unsteter, von tiefen Selbstzweifeln geplagter Charakter.
Nicole Schaenzler untersucht die Hintergründe eines Lebens, das
nie zum Glück finden konnte. Ihr fesselndes Buch stellt sowohl das
literarische Schaffen als auch das politische Engagement und die
zahlreichen, meist von starken Ambivalenzen geprägten persönlichen
Beziehungen des Autors ausführlich dar. Der Schatten des
übermächtigen Vaters und der frühe Ruhm begründeten die nervöse
Unrast Klaus Manns, die ihn von Ort zu Ort, von Hotelzimmer zu
Hotelzimmer trieb. Seine Vorliebe für Grenzerfahrungen, seine
Todessehnsucht und seine Homosexualität machten ihn zum
tragischen, heimatlosen Außenseiter.
Leseprobe
Zur Autorin
Dr. Nicole Schaenzler arbeitet seit über 10 Jahren als
Medizinjournalistin und hat als Fachautorin zahlreiche
erfolgreiche Bücher zu medizinischen und
ernährungswissenschaftlichen Themen verfasst. Sie ist
Herausgeberin eines Gesundheitsmagazins und lebt in München.
Verlagsinformation
|
|
|
September
2006 |
|
|
|
Martin L. Hofmann/Tobias F.
Korta/Sibylle Niekisch (Hrsg.): Culture Club, Bd.2:
Klassiker der Kulturtheorie. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN:
3-518-29398-2. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was heißt "Kultur"? Kaum ein anderer Begriff durchzieht die
theoretische Debatte der letzten Jahrzehnte mit solch einer Wucht.
Kulturtheorie ist nicht nur zu einem interdisziplinären, sondern
auch zu einem internationalen intellektuellen Abenteuer geworden.
Auch der zweite Band des Culture Club bietet eine Orientierung in
diesem schwer überschaubaren Feld, indem er einen Überblick über
das jeweilige Werk und Denken zentraler Kulturtheoretiker gibt.
Vorgestellt werden Max Weber, Siegfried Kracauer, Martin
Heidegger, Helmuth Plessner, Margaret Mead, Hannah Arendt,
Marshall McLuhan, Richard Hoggart, Vilem Flusser, Raymond
Williams, Paul Feyerabend, Jean-François Lyotard, Ivan Illich,
Clifford Geertz, Jacques Derrida und Stuart Hall.
Zur Herausgeberin
Sibylle Niekisch, geboren 1973, studierte an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Soziologie und
Ethnologie. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Medientheorie,
Populärkultur, Kultursoziologie, Ethnologie und Cultural Studies.
Verlagsinformation
|
|
|
Dieter Henrich: Philosophie im
Prozess der Kultur.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-29412-1. |
|
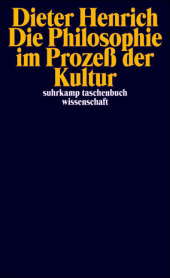
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was heißt "Kultur"? Kaum ein anderer Begriff durchzieht die
theoretische Debatte der letzten Jahrzehnte mit solch einer Wucht.
Kulturtheorie ist nicht nur zu einem interdisziplinären, sondern
auch zu einem internationalen intellektuellen Abenteuer geworden.
Auch der zweite Band des Culture Club bietet eine Orientierung in
diesem schwer überschaubaren Feld, indem er einen Überblick über
das jeweilige Werk und Denken zentraler Kulturtheoretiker gibt.
Vorgestellt werden Max Weber, Siegfried Kracauer, Martin
Heidegger, Helmuth Plessner, Margaret Mead, Hannah Arendt,
Marshall McLuhan, Richard Hoggart, Vilém Flusser, Raymond
Williams, Paul Feyerabend, Jean-François Lyotard, Ivan Illich,
Clifford Geertz, Jacques Derrida und Stuart Hall.
Zum Autor
Dieter Henrich ist Professor emer. für Philosophie. Im Suhrkamp
Verlag ist u. a. erschienen: Grundlegung aus dem Ich (2004). Im
Jahr 2006 erhielt er den "Deutschen Sprachpreis".
Verlagsinformation
|
|
|
August 2006 |
|
|
|
Noam Chomsky: Media Control.
Wie die Medien uns manipulieren. Piper-Verlag 2006. ISBN:
3-492-24653-2. |
|
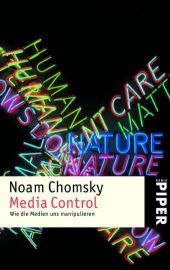
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Nicht erst im Irakkrieg spielten die US-Massenmedien eine fatale
Rolle als Propagandainstrumente der Außenpolitik. Noam Chomsky,
einer der wichtigsten Querdenker der USA, wirft den Medien vor,
unbequeme Tatsachen bereitwillig zu verschleiern und die
Verbrechen des "Feindes" wie mit der Lupe zu betrachten.
Obwohl sie keiner direkten staatlichen Kontrolle unterliegen,
verstehen sich die Massenmedien in den USA nicht als kritische
Gegner, sondern als Partner der Regierung und ihrer hegemonialen
Ziele. "Fern von jeder abgehobenen Medienphilosophie begibt sich
Noam Chomsky auch in die Untiefen der Auseinandersetzung mit den
konkreten Inhalten von politischem Journalismus." (Frankfurter
Rundschau)
Zum Autor
Noam Chomsky, geboren am 7. Dezember 1928, ist seit 1961 als
Professor am Massachusetts Institute of Technology, MIT, tätig;
seine Bücher über Linguistik, Philosophie und Politik erschienen
in allen wichtigen Sprachen der Erde. Noam Chomsky hat seit den
sechziger Jahren unsere Vorstellungen über Sprache und Denken
revolutioniert. Zugleich ist er einer der schärfsten Kritiker der
gegenwärtigen Weltordnung und des US-Imperialismus.
Verlagsinformation
|
|
|
Jan Knopf: Bertolt Brecht.
Leben, Werk, Wirkung. Suhrkamp-Basisbiographien Bd. 16.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-18216-1. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Ein spannendes Leben, ein beeindruckendes Werk, eine bleibende
Wirkung – in drei Teilen und im überschaubaren Umfang von 160
Seiten erzählen die Suhrkamp-Basisbiographien von Leben, Werk und
Wirkung großer Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Ein Konzept,
das überzeugt: Bei Hoffmann und Campe erscheinen sie ab dem
Frühjahr 2006 als Hörbuchreihe.
Die Brecht-Biographie Jan Knopfs erscheint zeitgleich auf
koreanisch. Aktuelle Veranstaltungen und Informationen auf der
Seite der Arbeitsstelle Bertolt Brecht am Institut für
Literaturwissenschaft der Universität Karlsruhe.
Zum Autor
Jan Knopf studierte Deutsche Philologie, Philosophie und
Geschichte in Göttingen. 1972 promovierte er zum Dr. phil., 1977
erfolgte die Habilitation. Seit
1984 ist er Professor für Literaturwissenschaft an der Universität
Karlsruhe und seit 1989 Leiter der "Arbeitsstelle Bertolt Brecht"
(ABB) am Institut für Literaturwissenschaft der Universität
Karlsruhe.
Verlagsinformation
|
|
|
Juli
2006 |
|
|
|
Fritz Reheis: Entschleunigung.
Abschied vom Turbokapitalismus. Goldmann-Verlag 2006. ISBN:
3-442-15380-8. |
|
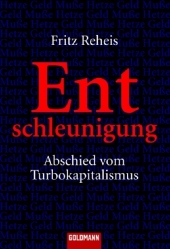
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
"Entschleunigung" verbindet fundierte Analyse mit pragmatischen
Vorschlägen, wie wir persönlich Zeitqualität zurückgewinnen und
dem Turbokapitalismus Paroli bieten können.
Ist unsere Hochgeschwindigkeitsgesellschaft zukunftsfähig? Der
freie Markt und im Besonderen die Dynamik des zinsgetriebenen
Geldes führen viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens in
"Beschleunigungsfallen", Punkte, an denen die Steigerung des
Tempos umschlägt in Zerstörung und Destruktion. Reheis zeigt
Möglichkeiten auf, aus dieser unheilvollen Dynamik auszubrechen
und unsere Gesellschaft zu entschleunigen.
"Gott schuf die Zeit. Von Eile hat er nichts gesagt." (Inschrift
über dem Eingang einer Tiroler Almhütte)
Rezension
Zu Reheis' Buch "Die Kreativität der Langsamkeit": "Als einer der
ersten hat Reheis umfassend den aktuellen Stand der Diskussion zur
'Ökologie der Zeit' zusammengefasst und mit realen Alternativen
verbunden." (Frankfurter Rundschau)
Zum Autor
Fritz Reheis, geboren 1949, studierte Deutsch, Geschichte,
Sozialkunde und Pädagogik. Promotion in Soziologie und
Absolvierung eines Erweiterungsstudiums in Philosophie für das
Lehramt an Gymnasien. Seit 1983 Gymnasiallehrer in Neustadt bei
Coburg. Zusätzlich nebenamtlich tätig als Lehrbeauftragter für
Politik, Zeitgeschichte, Soziologie und Pädagogik an mehreren
Hochschulen.
Verlagsinformation
|
|
|
Reinhold Jaretzky: Bertolt
Brecht.
Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-499-50692-0. |
|
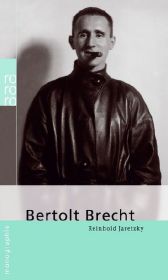
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Fünfzig Jahre nach Brechts Tod ist es an der Zeit, Leben und Werk
dieses Autors neu zu betrachten. Dabei kommt Reinhold Jaretzky zu
überraschenden Ergebnissen. Der vermeintlich angestaubte Klassiker
fasziniert zwar weiterhin als Autor einer unverwüstlichen
Dramatik. Ins Blickfeld rücken aber verstärkt der Antibürger
Brecht, der sprachgewaltige Lyriker und der fast unbekannte
radikaldemokratische Medientheoretiker.
Inhaltsverzeichnis
- "Mein Name ist eine Marke"
- Kindheit und Jugend eines Sonderlings
- Revolution und frühes Erwachsensein
- Die frühen Dramen: "Baal" und "Trommeln"
- Zwischen München und Berlin
- Metropole Berlin
- Frühe Lyrik
- Von "Mann ist Mann" bis zur "Dreigroschenoper"
- "Mahagonny" und private Turbulenzen
- Experimente und neue Medien
- "Die heilige Johanna" und "Die Mutter"
- Der Weg ins Exil: Von Prag nach Skovsbostrand
- Lyrik des Exils
- Das Problem der Form
- Flucht durch Skandinavien
- Stalin
- Die großen Dramen des Exils
- Amerika
- Rückkehr nach Europa
- Das Berliner Ensemble
- Letzte Werke
- Brechthausse und Brechtbaisse
- Anmerkungen
- Zeittafel
- Zeugnisse
- Bibliographie
- Namenregister
- Über den Autor
- Danksagung
- Quellennachweis der Abbildungen
Verlagsinformation
|
|
|
Doris Bachmann-Medick:
Cultural Turns.
Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften.
Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-499-55675-8. |
|
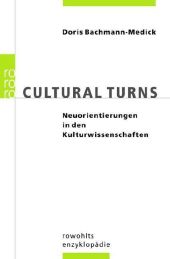
mehr Infos
bestellen
|
Die gegenwärtigen
Kulturwissenschaften bilden eine ausgeprägte Theorie- und
Forschungslandschaft. Ihre Dynamik entspringt vor allem dem
Spannungsfeld wechselnder "cultural turns" quer durch die
Disziplinen:
interpretive turn,
performative turn,
reflexive turn/literary turn,
postcolonial turn,
translational turn,
spatial turn,
iconic turn.
Der Band stellt diese "Wenden" in ihren systematischen
Fragestellungen, Erkenntnisumbrüchen sowie Wechselbeziehungen vor
und zeigt ihre Anwendung in konkreten Forschungsfeldern. Damit
wird eine "Kartierung" der neueren Kulturwissenschaften geleistet
und zugleich ein umfassender Überblick über ihre Entwicklungen und
Ausrichtungen geboten – mit einer Fülle verarbeiteter
internationaler Forschungsliteratur.
Verlagsinformation
|
|
|
Christian Meier: Von Athen bis
Auschwitz.
Betrachtungen zur Lage der Geschichte. Durchgesehene Ausgabe.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-423-34323-0. |
|
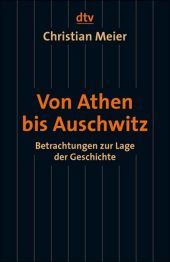
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Christian Meier gehört zu den wenigen deutschen Historikern, die
sich über den engeren Rahmen ihres Fachgebiets hinaus einen Blick
für das Ganze der Geschichte bewahrt haben. "Wir können nicht
zurück, sondern nur nach vorn, und dahin sollten wir unseren Weg
suchen; wobei freilich nicht alles Frühere schon überholt,
geschweige denn uninteressant ist": In seinem neuen Buch wagt
Meier eine Bilanz der europäischen Geschichte an der Wende zum 21.
Jahrhundert.
Wie können wir den Weg Europas von Athen bis Auschwitz verstehen?
Was bedeutet die Geschichte Europas für uns, und was vermögen wir
in ihr? Welche besondere Verantwortung haben wir als Zeitgenossen
innerhalb historischer Prozesse? Der Autor zieht in diesem Buch
die Bilanz der europäischen Geschichte von der Antike bis zum
Beginn des 21. Jahrhunderts.
Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Beziehung unsere
heutigen Gesellschaften überhaupt noch zu dem historischen Erbe
von drei Jahrtausenden herstellen können – und auch müssen, um für
die Zukunft gerüstet zu sein. Meiers neuestes Werk stellt die
geschichtsphilosophische Summe eines großen Historikers dar.
Rezensionen
"Umsicht, Tiefenschärfe, Aufklärung" (Neue Zürcher Zeitung)
"Das Buch ist in hohem Maße beeindruckend und diskussionswürdig."
(Frankfurter Rundschau)
Zum Autor
Christian Meier, einer der bekanntesten Historiker Deutschlands,
wurde 1929 in Stolp in Pommern geboren. Er habilitierte sich in
Frankfurt und lehrt – nach Stationen in Freiburg i.Br., Basel,
Köln und Bochum – in München Alte Geschichte. Er trat mit einer
Reihe von Publikationen an die Öffentlichkeit, darunter: Res
Publica Amissa (1966, 2. Auflage 1980); Entstehung des Begriffs
Demokratie (1970); Die Entstehung des Politischen (1980);
Politik und Anmut (1985); Athen. Ein Neubeginn der
Weltgeschichte (1993). 2003 erhielt er den Jacob-Grimm-Preis.
Verlagsinformation
|
|
|
Juni 2006 |
|
|
|
Joseph Roth: Sehnsucht nach Paris,
Heimweh nach Prag. Ein Leben in Selbstzeugnissen. Originalausgabe.
Herausgegeben und Nachwort von Helmut Peschina. KiWi Paperback.
Kiepenheuer & Witsch-Verlag 2006. ISBN: 3-462-03632-7. |
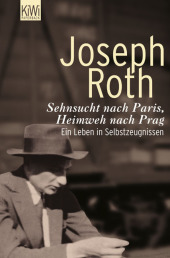
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Aus eigenen Briefen, Feuilletons und ausgewählten Prosaarbeiten,
die Joseph Roths Empfindungen und Eindrücke von Menschen,
Situationen und politischen Verhältnissen beschreiben, entsteht
ein Mosaik der Stationen seines Lebens. "Ich habe keine Heimat,
wenn ich von der Tatsache absehe, dass ich in mir selbst zu Hause
bin." Dieser Satz Joseph Roths charakterisiert ihn wie kaum ein
anderer als das, was er Zeit seines Lebens war: ein Getriebener.
1913 kommt der Neunzehnjährige aus Lemberg in Galizien zum Studium
nach Wien. 1939 stirbt Joseph Roth im Pariser Exil. Dazwischen
liegt ein rast- und ruheloses Leben als Dichter, Schriftsteller
und Journalist, das ihn von Wien über Berlin, wo seine ersten
Romane erscheinen ("Hotel Savoy", 1924), und Russland schließlich
in die französische Hauptstadt führt. Hier entsteht zwischen 1933
und 1939 fast die Hälfte seines literarischen Werks, so z. B. "Die
Beichte eines Mörders" oder "Die Kapuzinergruft".
In seinen Feuilletons, die er seit 1919 regelmäßig schreibt und in
verschiedenen Zeitungen veröffentlicht, ist Roth immer aktiver,
engagierter Chronist seiner Zeit. Unermüdlich und mit ungeheurer
Schärfe und Brillanz schreibt er an gegen Staatswillkür und seit
1933 gegen den Nationalsozialismus. In seinen Briefen, u. a. an
Benno Reifenberg, Rene Schickele, Stefan Zweig, erkennt man den
privaten, glücklos Kämpfenden als Opfer der Zeitläufte – und
seiner selbst.
Zum Autor
Joseph Roth, 1894 in Galizien als Sohn jüdischer Eltern geboren,
studierte Literaturwissenschaften in Wien und Lemberg. Teilnahme
am Ersten Weltkrieg. Ab 1918 Journalist in Wien, dann Berlin,
1923-1932 Korrespondent der Frankfurter Zeitung. 1933 Emigration
nach Frankreich. Starb 1939 im Alter von nur 45 Jahren in Paris.
Verlagsinformation |
|
|
Jürgen Manthey: Königsberg.
Geschichte einer Weltbürgerrepublik. 13 Abbildungen auf Tafeln.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-423-34318-4. |
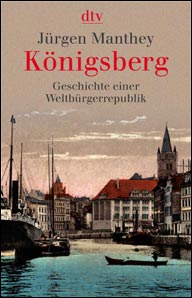
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Vor 750 Jahren wurde Königsberg gegründet, vor 60 Jahren
verschwand es von der Landkarte: Mit dem Untergang Königsbergs in
den letzten Wochen des 2. Weltkriegs fiel jene Stadt in Schutt und
Asche, in der die moderne Philosophie, die moderne Literatur und
die moderne Politik Deutschlands erfunden wurden. Königsberg ist
für immer ausgelöscht, doch die Ideen Kants, Herders, Kleists,
E.T.A. Hoffmanns, Hannah Arendts und vieler anderer Bürger dieser
großartigen Stadt leben weiter. Ein epochales Buch, das Königsberg
in unsere Gegenwart zurückholt.
Königsberg war anders als andere Städte: seine Bürger erkämpften
sich größere Freiheit und Unabhängigkeit, und seine Lage am
äußersten Rand des Deutschen Reiches förderte Weltoffenheit und
Neugierde. Jürgen Manthey beschwört diesen Königsberger Geist, den
Immanuel Kant selbst für eine der Voraussetzungen seiner
Philosophie hielt. Aber mit Kant, dem berühmtesten Königsberger,
ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende: Herder, Kleist und
E.T.A. Hoffmann verbrachten entscheidende Jahre in Königsberg. Von
hier gingen die Freiheitskriege und die großen preußischen
Reformen des 19. Jahrhunderts aus, hier erwachte im 20.
Jahrhundert bei der jungen Hannah Arendt die politische
Leidenschaft.
Rezensionen
"Mantheys einlässliche Darstellung verschafft dem Leser das
Vergnügen, die Geister, deren Schriften er bislang nur getrennt
wahrgenommen hatte, im Leben dicht nebeneinander zu wissen." (Süddeutsche
Zeitung)
"Es ist ein großartiges Buch, im architektonischen Gesamtentwurf
genauso fundiert wie in den sorgfältigen und reichhaltigen
Detaildeutungen." (DIE ZEIT)
"Ein kluger, erzählfreudiger, königsbergtreuer Begleiter durch die
öden, grauen, armseligen Straßen Kaliningrads." (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
"Ich habe darunter gelitten, dass ich als Kind und Jugendlicher
Königsberg nicht kennen gelernt habe, aber jetzt, dank Jürgen
Manthey, bin ich sicher, dort heimisch zu werden." (Günter
Grass)
Verlagsinformation |
|
|
Mai 2006 |
|
|
|
Fernando Savater: Die Zehn
Gebote im 21. Jahrhundert. Tradition und Aktualität von Moses'
Erbe. Wagenbach-Verlag 2006. ISBN: 3-8031-3619-9. |
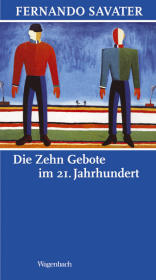
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der berühmteste lebende Philosoph Spaniens, Fernando Savater,
überprüft in einem leicht verständlich geschriebenen, humorvollen
und kenntnisreichen Essay jedes einzelne der Zehn Gebote. Haben
die Zehn Gebote trotz der radikalen Veränderungen des Lebens und
der Gewohnheiten in der westlichen Gesellschaft noch einen
moralischen Wert?
Jedem Gebot wird ein Kapitel gewidmet, das der Autor jeweils mit
einer humorvollen direkten Anrede an Gott beginnt. Er fragt nach
der Bedeutung der christlichen Feiertage angesichts der großen
Arbeitslosigkeit, denkt mit feiner Ironie über das Töten und den
Irakkrieg, über den einzigen Gott und über das Verbot nach, die
Frau des Nächsten zu begehren.
Rezension
"Wie immer besticht der Philosoph Fernando Savater auch in den
Zehn Geboten durch seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte
verständlich auszudrücken." (ABC, Madrid)
Zum Autor
Fernando Savater, geboren 1947 in San Sebastián, ist eine der
herausragenden Persönlichkeiten der kulturellen und politischen
Öffentlichkeit Spaniens. Er studierte und lehrte Philosophie in
Madrid, musste aber aus politischen Gründen die Universität
verlassen. Als Baske ist er aktiv um eine Vermittlung zwischen ETA
und Regierung bemüht. Seit dem Regierungswechsel 2004 ist er
Berater Zapateros.
Verlagsinformation |
|
|
Michel Onfray: Wir brauchen keinen Gott.
Warum man jetzt Atheist sein muß. Piper-Verlag 2006. ISBN:
3-492-04852-8. |
|
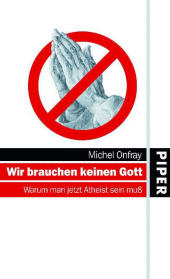
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Tausende besuchen jedes Jahr seine Vorlesungen an der "Université
Populaire" in Caen. Michel Onfray ist der große Radikale unter den
Denkern der Gegenwart. Mit seiner Absage an alle Religionen und
dem Plädoyer für ein freies, vernunftbestimmtes Leben entfachte er
nicht nur in Frankreich eine leidenschaftliche und kontrovers
geführte Debatte.
In den USA werden Homosexuelle von religiösen Eiferern gejagt, der
Islam ist stark wie nie, der konservative Papst wird umjubelt: Die
Religionen kommen zurück auf die Weltbühne. Eine Katastrophe für
jeden selbständig denkenden Menschen, findet Michel Onfray, ein
Rückschritt ins Mittelalter. Haben nicht die monotheistischen
Religionen Judentum, Christentum und Islam durch die Jahrhunderte
eine Blutspur gelegt, alles Leibliche verteufelt, durch
Geschichten vom Jenseits ihre Gläubigen im Diesseits im Griff
gehalten?
Onfray plädiert für die Abkehr von den Religionen, die die
Menschen nicht befreien, sondern einengen, die Staat und
Gesellschaft unlegitimiert beeinflussen, oft sogar kontrollieren.
Er entwickelt in diesem ebenso scharfen wie unkonventionellen
Diskussionsbeitrag eine "Atheologie": Nur diese könne den Menschen
geistige Freiheit und Lebensglück zurückgeben.
Zum Autor
Michel Onfray, geboren 1959 in Argentan (Frankreich), Doktor der
Philosophie, hat nach 20 Jahren seine Stelle als Philosophielehrer
an einem technischen Gymnasium in Caen aufgegeben und 2002 die
philosophische Volkshochschule in Caen gegründet, an der er auch
unterrichtet. Michel Onfray hat über 15 Bücher publiziert, u.a.
"Der Bauch der Philosophen" und "Der sinnliche Philosoph"
(Campus). In seinem jüngsten Werk "Traité d’athéologie" (deutscher
Titel: "Wir brauchen keinen Gott – Warum man jetzt Atheist sein
muß") setzt sich Onfray für einen offensiven Atheismus ein, der
die Residuen jüdisch-christlichen Denkens im Alltagsleben (und die
Irrationalität des Islam) aufzeigt und durch Rationalität und
gelebte Diesseitigkeit bekämpft.
Verlagsinformation
|
|
|
Klaus Völker: Boris Vian.
Der Prinz von Saint-Germain. Überarbeitete Neuausgabe, mit
zahlreichen Fotos. Wagenbach-Verlag 2006. ISBN: 3-8031-2529-4. |
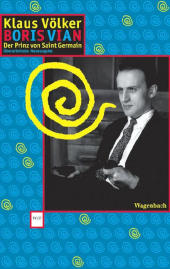
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Seine vielen Talente: prächtig. Seine Versteckspiele: frech. Seine
Täuschungen: raffiniert. Boris Vian war ein leidenschaftlicher
Provokateur, der unter schwerer Weihwedelphobie litt, Sartre zu
seinen besten Freunden zählte und sich zuweilen selbst übersetzte.
Klaus Völker folgt seinen schillernden Spuren.
Zum Autor
Klaus Völker, geboren 1938 in Frankfurt am Main, Schriftsteller,
Theaterwissenschaftler und Professor für Schauspielgeschichte und
Dramaturgie, ist Rektor der Schauspielschule Ernst Busch in
Berlin. Als ausgewiesener Pataphysiker ist Klaus Völker unter
anderem Herausgeber der Boris Vian-Gesamtausgabe.
Verlagsinformation |
|
|
Ralf Konersmann: Kulturelle
Tatsachen.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-29374-5. |
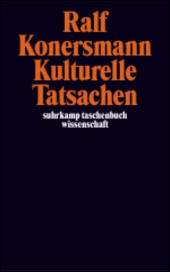
mehr Info
bestellen
|
Die
Kultur ist eine Welt von Tatsachen. Das sagt sich leicht und
klingt überzeugend.
Die Frage ist aber, was wir erwarten, wenn wir von Tatsachen
sprechen. In Abhebung von positivistisch getönten Wissenskulturen
des 19. Jahrhunderts begannen die frühen Kulturphilosophen, ein
eigenes Verständnis von Faktizität zu entwickeln. Den Schlüssel
fanden Georg Simmel und Ernst Cassirer mit dem Konzept des Werks.
Seither müssen wir uns die Kultur als etwas denken, das sich
indirekt und auf Umwegen manifestiert, und zwar in den Tatsachen
des von Menschen Gemachten.
Die Analyse kultureller Tatsachen führt ins Zentrum
philosophischer und kulturwissenschaftlicher Begriffsbildung. Die
in diesem Band versammelten Studien greifen das historische, durch
unglückselige Oppositionsbildungen abgedrängte
Formulierungsangebot der Kulturphilosophie auf und erneuern es
unter veränderten Bedingungen. Behandelt werden nicht nur
systematische Aspekte, sondern auch rezeptionstheoretische Fragen
sowie Formen und Figuren des Wissens.
Verlagsinformation |
|
|
Franziska Schößler:
Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Eine Einführung.
UTB Uni-Taschenbücher Bd.2765. UTB Francke 2006. ISBN:
3-8252-2765-0. |
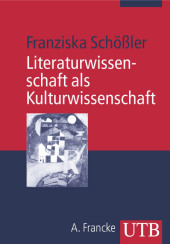
mehr Info
bestellen
|
Die
Einführung präsentiert einschlägige Theoriemodelle einer
kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft überblicksartig und
doch textnah. Ausgehend von den Kulturwissenschaften um 1900
werden aktuelle Ansätze aus den Bereichen New Historicism, Gender
und Postcolonial Studies, Anthropologie, Erinnerungstheorien u.a.
vorgestellt, zentrale Texte zusammengefasst, die
Forschungsdiskussionen nachgezeichnet und die methodischen
Möglichkeiten durch Beispiellektüren veranschaulicht. Die
behandelten Autoren und Autorinnen werden in kurzen biographischen
Abrissen vorgestellt. Zudem geben kommentierte Literaturangaben am
Ende der einzelnen Kapitel wertvolle Hinweise für die
eigenständige Vertiefung. Zur schnellen Orientierung finden sich
am Schluss des Bandes ein Sach- und ein Personenregister sowie ein
Glossar, das zentrale Begriffe definiert.
Verlagsinformation |
|
|
April 2006 |
|
|
|
Hans M. Enzensberger:
Schreckens Männer.
Versuch über den radikalen Verlierer. Originalausgabe.
Sonderdruck. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-06820-2. |
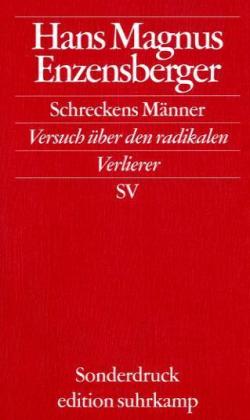
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der Eifer, mit dem Schüler und Gotteskrieger, Familienväter und
Selbstmordattentäter, mit Schrotflinten und Bomben ihrem eigenen
und dem Leben möglichst vieler anderer ein Ende machen, ist den
meisten von uns rätselhaft. "Man muss nicht alles verstehen, aber
ein Versuch kann nicht schaden": das ist das Motto dieses Essays,
den Hans Magnus Enzensberger dem "Radikalen Verlierer" widmet.
Gibt es, jenseits aller Ideologie, Gemeinsamkeiten zwischen dem
einsamen Amokläufer, der in einem deutschen Gymnasium um sich
schießt, und den organisierten Tätern aus dem islamistischen
Untergrund? Größenphantasie und Rachsucht, Männlichkeitswahn und
Todeswunsch gehen auf der verzweifelten Suche nach einem
Sündenbock – beim isolierten Täter wie im Kollektiv der Fanatiker
– eine brisante Mischung ein, bis der radikale Verlierer
explodiert und sich und andere für sein eigenes Versagen bestraft.
Zum Autor
Hans Magnus Enzensberger, geboren 1929 in Kaufbeuren, lebt heute
in München. Seit einiger Zeit schreibt der Autor auch Kinder- und
Jugendbücher. Sein Buch "Der Zahlenteufel" wurde mit dem
"Luchs"
ausgezeichnet. 1963 erhielt Hans Magnus Enzensberger den
Georg-Büchner-Preis.
Verlagsinformation |
|
|
Katharina Raabe/Monika Sznajderman
(Hrsg.): Last & Lost.
Ein Atlas des verschwindenden Europas. Mit meist farbigen Fotos.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-41772-X. |
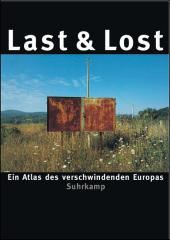
mehr Info
bestellen
|
Europa
verändert sein Gesicht. Orte und Landschaften werden verlassen,
sie verfallen oder verschwinden ganz. Zwischen Atlantik und
Kaspischem Meer, zwischen Adria und Barentssee stößt man auf
Ruinen der modernen Zivilisation: auf Industriebrachen,
einstürzende Bahnhöfe, Kasernen und Sanatorien, auf tote
Schienenstränge oder unentzifferbare Grabinschriften. Vor allem in
Mittel- und Osteuropa sind die Narben einer von Krieg, Vertreibung
und megalomanischer Naturbeherrschung gekennzeichneten Epoche noch
sichtbar.
Autorinnen und Autoren aus fünfzehn europäischen Ländern haben
ihre sie besonders inspirierenden Orte besucht und erkundet –
fragile Stadtviertel, zerfallene Dörfer, abbröckelnde
Küstenstriche, deren Aura gefangen nimmt, die ein Geheimnis
bergen, das ergründet werden will. Liegt ihr Zauber darin, dass
sie die letzten ihrer Art sind? Unterirdische Beziehungen,
überraschende kulturelle Verwandtschaften zwischen weit
voneinander entfernten Regionen werden sichtbar – Zeugen einer
gemeinsamen Geschichte, deren undeutlich werdende Spuren kurz vor
dem Verschwinden nachgezeichnet werden.
Ergänzt um photographische Arbeiten von Künstlern, die sich
unabhängig von den Autoren auf den Weg gemacht haben, um einen
letzten Blick auf Vergessenes und Verlorenes zwischen Belgrad und
Istanbul, Lissabon und Königsberg zu werfen, vermittelt dieser
Band eine Ahnung von dem so fragilen wie bezaubernden Reichtum
unseres Kontinents.
Verlagsinformation |
|
|
März 2006 |
|
|
|
Jörg von Uthmann: Killer,
Krimis, Kommissare.
Eine kleine Kulturgeschichte des Mordes. Beck-Verlag 2006. ISBN:
3-406-54115-1. |
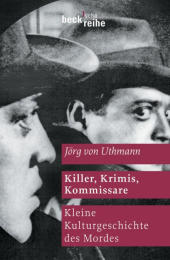
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Mord als schöne Kunst betrachtet: Morde sind zwar unerquicklich
für das jeweilige Opfer, haben aber auch ihre guten Seiten, denn
sie beflügeln Kunst und Wissenschaft – die Mediziner, die den
Kommissaren dabei helfen, die Killer zu fassen, die
Schriftsteller, die die Jagd in Krimis beschreiben und die
Filmemacher, die sie auf Celluloid oder digital festhalten.
Bei seinem ebenso spannenden wie unterhaltsamen Spaziergang durch
die Kulturgeschichte des Mordes zeichnet Jörg von Uthmann diese
Entwicklung nach – vom König Ödipus, dem literarisch ergiebigen
Vatermörder, bis zur DNA-Analyse, die es 1987 erstmals erlaubte,
einen Mörder anhand seines "genetischen Fingerabdrucks" zu
überführen.
Zum Autor
Jörg von Uthmann war viele Jahre Diplomat und Journalist, u.a. für
die FAZ und den Tagesspiegel. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher
über kulturgeschichtliche Themen. Jörg von Uthmann lebt in Paris.
Verlagsinformation |
|
|
Hans Blumenberg: Arbeit am
Mythos.
Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft Bd.1805. Suhrkamp-Verlag 2006.
ISBN: 3-518-29405-9. |
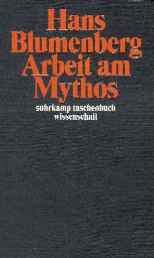
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
"Was meinen wir, was bewegt uns, wenn wir die Welt uns vorstellen?
Wie nehmen wir die Zeit – als historische und existentielle Größe
– wahr? Welche Bedeutungen führt der Mythos mit sich, und worin
besteht seine Bewältigung? Schließlich: wodurch bestimmen sich die
Bilder und Gleichnisse, die Techniken und Strategien, mit denen
das Leben die Erträglichkeit sichert?
Blumenbergs Buch 'Arbeit am Mythos' erörtert dessen Wert: wiederum
unter funktionalen Aspekten. Denn in den mythischen Erzählungen
und Parabeln 'überlebt' die Menschheit so gut wie in den
handgreiflichen Zurüstungen. Unvertrautes und Unheimliches,
Fremdes und Anstößiges changiert zum Hin- und Annehmbaren in der Transposition des Mythos. Die Arbeit des Philosophen aber beruht
darauf, dass er diesen Schnitt in seinen Folgen kenntlich macht.
So gestaltet Blumenberg das Thema mit philologischer Genauigkeit
und mit der Kunst des genialen Exegeten – unüberbietbar in den
Partien, die der Prometheus-Mythe mit Blick auf Goethe gewidmet
sind." (Martin Meyer, Neue Zürcher Zeitung)
Zum Autor
Hans Blumenberg wurde 1920 in Lübeck geboren. Er studierte
Philosophie, Germanistik und klassische Philosophie (mit
Unterbrechung) in Paderborn, Frankfurt am Main, Hamburg und Kiel.
1947 Promotion zum Dr. phil. und 1950 Habilitation in Kiel.
Blumenberg war u. a. von 1962 bis 1967 Mitglied des Senats der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, 1963 Mitbegründer der Forschungsgruppe
"Poetik und Hermeneutik". 1974 erhielt er den Kuno-Fischer-Preis
der Universität Heidelberg, 1980 Sigmund-Freud-Preis der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Hans Blumenberg
starb am 28. März 1996 in Altenbergen.
Verlagsinformation |
|
|
Peter Brückner: Ulrike Meinhof
und die deutschen Verhältnisse.
Mit einem neuen Vorwort von Ulrich K. Preuß und einem Nachwort von
Klaus Wagenbach. Mit Texten von Ulrike M. Meinhof.
Wagenbach-Verlag 2001 (Neuausgabe). ISBN: 3-8031-2407-7. |
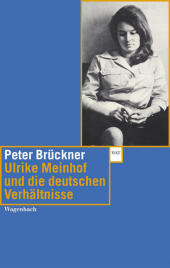
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Peter Brückners Buch ist nicht nur ein Portrait Ulrike Meinhofs,
sondern auch eine Bestandsaufnahme unserer Nachkriegsgeschichte.
Brückner fragt nach den deutschen Verhältnissen, die mitschuldig
daran waren, dass die scharfsinnige, kluge und leidenschaftliche
Journalistin Ulrike Meinhof keinen anderen Ausweg mehr sah als den
bewaffneten Kampf, danach zur "Staatsfeindin Nummer 1" wurde und
in Stammheim starb.
Das Buch enthält ein Nachwort von Klaus Wagenbach über die
Entstehung des Buchs und über den Versuch, seine Veröffentlichung
zu verhindern – sowie ein zum fünfundzwanzigsten Todestag
geschriebenes Vorwort von Ulrich K. Preuß über Ulrike Meinhof und
die politischen Folgen bis heute.
"Wo Brückner analysiert, ist er so bestechend wie bestürzend.
Seine Fragen sind so bohrend wie seine historischen Assoziationen
erhellend." (Fritz J. Raddatz, DIE ZEIT)
Zu Autor und Autorin
Peter Brückner, geboren 1922 in Dresden, seit 1939 Kontakte zu
Antifaschisten und Kommunisten, 1941 eingezogen nach Wien. Nach
Kriegsende Mitglied der KPD, 1948 Übersiedelung zunächst nach
Westberlin, dann nach Münster, dort Abschluss seines
Psychologiestudiums mit Promotion. Nach Ausbildung zum
Psychoanalytiker 1967 Übernahme des Lehrstuhls für Psychologie an
der Universität Hannover. 1972 und 1977 jeweils
Dienstsuspendierung wegen Vorwurfs von Kontakten zur RAF sowie der
Herausgabe des indizierten Textes zum Tod von Generalbundesanwalt
Siegfried Buback (ein Nachruf, der anonym unter dem Namen "Mescalero"
erschien). Der Autor verstarb 1982 in Nizza.
Ulrike Meinhof, geboren 1934 in Oldenburg, von 1959 bis 1969
Mitarbeiterin bei "konkret". 1970 ging sie in den Untergrund,
wurde 1972 verhaftet und starb 1977 nach der Verurteilung zu
lebenslanger Haft im Isolationstrakt des
Hochsicherheitsgefängnisses Stuttgart-Stammheim.
Verlagsinformation |
|
|
Februar 2006 |
|
|
|
Karl
Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit.
Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik.
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2006. ISBN: 3-596-16718-3. |
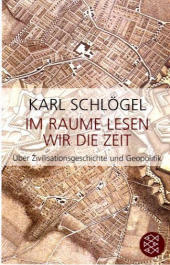
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Was sagt uns der Grundriss einer amerikanischen Stadt über den
amerikanischen Traum? Wie haben Eisenbahn, Auto und Flugzeug
unseren Sinn für Distanzen verändert? Auf solche Fragen geben
herkömmliche Geschichtsbücher keine Antwort. Karl Schlögel findet
sie an überraschenden Stellen: in Fahrplänen und Adressbüchern,
auf Landkarten und Grundrissen. Er holt damit die Geschichte an
ihre Schauplätze zurück, macht sie anschaulich, lebendig und
wunderbar lesbar.
Rezensionen
"Ein Buch von tiefem Ernst und großer Leichtigkeit, ein Pamphlet
und eine Spurenlese, dicht und welthaltig. Nur zu glänzen ist
schon eine ganze Menge. Dieses Buch glüht von innen." (Jürgen
Osterhammel, Die Zeit)
"Eine wunderbare Lektüre... Karl Schlögel ist ein grandioser
Landschaftsmaler, vor allem bei der Charakterisierung
osteuropäischer Räume. Er hat ein Werk der Leidenschaft
geschrieben, wie es die Geschichtswissenschaft in jeder Generation
nur wenige Male hervorbringt. Hier hat ein König gebaut, der noch
vielen Kärrnern zu tun geben wird." (Gustav Seibt, Literaturen)
Zum Autor
Karl Schlögel, geboren 1948 im Allgäu, hat an der Freien
Universität Berlin, in Moskau und St. Petersburg Philosophie,
Soziologie, Osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert und
lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.
Verlagsinformation |
|
|
George L. Mosse:
Die Geschichte des Rassismus in Europa.
Die Zeit des Nationalsozialismus. Fischer-Taschenbuch-Verlag 2006,
Frankfurt 2006. ISBN: 3-596-16770-1. |
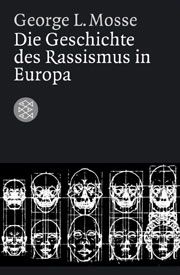
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der weltbekannte amerikanische Historiker George L. Mosse weist in
diesem Buch – einem Standardwerk, das seit 1978 immer wieder
aufgelegt wird – nach, dass der Rassismus keinen Seitenerscheinung,
sondern ein grundlegendes Element der europäischen
Kulturentwicklung gewesen ist: Der moderne Rassismus entspringt
denselben Quellen, die auch die Grundströmungen moderner
europäischer Kultur gespeist haben: Aufklärung und Pietismus,
Rationalismus und Romantik.
Mosse stellt die Geschichte des Rassismus in den Zusammenhang mit
der europäischen Geschichte. Indem er die einzelnen
Entwicklungsphasen beschreibt, kann er zeigen, wie und warum
rassistisches Denken in alle gesellschaftlichen Bereiche, v. a. in
die Wissenschaften, eindringen konnte. Der Autor untersucht
außerdem die wechselseitigen Beziehungen zwischen Rationalismus
und Christentum sowie den Verfall der humanistischen Tradition in
Europa. Schließlich setzt er sich mit der Herausbildung von
Stereotypen wie der "überlegenen" und "minderwertigen" Rasse
auseinander, die am Ende zur "Endlösung der Judenfrage" durch die
Nationalsozialisten geführt hat.
Rezension
"Mosse hat eine kurze, allgemein verständliche Geschichte des
Rassismus vorgelegt, eine Geschichte der ideologischen Wurzeln,
der konkurrierenden und verwandten Bewegungen und Ideen." (American
Historical Review)
Zum Autor
George L. Mosse (1918-2002), Enkel des Pressezaren Rudolf Mosse,
wurde in Berlin geboren, musste mit der elterlichen Familie 1933
vor den Nationalsozialisten fliehen. In Cambridge/GB studierte er
Geschichte und Politik. Kurz vor dem II. Weltkrieg emigrierte er
in die USA und vollendete an der Harvard Universität seine
Studien. Jahrzehntelang wirkte er als Professor für Europäische
Geschichte in Madison/Wisconsin und lehrte außerdem deutsche
Geschichte in Jerusalem. Mosse war einer der unkonventionellsten
und produktivsten Historiker des 20. Jahrhunderts.
Verlagsinformation |
|
|
Isaiah Berlin:
Freiheit. Vier Versuche.
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2006. ISBN: 3-596-16860-0. |

mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Isaiah Berlins Buch handelt von einer Idee, die Geschichte gemacht
hat, und von den Erfahrungen mit eben dieser Idee und den an sie
geknüpften Hoffnungen: Es geht um die Idee der Freiheit als
zentralem Begriff politischen Denkens. In vier Studien, die aus
seiner souveränen Kenntnis der politischen Philosophie und
Ideengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts schöpfen, untersucht
Berlin verschiedene Freiheitskonzepte und ihre politischen
Implikationen.
Er analysiert die Antriebskräfte des Freiheitsverlangens und wirft
Licht auf deren spekulative Überhöhungen, programmatische
Eingrenzungen und ideologische Verkürzungen. Berlins Studien sind
ein unverzichtbarer Beitrag um Verständnis tief liegender
politischer Konflikte unserer Gegenwart.
Zum Autor
Isaiah Berlin, geboren 1909 in Riga, war von 1957 bis 1967
Professor für Sozialphilosophie und Politische Theorie in Oxford,
von 1974 bis 1978 Präsident der Britischen Akademie der
Wissenschaften.
Verlagsinformation |
|
|
Theodor W.
Adorno: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-29385-0. |
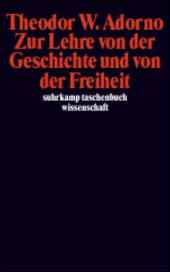
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Anfang der sechziger Jahre hielt Theodor W. Adorno an der
Frankfurter Universität vier Vorlesungen, darunter die Lehre von
der Geschichte und von der Freiheit. Inhaltlich handelt es sich um
eine Vorstufe der Hegel und Kant gewidmeten Kapitel der Negativen
Dialektik (1966), formal um improvisierte, frei gesprochene
Vorträge, die es erlauben, dem Philosophen bei der "Arbeit am
Begriff" zuzuschauen.
Der Text versammelt alle wichtigen Themen und Motive der
Adornoschen Geschichtsphilosophie: das Schlüsselphänomen der
Naturbeherrschung, die Kritik des Existenzials der
"Geschichtlichkeit" und schließlich Adornos Opposition zum
traditionellen Begriff von Wahrheit als einem Bleibenden,
Unveränderlichen, Ungeschichtlichen.
Zum Autor
Theodor Wiesengrund (W.) Adorno, geboren 1903, ist einer der
herausragenden Philosophen des 20. Jahrhunderts. Als Vertreter der
Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule, als Vordenker der
Studentenbewegung, als Essayist, Musikkritiker, Komponist und
Hochschullehrer hat er die Geistesgeschichte nicht nur der
Bundesrepublik entscheidend geprägt. Sein pointierter Stil, die
Vielfalt seiner Themen und seine kritische Auseinandersetzung mit
der politischen und geschichtlichen Situation haben ihn über die
engen Fachgrenzen der Philosophie und Soziologie hinaus bekannt
und zu einem der führenden Intellektuellen gemacht, dessen
Schriften, Aphorismen und Gedanken mittlerweile zum festen
Bestandteil unseres kulturellen Erbes geworden sind.
Verlagsinformation |
|
|
Andreas P.
Pittler: Samuel Beckett.
Originalausgabe. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN:
3-423-31082-0. |
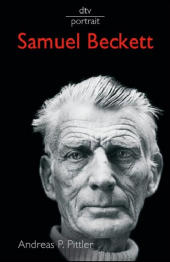
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der irische Schriftsteller Samuel Beckett (1906-1989), der
englisch und französisch schrieb, wurde insbesondere mit seinen
absurden Theaterstücken berühmt. Er selbst fand sein Leben
uninteressant, den großen Erfolg von "Warten auf Godot" sah er als
"Unfall" an und den Literaturnobelpreis, den er 1969 erhielt,
bezeichnete er als "Katastrophe". Die Biografie von Andreas P.
Pittler zeigt allerdings: Weder ist Becketts Werk das Ergebnis von
Zufälligkeiten noch sein Leben so uninteressant, wie der Dichter
behauptete.
Zum Autor
Andreas P. Pittler, geboren 1964 in Wien, studierte Geschichte an
der dortigen Universität. Zu seinen Buchveröffentlichungen zählen
bislang vier Romane, mehrere Geschichtswerke und Biografien über
Bruno Kreisky, Rowan Atkinson und die Komikertruppe Monty Python.
Verlagsinformation |
|
|
Katajun
Amirpur/Ludwig Ammann (Hrsg.): Der Islam am Wendepunkt.
Liberale und konservative Reformer einer Weltreligion.
Herder-Verlag, Freiburg 2006. ISBN: 3-451-05665-8. |

mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der Mord am niederländischen Filmemacher Theo van Gogh hat die
Frage verschärft: Ist der Islam mit der Moderne überhaupt
vereinbar? Auch in der islamischen Welt und unter den Muslimen
Europas wird diese Frage heftig diskutiert. Die Bereitschaft zur
Kritik der eigenen Tradition geht zwar unterschiedlich weit. Aber
nicht wenige Denker kommen zu dem Schluss: Eine grundlegende
Reform des Islams ist nötig – und möglich.
Themen wie Gewalt, Koranauslegung, Frauenrechte, Demokratie stehen
im Zentrum. Dieses Buch zeigt in spannenden Porträts das Gesicht
des Islams der Zukunft: Wegweisende Vorschläge zur Rückbesinnung
auf den wahren Kern der Religion und Neuauslegung des Glaubens,
die hierzulande noch viel zu wenig bekannt sind.
Zu den HerausgeberInnen
Katajun Amirpur, geboren 1971, hat an den
Universitäten Bonn und Teheran Islamwissenschaft studiert.
Ihre
Dissertation
über "die Entpolitisierung des Islam – Werk und Wirkung von
Abdol Karim Soroush in der islamischen Republik Iran"
schrieb sie in Bamberg. Heute widmet sich Amirpur –
seit Mai 2003 über ein Emmy-Noeter-Jungprofessorenstipendium
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gefördert – der schiitischen Koranexegese.
Aufgewachsen mit den religiösen Geschichten von Anne de Fries und
den adaptierten Korangeschichten, gehört
Katajun Amirpur zu jenen Expertinnen, die sich kompetent und ohne
die Brille einer einseitigen Orientrezeption den modernen
Islamwissenschaften widmet.
Ludwig Ammann, geboren 1961, Studium der Islamwissenschaft,
Literaturwissenschaft und Völkerkunde in Freiburg im Breisgau.
Abschlüsse: M.A. Literaturwissenschaft, Dr. phil.
Islamwissenschaft; seit 1988 freie Kunst-, Buch- und Filmkritik
u.a. für Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), European
Photography und Merkur. 1997 Fellow am Kulturwissenschaftlichen
Institut in Essen in der Studiengruppe "Sinnkonzepte als
Orientierungssysteme".
Verlagsinformation |
|
|
Januar 2006 |
|
|
|
Geert Mak: Der Mord an Theo van Gogh.
Geschichte einer moralischen Panik. Suhrkamp-Verlag 2005. ISBN:
3-518-12463-3. |
|
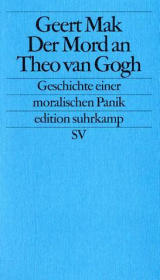
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Am 2. November 2004 liegt der Filmemacher Theo van Gogh in
Amsterdam ermordet auf der Straße. Der Attentäter ist ein
Marokkaner, der in den Niederlanden geboren wurde und dort
aufwuchs. Sein Bekennerschreiben, das er mit einem Messer an den
Körper des Opfers geheftet hat, offenbart den
radikal-islamistischen Hintergrund der Tat. Ganz Europa ist
schockiert. Eine Debatte über die Integration von Einwanderern
flammt auf und eskaliert, das Schlagwort vom "Scheitern der
multikulturellen Träume" beherrscht die Medien.
Geert Mak hat eine Streitschrift verfasst, die in den Niederlanden
starke Diskussionen hervorgerufen hat. Er zeichnet das Bild einer
verunsicherten westlichen Gesellschaft, in der Angst zum Ratgeber
wird und humanistische Werte unterzugehen drohen. Gleichzeitig
erinnert er an die Aufgabe, echte Toleranz zu lehren – mit allen
dazugehörigen Konflikten.
Zum Autor
Geert Mak, geboren 1946 in einem friesischen Dorf, war viele Jahre
Redakteur des "NRC Handelsblad". Er ist einer der bekanntesten
Publizisten der Niederlande und gehört nach drei großen
Bestsellern zu den wichtigsten Sachbuchautoren des Landes. Zuletzt
erschienen "Amsterdam " (1997), "Wie Gott verschwand aus Jorwerd"
(1999), das hocherfolgreiche und viel gelobte Buch "Das
Jahrhundert meines Vaters" (2003) sowie "In Europa" (2005).
Verlagsinformation
Rezensionen
-
Früher waren wir weiter (DIE WELT, 11.02.2006)
-
Verstörte Niederlande, empörte Niederlande (DIE WELT,
21.01.2006)
-
Fremdenhass und Angstsucht (taz, 10.12.2005)
|
|
|
Wilhelm Heitmeyer: Deutsche
Zustände, Folge 4. Herausgegeben von Edition Suhrkamp Nr.
2454. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-12454-4. |
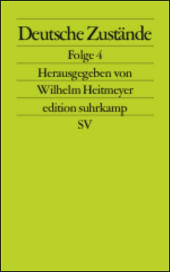
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Die Langzeitstudie "Deutsche Zustände" legt kontinuierlich
Rechenschaft über den sozialen, politischen und mentalen Zustand
der Republik ab. Sie untersucht Erscheinungsweisen, Ursachen und
Entwicklungen "gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" anhand von
wissenschaftlichen Analysen und anschaulichen Fallgeschichten,
Essays, Interviews und – diesmal – einer Fotogeschichte.
In der neuen, vierten Folge stehen Desintegration, Verschiebungen
in der politischen Kultur, Diskriminierung und religiös
eingefärbte Feindseligkeit im Mittelpunkt. In der Sektion
"Fallgeschichten" werden u. a. die Abschottung der Muslime und die
Zunahme junger Obdachloser behandelt. Die Essays beschäftigen sich
mit den Vorgängen im sächsischen Landtag rund um die NPD, mit der
Zukunft des Antidiskriminierungsgesetzes und dem Beitrag der
Eliten zur Politikverdrossenheit.
Zum Autor
Dr. Wilhelm Heitmeyer ist Professor an der Universität Bielefeld
und Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung.
Verlagsinformation |
|
|
Fernand Braudel/Georges
Duby/Maurice Aymard: Die Welt des Mittelmeeres. Zur Geschichte
und Geographie kultureller Lebensformen.
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2006 (Neuausgabe). ISBN:
3-596-16853-8. |
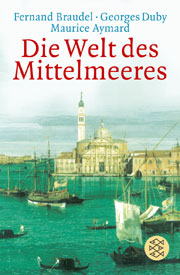
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Die mediterrane Welt zeigt (geographisch, gesellschaftlich,
ideengeschichtlich und politisch) nicht nur ein "westliches"
Gesicht, sondern auch ein "östliches" und ein "afrikanisches"; sie
war und ist das Laboratorium nicht einer einzigen, sondern
mehrerer Zivilisationen. Eben darin steckt ihre anhaltende
Faszinationskraft, die den Reisenden genau so wie den Historiker
lockt. Sie führt den anschaulichen Beweis für die Vielsprachigkeit
der Lebensformen, für den Bildungsprozess kultureller Identität
durch Widerspiel und Nachbarschaft, Öffnung und Selbstbehauptung.
Mit guten Gründen hat man den Mittelmeer-Raum die "Wiege Europas"
genannt. Die Geschichte des Abendlandes hat von dort ihren Ausgang
genommen. Zugleich liegen dort die Anfänge eines vielfältigen,
spannungsvollen Austausches zwischen großen Kulturen. Die
mediterrane Welt zeigt (geographisch, gesellschaftlich,
ideengeschichtlich, politisch) nicht nur ein "westliches" Gesicht,
sondern auch ein "östliches" und ein "afrikanisches"; sie war und
ist das Laboratorium nicht einer einzigen, sondern mehrerer
Zivilisationen.
Eben darin steckt ihre anhaltende Faszinationskraft, die den
Reisenden genauso wie den Historiker lockt. Sie führt den
anschaulichen Beweis für die Vielsprachigkeit der Lebensformen,
für den Bildungsprozess kultureller Identität durch Widerspiel und
Nachbarschaft, Öffnung und Selbstbehauptung. Kein systematisches
historiographisches Werk, sondern neun Innenansichten der
Mittelmeer-Welt, ihrer Zivilisationszeichen und ihrer
geschichtlichen Entwicklungsverläufe.
Rezensionen
"Fernand Braudels "Die Welt des Mittelmeers" ist eine
Liebeserklärung." (Herfried Münkler, in: FAZ)
"Was hier vorliegt, ist im Leben des Wissenschaftlers Braudel
vielleicht das, was man beim Eiskunstlaufen die Kür nennt. Und in
der Tat sind – um im Bilde zu bleiben – bei dieser Kür einige
höchste Schwierigkeiten mit einer selten erreichten Virtuosität
bewältigt." (NDR-Hörfunk)
"Der schmale Band ist eine geglückte Visitenkarte der
Annalles-Schule. Wer bislang noch nichts von dieser französischen
Historikergruppe gelesen haben sollte, findet hier eine glänzend
formulierte Kostprobe ihrer Thesen und Auffassungen." (Jens
Petersen [Dt. Hist. Inst., Rom], in: Annot. Bibliogr. f. d. polit.
Bildg.)
Zu zwei der drei Autoren
Fernand Braudel (1902-1986) war nach Marc Bloch und Lucien Febvre
die herausragende Gründerfigur der neuen französischen
Geschichtswissenschaft. Er hat an französischen und ausländischen
Universitäten gelehrt, zuletzt war er Direktor an der École
Pratique des Hautes Études in Paris.
Georges Duby, Mediävist und einer der wichtigsten Vertreter der
Annales-Schule, wurde 1919 in Paris geboren. Ab 1970 hatte er
einen Lehrstuhl als Professor für mittelalterliche Geschichte am
College de France und verfasste zahlreiche Abhandlungen über
Historie und Kunst des Mittelalters. Seit 1987 Mitglied der
Academie française, war Duby unter anderem Vorsitzender im
Aufsichtsrat von La Sept sowie Leiter der Zeitschriften "Etudes
rurales" und "Moyen Age". Er starb 1996 im Alter von 77 Jahren in
Aix-en-Provence.
Verlagsinformation |
|
|
Joachim C. Fest: Begegnungen.
Über nahe und ferne Freunde. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-499-62082-0. |
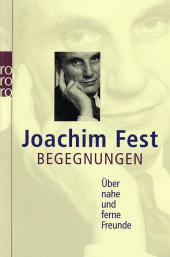
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Glänzend erzählte Zeitgeschichte aus nächster Nähe:
Bestsellerautor Joachim Fest berichtet über Begegnungen mit
prominenten Persönlichkeiten, die sein Leben prägten. Das Spektrum
der Bildnisse reicht von Hannah Arendt bis Golo Mann, von Ulrike
Meinhof bis Sebastian Haffner. Der intime Blick des Autors
erschließt dem Leser nicht nur die einzelne Person, ihre Gedanken
und ihre Welt, sondern immer auch ein besonderes Stück deutscher
Zeit- und Kulturgeschichte.
Zum Autor
Joachim Fest, geboren 1926 in Berlin, studierte Jura, Geschichte
und Germanistik. 1963 wurde der Publizist und Historiker
Chefredakteur des Fernsehens beim NDR und veröffentlichte eine
Studie über die Führungsfiguren der NS-Herrschaft. 1973-1993
Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von ihm liegen
zahlreiche - sehr bekannte - Fachveröffentlichungen vor.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Januar – Dezember 2005 |
|
|
|