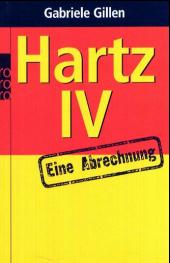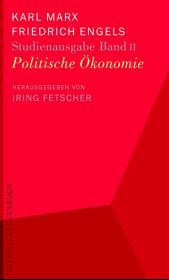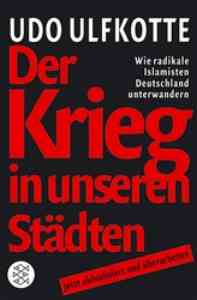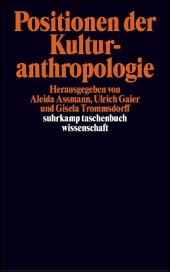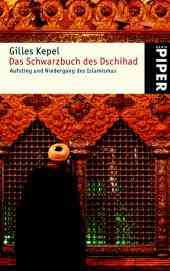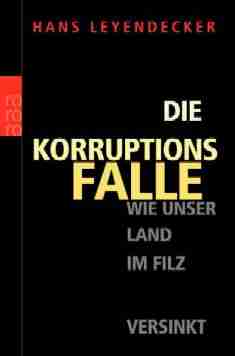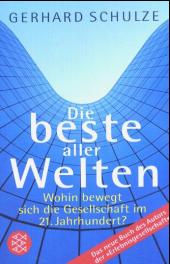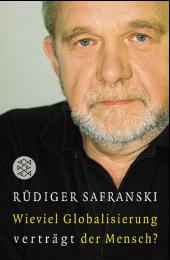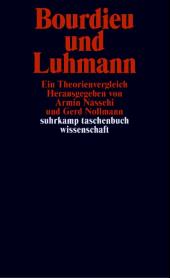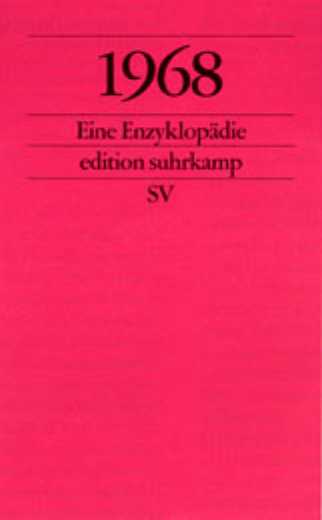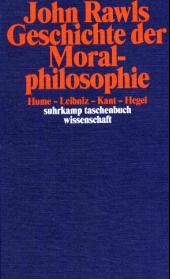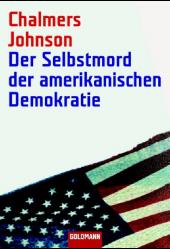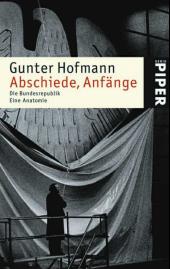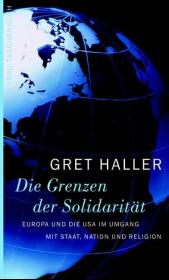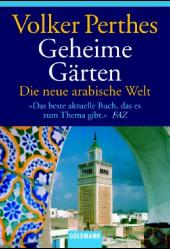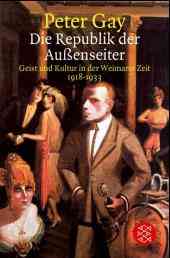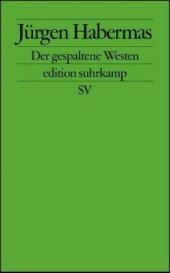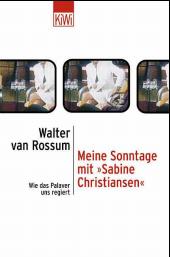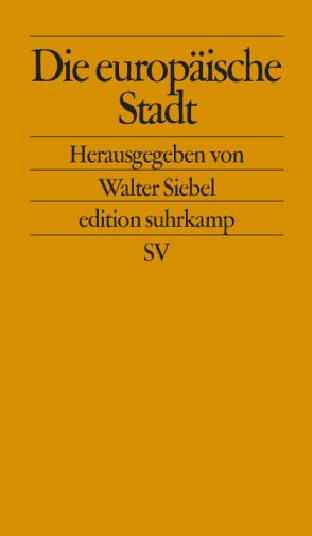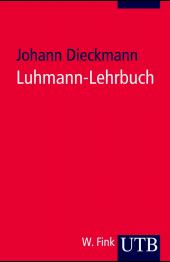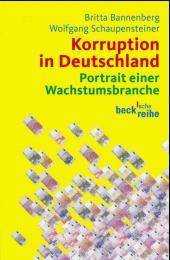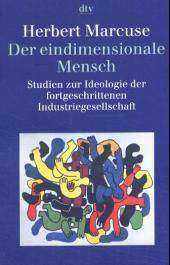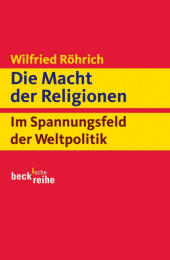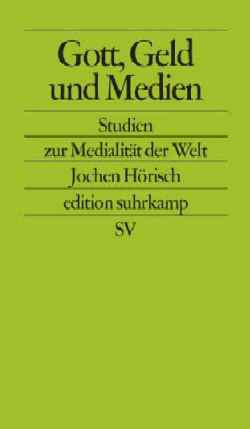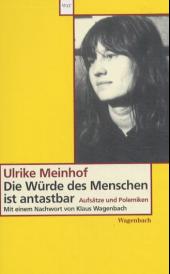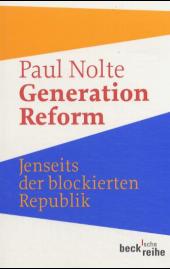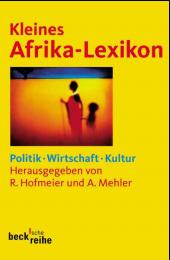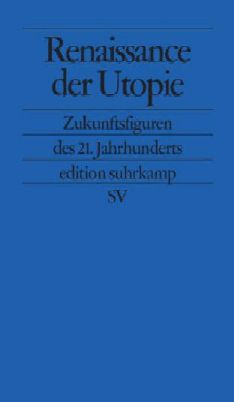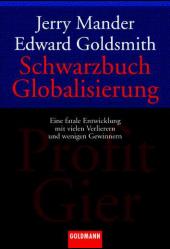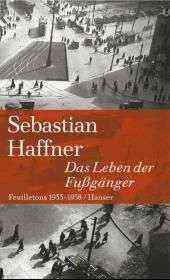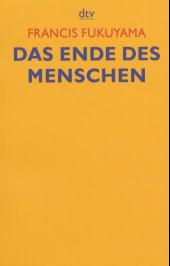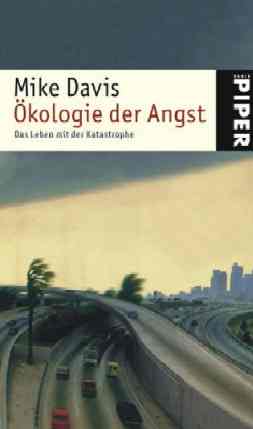|
Dezember
2004 |
|
|
|
Friedhelm Hengsbach: Das Reformspektakel. Warum der
menschliche Faktor mehr Respekt verdient. Herder-Verlag 2004.
ISBN: 3-451-05544-9. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Ausschließlich am Markt orientierte Reformversuche sind bedrohlich
für den sozialen Zusammenhalt. Analytisch, klar und provozierend
ist die These Hengsbachs: Kern jeder Wirtschaft und jeder
Gesellschaft bleibt – der Mensch.
Rezension
Hengsbach zeigt, dass Kanzler Schröders Agenda 2010 nicht nur
minimalen Gerechtigkeitsstandards nicht genügt, sondern ökonomisch
sogar kontraproduktiv ist. Die massiven Sparschritte im Sozialen
reduzieren die ohnehin schwache Binnennachfrage weiter und treffen
damit die "Achillesferse der deutschen Konjunktur", wie auch das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW)
analysiert hat. Statt gesamtgesellschaftlichem Weit- dominiere in
der Agenda 2010 der "Mikroblick". Der aber ist blind für
systemische Rückkoppelungen, die zum Gegenteil dessen führen
können, was beabsichtigt ist.
Dies kritisiert Hengsbach aber gewissermaßen nur nebenbei. Sein
Hauptpunkt ist, dass die Agenda 2010 zu Unrecht als "Reform"
bezeichnet wird. Dieses Etikett würde sie nur dann verdienen, wenn
sie auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse benachteiligter
Bevölkerungsteile gerichtet wäre. Das Gegenteil ist jedoch der
Fall: "Was unter Bundeskanzler Kohl als sozialer Kahlschlag
gebrandmarkt wurde, gilt inzwischen als Reform." Das "mit heißer
Nadel" gestrickte Konzept deformiert die vorhandene Solidarität
und polarisiert die Gesellschaft weiter. Sie entreißt den
"Arbeitslosen, Armen, Kranken und Rentnern spürbar einen Teil des
gesellschaftlichen Reichtums."
Insgesamt bereichert Hengsbach die Diskussion über die Agenda 2010
– nicht nur um die wichtige Frage der Gerechtigkeit. Dies war
überfällig. (Norbert Reuter, Quelle: Herder-Verlag)
Zum Autor
Friedhelm Hengsbach, geboren 1937, ist einer der bekanntesten
Katholiken Deutschlands und Mitglied des Jesuitenordens. Studium
der Philosophie, Theologie und Wirtschaftswissenschaften sowie
Pädagogisches Praktikum in Büren (Westfalen), 1976 Promotion über
die "Assoziierung afrikanischer Staaten an die EG", 1982
Habilitation über Arbeitsethik: "Die Arbeit hat Vorrang – eine
Option katholischer Soziallehre", seit 1985 Professor für
Christliche Sozialwissenschaft/Wirtschafts- und
Gesellschaftslehre, seit 1992 Leiter des Oswald von
Nell-Breuning-Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
-
Das Reformspektakel und seine demokratischen Subjekte. Interview
mit F. Hengsbach (DLF, 19.12.2004)
-
Im Gespräch mit Friedhelm Hengsbach, Professor für christliche
Gesellschaftsethik
(DLR, 18.12.2004)
-
Gerechtigkeit – mehr als ein Geschenk. Rezension von Thomas Ludwig
(Handelsblatt, 17.12.2004)
-
Veranstaltung "Das Reformspektakel" im St.-Burkardus-Haus Würzburg
am 16.12.2004
-
Arbeitsmarktreform ist ein "unseriöses Programm". Interview mit
F. Hengsbach (DLR, 17.09.2004) |
|
|
Gabriele Gillen: Hartz IV – Eine Abrechnung.
Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-499-62044-8. |
|
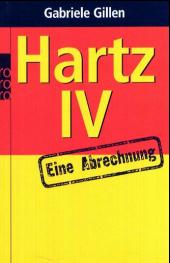
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Wendezeit in Deutschland, schon wieder. Denn jetzt kommt Hartz IV.
Und diesmal wird wirklich alles anders.
Glauben Sie es nicht, wenn hilflose Politiker Ihnen den Abriss des
Sozialstaats als Umbau verkaufen wollen! Und wenn schamlose
Unternehmenssprecher behaupten, es sei noch nicht genug. Hören Sie
besser weg, wenn ahnungslose Journalisten im Pisa-TV die
Einschnitte ins soziale Netz auch noch schön rechnen!
Einschnitte? Hartz IV ist mehr als das, wie Gabriele Gillen in
dieser fulminanten Streitschrift belegt und beweist: Hartz IV ist
der Systemwechsel vom Sozialstaat zum Almosenstaat. Hartz IV steht
für eine Politik, die Armut produziert und die Zurichtung der
Menschen für die Zwecke der Wirtschaft besorgt. Das Gerede vom
Boot, in dem wir alle sitzen, wird als Zynismus entlarvt. Es geht
bei Hartz IV um oben und unten, arm und reich, jung und alt,
verwertbar und überflüssig – es geht um vieles, nur nicht darum,
dass "kein Hilfsbedürftiger verarmen wird", wie das
Bundespresseamt im Sommer 2004 verlautbaren ließ. Menschen sind
Kosten auf zwei Beinen.
Den Schönrednern und Schönrechnern werden ihre Zahlen um die Ohren
gehauen. Und es wird nachgerechnet, auch wenn es als extrem uncool
gilt, mit dem Finger auf Krisengewinnler zu zeigen. Gillen scheut
sich nicht, völlig uncool Zusammenhänge aufzuzeigen. Der
Karstadt-Quelle-Konzern saniert sich derzeit rigoros auf Kosten
seiner Beschäftigten, während seine Hauptaktionärin Madeleine
Schickedanz mit einem Vermögen von 1,65 Milliarden Euro gerade
einmal Platz 50 in der deutschen Geldrangliste einnimmt. Cool?!
Hartz IV ist Vorbote einer sozialen Klimakatastrophe.
Ein "böses Buch gegen böse Zeiten" für alle, die mitreden wollen
und mitreden müssen: über brutal verschärfte Zumutbarkeitsregeln,
Ein-Euro-Jobs und die Strategien zur Ausweitung des
Billiglohnsektors. Kein Wunder, dass die Bundesregierung gern den
Namen Hartz aus der Welt geschafft hätte. Béla Anda,
Regierungssprecher der rot-grünen Koalition, verkündete, die
Bundesregierung werde den Namen "Hartz IV" nicht mehr verwenden,
er sei "lautmalerisch hart". Jeder blamiert sich, so gut er kann. Dieses Buch ist
eine überfällige Abrechnung und fordert zugleich dazu auf, die
soziale Demokratie zu verteidigen, so lange es noch geht. Wer das
nicht glaubt, sollte sich einfach einen Abend lang Zeit nehmen und
dieses Buch lesen.
Rezensionen
-
Abgerechnet wird zum Schluss (FTD, 05.01.2005)
-
Tatort Deutschland: Hartz macht mobil (junge Welt, 03.01.2005)
-
Gerechtigkeit – mehr als ein Geschenk
(Handelsblatt, 17.12.2004)
Zur Autorin
Gabriele Gillen –
"Kölner Schule" –
Institut für Publizistik, Studium der Politik- und
Theaterwissenschaften. Zeitungsredakteurin, Theater- und
Filmarbeit, Hörfunkautorin für die ARD, Redakteurin für Politik
und Kultur beim Westdeutschen Rundfunk (gabriele.gillen@wdr.de). Veröffentlichungen u.a.
"Anschluss verpasst. Armut in Deutschland" (1992), "Tanz auf dem
Vulkan. Geschichten über Gewalt", "Das Elend der Welt oder: Die
Praxis des Gesundheitswesens", "In einem reichen Land"
(2003).
Verlagsinformation |
|
|
Michael Opielka: Sozialpolitik. Grundlagen und
vergleichende Perspektiven. Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN:
3-499-55662-6. |
|

mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
In
allen modernen Gesellschaften nimmt die Sozialpolitik einen hohen
Stellenwert ein. Neben einem Überblick über den gegenwärtigen
Stand der Theorien des Wohlfahrtsstaates und einem Abriss seiner
Geschichte gibt diese Einführung detaillierte Auskünfte über die
zentralen Politikfelder:
- Arbeit, Armut und Aktivierung
- Familienpolitik und Familienproduktivität
- Zukunft der Alterssicherung
- Gesundheitssicherung
- Bildungspolitik als Sozialpolitik
- Globalisierung und Sozialpolitik
- Sozialpolitische Reformen
- Sozialpolitische Kultur
Dabei wird die aktuelle deutsche Sozialpolitik stets im
internationalen Zusammenhang betrachtet.
Zum Autor
Michael Opielka, geboren 1956, studierte Rechtswissenschaften,
Erziehungswissenschaft, Philosophie und Ethnologie in Tübingen,
Zürich und Bonn. Promotion in Soziologie an der
Humboldt-Universität Berlin. Seit 1997 Lehrbeauftragter am Seminar
für Soziologie der Universität Bonn, seit 2000 Professor für
Sozialpolitik an der Hochschule Jena. Arbeitsschwerpunkte:
Sozialpolitik, soziologische Theorie, Kultur- und
Religionssoziologie, Sozialpädagogik, Familienforschung,
Psychoanalyse.
Verlagsinformation |
|
|
Karl Marx/Friedrich Engels:
Studienausgabe in 5 Bänden.
Bd.2 Politische Ökonomie. Herausgegeben von Iring Fetscher. Aufbau-Taschenbuch-Verlag
2004.
ISBN: 3-7466-8126-X. |
|
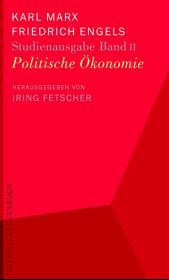
mehr Infos
bestellen |
Auszüge aus Marx' "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten", den
"Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie", das berühmte
erste Buch des "Kapital", Engels: "Umrisse zu einer Kritik der
Nationalökonomie" u.a.
Verlagsinformation |
|
|
Udo Ulfkotte: Der Krieg in
unseren Städten.
Wie radikale Islamisten Deutschland unterwandern.
Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004 (Aktualisierte Neuausgabe). ISBN:
3-596-16340-4. |
|
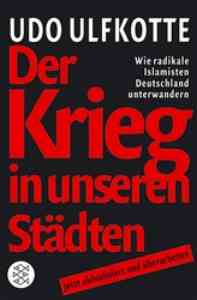
mehr
Infos
bestellen
|
Tatort Deutschland – Terror im Namen Gottes? Deutschland wird
unterwandert. Gewaltbereite Islamisten tarnen sich als friedliche
Muslime, errichten ein geheimes Netzwerk und pflegen beste
Beziehungen zur Al Qaida, Hamas, Hisbollah und anderen
Terrorgruppen. Bestsellerautor Udo Ulfkotte hat erstmals dieses
Netzwerk der Islamisten mithilfe exklusiver und brisanter
Informationen von deutschen Sicherheitsbehörden enttarnt. Er nennt
Namen von Personen, Familien und Organisationen, die zum Angriff
auf unseren Rechtsstaat rüsten. Ihr Ziel: ein islamischer
Gottesstaat.
Wie weit verzweigt die Netzwerke verschiedener militanter
islamistischer Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland bereits
heute sind – dies zeigt der Bestsellerautor Udo Ulfkotte in seinem
aufwändig recherchierten Buch.
Verlagsinformation |
|
|
Aleida Assmann/Ulrich Gaier/Gisela
Trommsdorff (Hrsg.): Positionen der Kulturanthropologie.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-29324-9. |
|
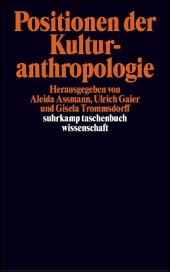
mehr
Infos
bestellen
|
Anders
als die klassische Anthropologie geht es der noch jungen Disziplin
der Kulturanthropologie nicht um den Menschen im allgemeinen und
sein unabhängig von historischen und kulturellen Prägungen
konstituiertes "Wesen", sondern um die unterschiedlichen
Menschenbilder, die sich im Verlauf der Diskursgeschichte
herausgebildet haben. Im Vordergrund stehen dabei die materiellen,
ideellen und medialen Grundlagen ihrer Entstehung, ihre Wirkung
und ihre mitunter gewaltsame Durchsetzung. Darüber hinaus
interessiert sich diese literarisch informierte und
kulturwissenschaftlich interessierte Anthropologie auch für die
Körpergeschichte, d. h. für die physischen und psychischen
Voraussetzungen des Menschen, die den verschiedenen kulturellen
Forderungen und Formungen immer wieder Grenzen setzen. Aus dieser
doppelten Perspektive widmen sich die Aufsätze dieses
interdisziplinär angelegten Bandes dem Zusammenhang zwischen
"Literatur" und "Anthropologie". Als Leitmotiv fungiert dabei die
Frage, wie sich das Studium der Literatur für die Grundfrage nach
dem Menschen in seinen historischen und kulturellen Bedingungen
fruchtbar machen lässt.
Verlagsinformation |
|
|
November
2004 |
|
|
|
Gilles
Kepel: Das Schwarzbuch des Dschihad. Aufstieg und
Niedergang des Islamismus. Mit einem Vorwort zur deutschen
Ausgabe. Piper-Verlag 2004. ISBN: 3-492-24248-0. |
|
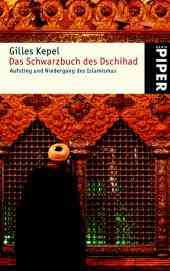
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Seit dem terroristischen Angriff auf die USA im Herbst 2001 fragt
sich die Welt, was der Islamismus ist und welche Gefahr von ihm
ausgeht. Gilles Kepel zieht aus seiner jahrelangen Beschäftigung
mit dem Thema einen aufsehenerregenden Schluss: Die Expansion des
militanten Islamismus hat ihren Höhepunkt überschritten, er ist im
Niedergang begriffen. Mit bestechender Sachkenntnis stellt Kepel
in diesem Buch die Entwicklung aller wichtigen
radikal-islamistischen Organisationen weltweit dar und gibt tiefe
Einblicke in die fremde und so wichtige Welt des islamischen
Fundamentalismus. Wer wissen will, wie sich die islamische Welt
entwickeln wird, für den ist dieses kompetente und höchst
lesenswerte Buch unverzichtbar.
Rezension
"Ein fundierter und detaillierter Überblick über die
Entwicklung und die regionalen Ausformungen des Islamismus." (NZZ)
Zum Autor
Gilles Kepel, geboren 1955, studierte Soziologie und Arabistik,
ist Professor für Politische Studien am Institut d'Etudes
Politique in Paris und hatte zahlreiche Gastprofessuren inne. Er
gilt als einer der renommiertesten Forscher zum Thema des
islamischen Fundamentalismus.
Verlagsinformation |
|
|
Hans
Leyendecker: Die Korruptionsfalle. Wie unser Land im Filz
versinkt. rororo Taschenbücher Nr.61550. Rowohlt-Verlag 2004
(Aktualisierte Ausgabe). ISBN: 3-499-61550-9. |
|
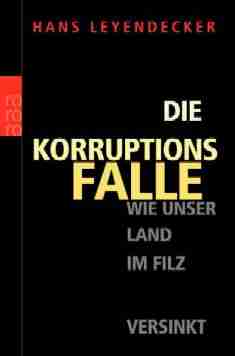
mehr Infos
bestellen
|
Korruption hat sich in Deutschland metastasenartig ausgebreitet.
Angestellte werden bestochen, Manager leiten Unsummen in die
eigene Tasche und Politiker werden "beatmet", wie Schmieren im
Jargon der Eingeweihten heißt. Ob Parteispenden oder
Industrieskandale, ob schwarze Kassen oder Postenwirtschaft – das
Monster, mit dem sich etliche Staatsanwälte derzeit rumzuschlagen
haben, stammt nicht aus Sizilien oder Abu Dhabi; die Deutschen
selbst haben es erschaffen. Hans Leyendecker, "Star" des
investigativen Journalismus, ohne den etliche Skandale, etwa die
Flick- und die Kohl-Affäre, nicht ans Licht gekommen wären,
spricht sogar von einem flächendeckenden Korruptionssystem – und
zeigt, dass es eine ernsthafte Bedrohung für unser Land ist.
Anhand von großen Fällen – bekannten wie bislang unbekannten –
legt er die Funktionsweise dieser "Schattenordnung" frei. Und er
fragt: Wie können wir verhindern, dass die Korruptionsfalle
endgültig zuschnappt? Oder haben wir uns mit den mafiösen
Verhältnissen in Deutschland längst abgefunden?
Verlagsinformation |
|
|
Gerhard Schulze: Die beste aller Welten. Wohin bewegt sich
die Gesellschaft im 21. Jahrhundert? Fischer-Taschenbuch-Verlag
2004. ISBN: 3-596-16385-4. |
|
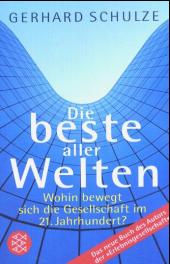
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Nach seinem durchschlagenden Erfolg "Die Erlebnisgesellschaft"
entwirft Gerhard Schulze in seinem neuen Buch das Bild einer
Gesellschaft, die nicht mehr vom Prinzip der permanenten
Steigerung dominiert wird. Das Gefüge der Werte verschiebt sich
und die Menschen beginnen eine neue Richtung einzuschlagen: Fragen
der Lebenskunst, des Zusammenlebens und der Kultur werden
wichtiger genommen als zuvor.
Zum Autor
Gerhard Schulze ist Professor für Empirische Sozialforschung an
der Universität in Bamberg.
Verlagsinformation |
|
|
Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?
Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-596-16384-6. |
|
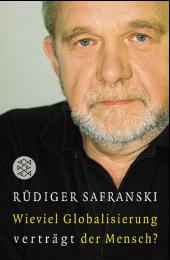
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Das Denken selbst gerät in eine Globalisierungsfalle: Wie
beherrscht man das Globale, fragen die einen, und wie rettet man
es, fragen die anderen. Rüdiger Safranski ermutigt, Freiräume für
Gleichgewicht und Handlungsfähigkeit zu schaffen, denn
Globalisierung lässt sich nur gestalten, wenn darüber nicht die
andere große Aufgabe versäumt wird: das Individuum, also sich
selbst zu gestalten.
Zum Autor
Rüdiger Safranski, geboren 1945, Philosoph und Schriftsteller,
lebt in Berlin. Er veröffentlichte Biographien über E. T. A.
Hoffmann,
Schopenhauer (2001) und Heidegger sowie den großen
philosophischen Essay "Wie
viel Wahrheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und Lebbare"
(1990). In der Reihe "Philosophiejetzt!" ist von ihm der Band über
Schopenhauer (1998) erschienen.
Verlagsinformation
|
|
|
Armin Nassehi/Gerd Nollmann
(Hrsg.): Bourdieu und Luhmann: Ein Theorienvergleich.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-29296-X. |
|
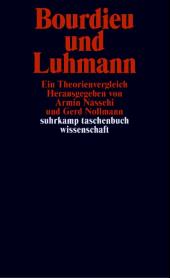
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann stellen für die Soziologie die
beiden anregendsten Denker der jüngeren Vergangenheit dar.
Dabei sind sie offensichtlich mit höchst unterschiedlichen
Arbeitsweisen an ihren Gegenstand herangetreten. Bourdieu etwa
gilt als Klassiker der Ungleichheitsforschung, während Luhmann
Ungleichheit stiefmütterlich behandelte. Luhmann war ein
begeisterter Begriffsarbeiter, während Bourdieu die Ausarbeitung
eines Kategoriengebäudes als Abfallprodukt seiner empirischen
Arbeit ansah. Die Beiträge dieses Bandes loten die vielfältigen
Konvergenzen und Divergenzen in den Arbeiten der beiden
Theoretiker aus mit dem Ziel, zu einer wechselseitigen Erhellung
ihrer Werke zu führen.
Zum Autor
Dr. Armin Nassehi ist Professor für Soziologie am Institut für
Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Gerd Nollmann,
Dr. phil., arbeitete als Lektor und Programmleiter im Verlagswesen
und ist wiss. Assistent am Soziologischen Institut der Universität
Duisburg-Essen.
Verlagsinformation |
|
|
Oktober 2004 |
|
|
|
Rudolf Sievers (Edit.): 1968 – Eine Enzyklopädie.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12241-X. |
|
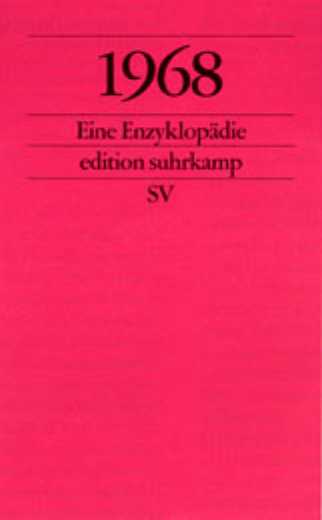
mehr Infos
bestellen |
Es ist
zur Mode geworden, sich in immer kürzer werdenden Abständen über
bestimmte historische Ereignisse oder Lebensformen zu definieren.
Alle jenen "Generationen" gemein ist allerdings der –
sympathisierende oder abgrenzende – Bezug auf die 68er. Dieser
Generation werden die abenteuerlichsten Dinge zugeschrieben:
Gewalt gegen Sachen und Personen, ja teilweise sogar der
Terrorismus der RAF.
Im Jahre 1968 sprachen die Aktivisten von sich nicht als 68er,
sondern als APO, also als außerparlamentarische Opposition. Um die
politische Einstellung der APO und ihrer Aktivisten authentisch
vor Augen zu stellen, versammelt Rudolf Sievers jene Texte, die
die Aktionen der APO beeinflussten. Hier ist also zu erfahren, was
die außerparlamentarische Opposition 1968 und davor las. Hier ist
zu erfahren, wie die Situationisten Politik machen wollten. Hier
ist zu erfahren, welche Änderungen die Hochschulen erfahren
sollten. Was hatte es mit dem "Tod der Literatur" auf sich? Warum
die Anti-Springer-Demonstrationen, auf denen Vietcong-Fahnen
geschwenkt wurden und an deren vorderster Front Peter Weiss und
Gaston Salvatore neben Rudi Dutschke marschierten? Was hätte es
bedeutet, wenn wie in Paris im Mai 1968 die Phantasie die Macht
errungen hätte, und was hätte es bedeutet, wenn die politische
Führung der ČSSR entsprechend dem Manifest der 2.000 Worte
gehandelt hätte? Warum wandte man sich gegen repressive Toleranz?
Rudolf Sievers hat mit diesem Band also ganz unbescheiden eine
Enzyklopädie des Denkens der außerparlamentarischen Opposition
versammelt. Dieses Buch stellt die wichtigsten Texte zur
Verfügung, die damals prägend waren – und die auch heute noch,
über das historische Interesse hinaus, von Belang sind.
Verlagsinformation |
|
|
September
2004 |
|
|
|
John Rawls: Geschichte der Moralphilosophie. Hume, Leibniz,
Kant, Hegel. Suhrkamp-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN:
3-518-29326-5. |
|
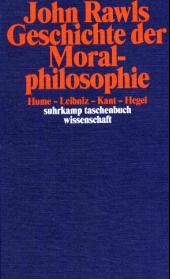
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
John Rawls
ist fraglos der bedeutendste US-amerikanische Philosoph im Bereich
der politischen Philosophie und der Moralphilosophie. Seine
"Theorie der Gerechtigkeit" gehört zu den großen und höchst
einflussreichen philosophischen Büchern der Gegenwart.
Endlich liegt nun das Manuskript, das als Mitschrift unter der
Hand zirkulierte und einen fast mythischen Ruf hatte, als Buch
vor: Rawls' Geschichte der Moralphilosophie vereinigt seine
Vorlesungen an der Harvard University, durch deren Schule eine
ganze Generation amerikanischer wie kontinentaler Philosophen
gegangen ist, und verbindet eine Relektüre der Klassiker der
Moralphilosophie mit einer Neubestimmung der Moralphilosophie als
solcher.
In Rawls' subtilen wie aufregenden Interpretationen kanonischer
Texte von Hume, Leibniz, Kant und Hegel profilieren sich sowohl
eine Geschichte der Moralphilosophie als auch eine Perspektive auf
aktuelle Fragen und Probleme. Seine überraschenden und präzisen
Deutungen der zentralen Texte der moralphilosophischen Tradition
erweisen in brillanter Weise die Aktualität der Klassiker und sind
zudem luzide Beispiele einer seltenen Tugend: Tradition und
Aktualität, subtile Rekonstruktion der jeweiligen
Theoriearchitektur und die systematische Bedeutung des einzelnen
Textes aufeinander zu beziehen und wechselseitig zu erhellen.
Zum Autor
John
Rawls (1921-2002) war Professor für Philosophie an der Harvard
University.
Verlagsinformation |
|
|
Joachim Beerhorst/Alex Demirovic/Michael Guggemos (Hrsg.):
Kritische Theorie im gesellschaftlichen Strukturwandel.
Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12382-3. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Die
Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft sind so zahlreich wie die
Diagnosen ihrer Ursachen: Postfordismus, europäische Integration,
Sozialstaatlichkeit sind nur einige der Themen, die von
zahlreichen Gesellschaftstheorien auf je eigene Weise erklärt
werden. Doch nur die kritische Gesellschaftstheorie hat ihrem
Anspruch nach den Gesamtprozess der gesellschaftlichen Formation
vor Augen. Der vorliegende Band versucht aus dieser Perspektive
viele Veränderungen im kleinen zusammen mit größeren Tendenzen auf
den verschiedenen Niveaus der Gesellschaft so zu verbinden, dass
ein Verständnis des inneren und widersprüchlichen Zusammenhangs
der Phänomene, Erfahrungen und Entwicklungen entsteht.
Zu einem der Herausgeber
Alex Demirovic, geboren 1952, ist Privatdozent für
Politikwissenschaft an der Universität Frankfurt/M.; 1990 bis 1998
Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung; vertritt zur Zeit die
Professur für allgemeine und politische Soziologie an der
Bergischen Universität Wuppertal.
Verlagsinformation |
|
|
August 2004 |
|
|
|
Chalmers Johnson: Der Selbstmord der
amerikanischen Demokratie. Goldmann-Verlag 2004. ISBN:
3-442-15324-7. |
|
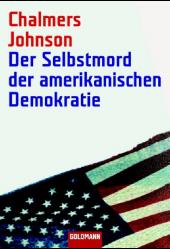
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die
Vereinigten Staaten zur Kolonialmacht: Sie okkupierten Guam,
Hawaii, die Philippinen, Puerto Rico. Durch den "Erwerb" dieser
strategisch wichtigen Stützpunkte schafften sie sich weltweit
einen geopolitischen wie militärischen Einfluss, der noch wuchs,
als nach dem Ende des 2. Weltkriegs zwei Blöcke entstanden. Nun
saßen die USA in Westeuropa, in Japan und
Südkorea, kontrollierten wichtige Wirtschaftszweige, drückten
fremden Regierungen ihren Stempel auf.
Beklemmend ist die
militärische Präsenz der Amerikaner: In 139 Staaten haben sie 211.000
Soldaten stationiert, 26.000 Soldaten tun
Dienst auf Schlachtschiffen auf allen Weltmeeren. Und keine
Regierung der betroffenen Länder kann über diese befreundete
Besatzungsmacht Kontrolle ausüben. So wurde in den vergangenen
Jahrzehnten aus einem Land, das als Wiege der Demokratie gilt, ein
Imperium, das mit wachsendem Einfluss seine demokratischen
Grundwerte und Überzeugungen über Bord warf. Der Autor überzieht
diese Politik, die zynisch die Überlegenheit der Supermacht
betont, mit harter Kritik. Die Verachtung der "Bush-Krieger" für
die UNO, ihr Widerstand gegen das Kyoto-Protokoll, die Ablehnung
des Internationalen Strafgerichtshofs sind Beweise für ihre
pervertierte Haltung zu den Grundwerten der US-amerikanischen
Verfassung.
Zum Autor
Chalmers Johnson, 1931 in Phoenix/Arizona
geboren, lehrte von 1962 bis 1992 an der University of
California in Berkeley und San Diego Politikwissenschaft.
Er ist Präsident des "Japan Policy Research Institute", lebt in
Cardiff/Kalifornien und verfasste mehrere Bücher, u.a. "Ein
Imperium verfällt" (2001) und "Der
Selbstmord der amerikanischen Demokratie" (2003).
Verlagsinformation |
| |
|
Pierre Bourdieu: Meditationen. Zur Kritik der
scholastischen Vernunft. Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-29295-1. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der Anthropologe und Soziologe Pierre Bourdieu beschäftigt sich in
seinen Meditationen mit den Grundthemen des abendländischen
Denkens: der Vorstellung und den Wissenschaften vom Menschen sowie
den Voraussetzungen des künstlerischen Schaffens und der
philosophischen Reflexion. Im Durchgang durch die impliziten
Prämissen allen Denkens entfaltet Bourdieu eine negative
Philosophie, die die Ansprüche auf Wahrheit und die
Unterscheidungen zwischen Subjekt und Objekt – also zentrale
Kategorien abendländischer Philosophie – auf ihre
Geltungsvoraussetzungen befragt. Am Ende steht die These, die
Pascal in Worte gekleidet hat, dass "die wahre Philosophie über
die Philosophie spottet".
Zum Autor
Pierre Bourdieu war Professor für Soziologie am Collège de France
in Paris und Herausgeber der Zeitschrift "Actes de la recherche en
sciences sociales". Der Autor verstarb im Januar 2002.
Verlagsinformation |
|
|
Gunter Hofmann: Abschiede, Anfänge. Die Bundesrepublik.
Eine Anatomie. Ausgezeichnet mit dem Preis "Das politische Buch"
2003 der Friedrich-Ebert-Stiftung. Piper-Verlag 2004
(Aktualisierte Neuausgabe). ISBN: 3-492-24099-2. |
|
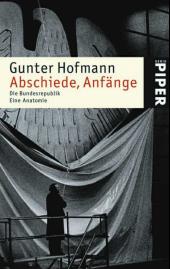
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Ist die
Bundesrepublik wirklich erstarrt, ängstlich und unregierbar?
Gunter Hofmanns Gegenthese lautet: Die Bundesrepublik regiert sich
weitgehend selbst. Sie ist zur Zivilgesellschaft geworden, auf die
man sich im Zweifel mehr verlassen kann als auf ihre Politiker.
Hofmanns Geschichte der Bundesrepublik ist eine brillant
geschriebene Analyse, die einen Bogen von den Anfängen der Bonner
Republik bis zur rot/grün regierten Berliner Republik schlägt.
Rezension
"Ein Buch, das so etwas wie eine Standardlektüre zur politischen
und moralischen Befindlichkeit der Deutschen eingangs dieses
Jahrhunderts werden kann." (Deutschlandfunk)
Verlagsinformation |
|
|
Juli 2004 |
|
|
|
Gret Haller: Die Grenzen der Solidarität. Europa und die USA im
Umgang mit Staat, Nation und Religion. Aufbau-Taschenbuch-Verlag
2004. ISBN: 3-7466-8108-1.
|
|
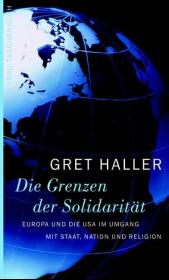
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
"Die
Grenzen der Solidarität" diskutiert die historischen Wurzeln der
großen, eklatanten Unterschiede im Rechts-, Staats- und
Politikverständnis von Westeuropäern und US-Amerikanern. Sie
stellt damit auch die seit dem 11. September erneut viel
beschworene westliche Wertegemeinschaft in Frage. Gret Haller
ermutigt mit ihrem Buch die Europäer, die Tradition der Aufklärung
und damit ihre eigene Identität nicht preiszugeben.
Rezension
Sein Lob für dieses Buch von Gret Haller, die bis zum Jahr 2000
als Ombudsfrau für Menschenrechte tätig war, fasst Rezensent Claus
Leggewie in eine teilweise verwirrende Besprechung. Nicht immer
lässt sich klar unterscheiden, wo Hallers Analyse aufhört und
Leggewies Argumentation beginnt. Klar wird jedoch, dass Haller mit
"Die Grenzen der Solidarität" eine ausgesprochen kritische
Bestandsaufnahme der Wiederaufbaupolitik in Bosnien-Herzegowina
liefert, die Leggewie durchaus überzeugend findet. Ihre zentrale
These fasst er so, "dass die Vorherrschaft der USA im
Friedensprozess einen dauerhaften Frieden in Bosnien und
Herzegowina unmöglich gemacht hat". Schuld daran trägt, wie
Leggewie Hallers Gedankengang paraphrasiert, ein amerikanisches
Verständnis von Staat und Politik, das – im Unterschied zum
europäischen – ethnischen und religiösen Partikularismen zu viel
Raum gebe und damit eine Institutionalisierung von universalen
Normen und Werten verhindert habe. (Zusammenfassung der Rezension
von Klaus Leggewie in der taz vom 29.04.2003 auf Perlentaucher.de)
Zur Autorin
Gret Haller, geb. 1947 in Zürich, zunächst als Anwältin tätig.
1984-1988 Mitglied der Regierung der Stadt Bern. 1987-1994
Mitglied des Schweizerischen Parlamentes sowie der
Parlamentarischen Versammlungen des Europarates und der OSZE,
1993/94 Präsidentin des Schweizerischen Parlamentes. 1994-1996
Botschafterin der Schweiz beim Europarat in Straßburg, 1996-2000
Ombudsfrau für Menschenrechte des Staates Bosnien und Herzegowina
in Sarajevo, gewählt durch die OSZE. Zahlreiche Buch- und
Zeitschriftenpublikationen zur Gleichstellung von Mann und Frau,
zu Menschenrechten und Menschenrechtskultur.
Verlagsinformation
Weitere Informationen
-
Interview mit Gret Haller über Europa und die USA (Senior-Web,
Schweiz)
-
Zusammenfassung von Rezensionen (Perlentaucher.de) |
|
|
Volker Perthes: Geheime Gärten. Die neue
arabische Welt. Goldmann-Verlag 2004 (Erweiterte Ausgabe). ISBN:
3-442-15274-7. |
|
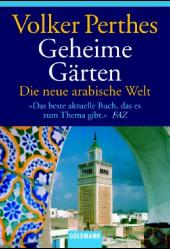
mehr Infos
bestellen |
Von
außen erscheint die arabische Welt einerseits bedrohlich,
andererseits eigentümlich statisch. Doch die Staaten des Nahen und
Mittleren Ostens wie Nordafrikas befinden sich in einer
historischen Umbruchphase, auch wenn der arabisch-israelische
Friedensprozess zu stagnieren scheint. Der Krieg um Kuwait, der
Friedensprozess im Nahen Osten haben die Beziehungen der Länder
zueinander in Bewegung gebracht; es gibt neue weltwirtschaftliche
Herausforderungen und Integrationsversuche, die die Region vor
völlig neue Fragen stellen. Der Tod langjähriger Herrscher wie
König Hussein von Jordanien, König Hassan von Marokko und
Präsident Assad von Syrien hat in der arabischen Welt einen
Generationenwechsel eingeleitet, der innerhalb eines Jahrzehnts zu
einem vollständigen Austausch der politischen Führungseliten
–
nicht nur der Könige und Präsidenten
–
führen wird.
Perthes untersucht die Faktoren des Wandels in den wichtigsten
Staaten dieser Region. Er fragt dabei nach den Chancen der
wirtschaftlichen wie der politischen Erneuerung. Der Nahe und
Mittlere Osten entwickelt sich mittelfristig sicher nicht zu einer
europäischen Demokratie. Er wird aber pluralistischer, und die
neuen Führungen sind daran interessiert, ihre Länder
wirtschaftlich stärker zu öffnen, besonders Europa gegenüber.
Fraglich bleibt, ob diese Generation
in der Lage sein wird, innergesellschaftliche und
zwischenstaatliche Konflikte erfolgreicher zu bewältigen als
vorangegangene Generationen. Die Frage von Krieg und Frieden
bleibt nicht nur nach außen hin virulent.
Der Nahostexperte Volker Perthes widmet der Region eine
tiefgehende Analyse – eines der besten aktuellen Bücher, das es
zum Thema gibt. Er beschreibt die Reformbemühungen der Regierungen
und ordnet sie ein. Seine Prognosen sind vorsichtig optimistisch,
so hofft er etwa für die Zukunft auf einen "autoritären
Pluralismus“. Im Irak werde bald eine "Wachablösung" stattfinden,
in der die Söhne ihre Väter ersetzen. Doch das werde nur gelingen,
wenn sich die neuen Herrscher wenigstens ein Stück von ihren
Vätern entfernt haben.
"Das beste aktuelle Buch, das es zum Thema gibt." (FAZ)
Verlagsinformation |
|
|
Peter Gay: Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur in der
Weimarer Zeit 1918-1933. Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004
(Neuausgabe). ISBN: 3-596-15950-4. |
|
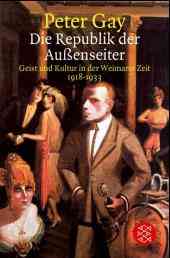
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
"Es ist Peter Gay gelungen, ein ebenso lebendiges und buntes wie
vielseitiges Bild... der Weimarer Epoche zu entwerfen." (FAZ)
Zum Autor
Peter Gay ist emeritierter Sterling-Professor für Geschichte der
Yale University und Direktor des Dorothy and Lewis B. Calman-Centers
für Wissenschaftler und Schriftsteller an der New York Public
Library. Werkauswahl: "Erziehung der Sinne. Sexualität im
bürgerlichen Zeitalter", "Die Zarte Leidenschaft. Liebe im
bürgerlichen Zeitalter", "Der Kult der Gewalt. Aggression im
bürgerlichen Zeitalter", "Die Macht des Herzens. Das 19.
Jahrhundert und die Erforschung des Lichts".
Verlagsinformation |
|
|
Juni 2004 |
|
|
|
Jürgen Habermas: Der gespaltene Westen. Suhrkamp-Verlag 2004.
ISBN: 978-3-518-12383-6. |
|
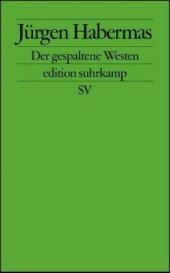
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Das Kantische Projekt kann nur dann eine Fortsetzung finden, wenn
die USA zu ihrem nach 1918 und nach 1945 energisch vertretenen
Internationalismus zurückkehren und erneut die historische Rolle
eines Schrittmachers auf dem Wege der Evolution des Völkerrechts
zu einem "weltbürgerlichen" Zustand übernehmen.
Der einig geglaubte Westen ist gespalten. Jedoch nicht die Gefahr
des internationalen Terrorismus hat diese Entwicklung verursacht,
sondern eine Politik der US-Regierung, die das Völkerrecht
ignoriert, die Vereinten Nationen an den Rand drängt und den Bruch
mit Europa in Kauf nimmt. Die Spaltung zieht sich auch durch
Europa und durch die USA selbst hindurch. In Deutschland wirkt die
Abkehr der US-Administration und der US-Eliten von ihren eigenen
Traditionen wie ein Lackmustest. Heute zerfällt die chemische
Verbindung, aus der die Westorientierung der Bundesrepublik seit
Adenauer bestanden hat, in ihre beiden Elemente: opportunistische
Anpassung an die hegemoniale Macht trennt sich von intellektueller
und moralischer Bindung an die Prinzipien einer westlichen Kultur.
Auch im Jahr seines 75. Geburtstags erweist sich der politische
Denker Habermas wieder als brillanter Analytiker und
Stichwortgeber der Republik und des europäischen Geistes. "Der
gespaltene Westen" versammelt Beiträge, die infolge der Ereignisse
vom 11. September 2001 entstanden, darunter der neue, weit
ausgreifende Essay über die Zukunft des Kantischen Projekts einer
weltbürgerlichen Ordnung.
Zum Autor
Jürgen Habermas, 1929 in Düsseldorf geboren, studierte 1949-54 an
den Universitäten Göttingen, Zürich und Bonn Philosophie,
Psychologie, Deutsche Literatur und Ökonomie. Nach seiner
Promotion in Bonn arbeitete Habermas zunächst als freier
Journalist, bis er 1956 von dem aus dem Exil zurückgekehrten
Theodor W. Adorno zur Mitarbeit am wiedereröffneten Institut für
Sozialforschung in Frankfurt/Main eingeladen wird. 1983-94 war er
Professor für Philosophie in Frankfurt/Main mit dem Schwerpunkt
Sozial- und Geschichtsphilosophie, seitdem emeritiert. Habermas
publizierte zahlreiche Werke und erhielt viele Auszeichnungen.
Zu seinen wichtigsten Werken gehören die "Theorie des
kommunikativen Handelns" (1981) und "Strukturwandel der
Öffentlichkeit" (1962).
Verlagsinformation |
|
|
Walter van Rossum: Meine Sonntage mit 'Sabine Christiansen'.
Wie das Palaver uns regiert. Kiepenheuer & Witsch-Verlag 2004.
ISBN: 3-462-03394-8. |
|
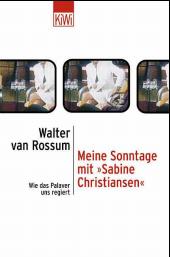
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Allsonntäglich entfaltet sich ab 20 Uhr die neue deutsche
TV-Dreifaltigkeit: Tagesschau, Tatort, Talk mit Sabine
Christiansen. Nach den Mythen der Tagesschau (Staatsmänner,
Kriege, Katastrophen, Sport) und den tröstlichen Gewissheiten des
Tatorts (Alle haben Dreck am Stecken) sondiert Sabine Christiansen
das Gesellschaftsterrain. Unerbittlich stellt sie Fragen, die in
das Dunkel unserer Zukunft weisen. Es treten auf: die Lobbyisten
und ihre Statthalter im Parlament. Multimillionäre warnen davor,
dass es kurz vor zwölf sei. Aber, bitte sehr, man könne ja auch
ins Ausland gehen. Politiker führen entschlossen das Drama der
Sachzwänge auf. Die große Koalition der Dauerreformer gibt sich
die Ehre. Fast noch wichtiger als das, was gesagt wird, ist, was
systematisch nicht gesagt wird. Komplexe Themen werden dramatisch
vereinfacht und fortan in diese Richtung öffentlich diskutiert.
Insofern eignet sich diese Sendung wie keine andere, um zu
begreifen, wohin die Deutschland AG steuert.
In 'Meine Sonntage mit "Sabine Christiansen"' schreibt Walter van
Rossum hellsichtig, intelligent und bitterböse über eine
Medienlandschaft, die die Politik im eigentlichen Sinne längst zu
überwuchern droht.
Zum Autor
Walter van Rossum, Jg. 1954, lebt in Köln und Marokko. Studium der
Romanistik, Philosophie und Geschichte in Köln und Paris.,Promotion 1989. Seit 1981 freier Autor für WDR, Deutschlandfunk,
Die Zeit, FAZ und Freitag. Für den WDR moderiert er unter anderem
die "Funkhausgespräche". 1988 erhielt er den
Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik. Letzte
Buchveröffentlichung: "Simone
de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Die Kunst der Nähe" (1998).
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Mai
2004 |
|
|
|
Walter Siebel: Die europäische Stadt. Suhrkamp-Verlag 2004.
ISBN: 3-518-12323-8. |
|
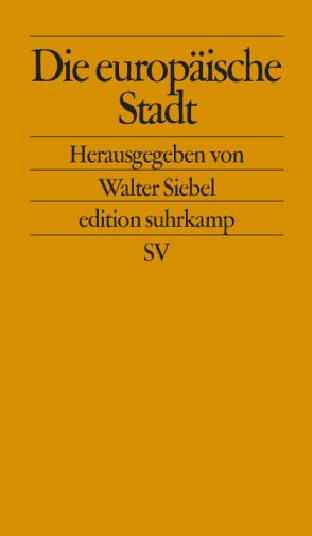
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
In den kurzen goldenen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg schien
die europäische Stadt der Modellfall eines sozial ausgeglichenen,
kulturell integrierten und prosperierenden Gemeinwesens. Heute
wird ihr Ende vorhergesagt. Ihre Gestalt verliert sich in einem
gesichtslosen Siedlungsbrei. Der öffentliche Raum wird
privatisiert. Leerstehende Wohnungen und Industriebrachen reißen
Lücken in das städtische Gefüge. Es entstehen abgeschottete
Quartiere der Armen und der Einwanderer. Die Globalisierung, die
Macht der Immobilienentwickler und die Finanzmisere stellen die
europäische Stadt als eine Bastion des Wohlfahrtsstaats in Frage.
Aber es gibt auch soziale, kulturelle, ökonomische und politische
Gegentendenzen. Sie werden in diesem Band diskutiert, der sich an
Stadtplaner, Stadtpolitiker und alle stadtpolitisch Interessierten
ebenso richtet wie an Architekten und Sozialwissenschaftler.
Beiträge lieferten u.a. Dieter Läpple, Peter Marcuse, Enzo
Mingione, Claus Offe, Saskia Sassen, Thomas Sieverts und Erika
Spiegel.
Zum Autor
Walter Siebel ist Professor am Institut für Soziologie der Carl
von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Schwerpunkt Stadt- und
Regionalforschung und Leiter der AG Stadtforschung.
Verlagsinformation |
|
|
Johann Dieckmann: Luhmann-Lehrbuch. UTB/Wilhelm-Fink-Verlag 2004.
ISBN: 3-8252-2486-4. |
|
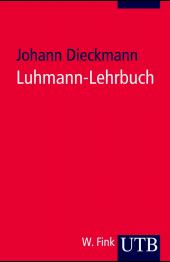
mehr
Infos
bestellen
|
Dieser
Band führt Anfänger wie Fortgeschrittene systematisch in das
Denken des einflussreichen Sozialwissenschaftlers Niklas Luhmann
ein. Die Darstellung ist klar und verständlich, ohne dabei
übermäßig zu vereinfachen. Der Autor stellt ausgewählte Positionen
Luhmanns mit ihren Schlüsselbegriffen vor: System/Umwelt,
Selbstregulierung, Kausalität, unmarked state, Beobachtung,
Widerspruch, re-entry u. a. Die zentralen Analysen der
Systemtheorien werden zusammengefasst: Rechtssystem, Wirtschaft,
Kunst, Massenmedien. Merksätze, Zusammenfassungen, Glossar und
kommentierte Literaturhinweise machen den Band zu einem echten
Studienbuch.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
April 2004 |
|
|
|
Britta Bannenberg/Wolfgang J. Schaupensteiner: Korruption in
Deutschland. Portrait einer Wachstumsbranche. C.H. Beck-Verlag
2004. ISBN: 3-406-51066-3. |
|
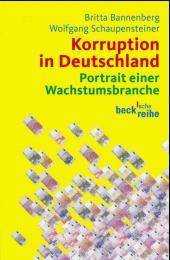
mehr
Infos
bestellen
|
Korruption ist effektiv, attraktiv und lukrativ. Das haben auch
Entscheidungsträger in unserer staatlichen Verwaltung und Politik
erkannt. Nicht nur in Abu Dhabi oder Sizilien, sondern längst auch
in Deutschland bestechen Verbandsfunktionäre und Bauunternehmer
Beamte und Politiker. Schmiergeldzahlungen sind in vielen Branchen
bereits Teil der Geschäftspolitik und fügen dem Fiskus jährlich
Schäden in Milliardenhöhe zu. Unbemerkt von Justiz und
Öffentlichkeit konnten weit verzweigte Beziehungsgeflechte
heranwachsen, weil Korruption in deutschen Amtsstuben
jahrzehntelang tabuisiert wurde. Anhand zahlreicher Originalfälle
stellen die Autoren die schillernden Facetten von Bestechung und
Bestechlichkeit anschaulich dar. Sie machen deutlich, dass es sich
hier nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein flächendeckendes
Kriminalitätsphänomen, das die Grundfesten staatlicher Autorität
und das Prinzip des freien Wettbewerbs erschüttert.
Verlagsinformation
|
|
|
Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie
der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2004 (4. Auflage).
ISBN: 3-423-34084-3.
|
|
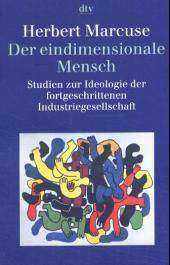
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Herbert Marcuse bezeichnet die hoch industrialisierte Gesellschaft
und den in ihr lebenden Menschen als "eindimensional", weil er
einen lückenlosen Zusammenhang von Manipulation und Konformismus
sieht, der das in sich widersprüchliche kapitalistische System
stabilisiert, die Menschen durch Konsum korrumpiert und alle
Kritik absorbiert.
Um diese Eindimensionalität aufzubrechen, eine neue, weniger
herrschaftlich strukturierte Gesellschaft zu bilden, bedarf es der
Einsicht der scheinbar Freien in ihre Unfreiheit, in ihre
Manipuliertheit durch Werbung, Ökonomie und Massenmedien. Die
scharfsichtige Studie, die erstmals 1964 erschien, hat das
kritische Bewusstsein einer ganzen Generation stark beeinflusst
und ist heute ein Standardwerk.
Verlagsinformation
Zum Autor
Herbert Marcuse, US-amerikanischer Philosoph und Soziologe dt.
Herkunft, geboren 1898 in Berlin, gestorben 1979 in Starnberg
(Bayern). Wichtigstes Werk: "Der eindimensionale Mensch" (1964);
Herbert Marcuse war der Spiritus Rector der
'68er-Studentenrevolte, weil er an eine Übersetzbarkeit der
Vernunft in Geschichte glaubte und zugleich, als Philosoph und
Soziologe, einer der führenden Köpfe der kritischen Theorie war.
1898 als Sohn einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Berlin
geboren, studierte Marcuse nach der Schulzeit Philosophie in
Freiburg und Berlin. 1924 gehörte er mit Max Horkheimer und Erich
Fromm zu den Gründungsmitgliedern des renommierten Instituts für
Sozialforschung. Daraus ging die sog. Frankfurter Schule hervor,
zu deren prominentesten Vertretern Marcuse zählte. Marcuse verließ
Deutschland 1932. Über Genf und Paris erreichte er 1934 New York.
Zunächst Mitarbeiter am inzwischen ebenfalls in den USA ansässigen
Institute of Social Research, trat er 1942, als US-amerikanischer
Staatsbürger, in die US-Spionageabwehrbehörde (OSS) ein, in der er
die Europaabteilung übernahm. 1951 kehrte er an die Universität
zurück; 1965 erhielt er einen Lehrstuhl an der Universität von
Kalifornien und eine Honorarprofessur an der FU Berlin. Biografie:
Heinz Jansohn: "Herbert Marcuse" (1982).
Quelle:
Harenberg: Das Buch der tausend Bücher |
|
|
Wilfried Röhrich: Die Macht der Religionen. Glaubenskonflikte in der
Weltpolitik. C.H. Beck-Verlag 2004. ISBN: 3-406-51090-6. |
|
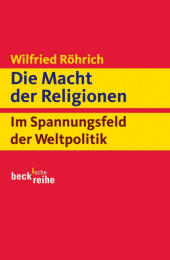
mehr
Infos
bestellen
|
Die
Weltreligionen haben eine Macht erlangt, die in ihrer Tragweite
der der Zeit der Kreuzzüge oder der islamischen Expansion nahe
kommt. Diese Macht nimmt in den Glaubenskonflikten der Weltpolitik
konkrete Gestalt an. Das vorliegende Buch untersucht nicht nur den
Konflikt zwischen dem Islam und dem (amerikanischen) Christentum;
neben der bekannten Auseinandersetzung zwischen dem israelischen
Judentum und dem Islam bestehen z.B. massive Probleme zwischen dem
Islam und dem Hinduismus im Kaschmirkonflikt und der nicht weniger
grundsätzliche Streit zwischen den buddhistischen Singhalesen und
den hinduistischen Tamilen auf Sri Lanka. Das Buch bietet einen
eindrucksvollen Überblick über die religiösen Konfliktherde und
zeigt die Prämissen und Perspektiven für einen interreligiösen
Dialog auf.
Verlagsinformation |
|
|
Jochen Hörisch: Gott, Geld und Medien. Studien zur Medialität der
Welt. Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12363-7. |
|
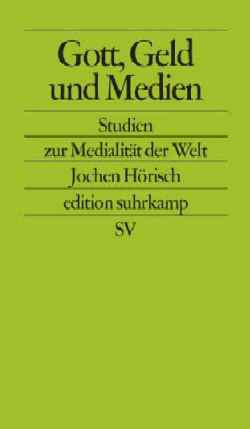
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Am 11. September 2001 wurden mit terroristischer Überdeutlichkeit
drei voneinander weit entfernt scheinende Sphären aufeinander
bezogen: Im Namen Gottes wurde das hochsymbolische Zentrum des
internationalen Geldverkehrs medientauglich in Schutt und Asche
gelegt. Gott, Geld und Medien stehen aber nicht erst seit diesem
Terrorakt in einem intimen Spannungsverhältnis zueinander. Die
Studien von Jochen Hörisch gehen der Geschichte und der
Tiefenstruktur theologischer, monetärer und medialer Grammatiken
nach und vertiefen die Analysen, die in den Bänden "Brot und Wein
– Die Poesie des Abendmahls" , "Kopf oder Zahl – Die Poesie des
Geldes" und "Ende der Vorstellung – Die Poesie der Medien"
vorgestellt wurden.
Ihr Befund ist frappant: Gott, Geld und Medien stehen deshalb in
einem so scharfen Konkurrenzverhältnis zueinander, weil sie so
viele Gemeinsamkeiten haben: "Die drei leistungsstarken, weil
paradoxie-sensiblen Leitmedien Religion, Geld und Medien bzw., um
in metonymischer Verdichtung zu formulieren, Hostie, Münze und
CD-ROM sorgen für die elastischen und ineinander konvertierbaren
Integrale, die die abendländisch-christlichen bzw. westlichen
Gesellschaften und Kulturen zusammenhalten." (Jürgen Hörisch,
Ausschnitt)
Zum Autor
Jochen Hörisch, geboren 1951 in Bad Oldesloe, ist Professor für
Neuer Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim.
Verlagsinformation |
|
|
Ulrike M. Meinhof: Die Würde des Menschen ist antastbar. Aufsätze und
Polemiken. Mit einem Nachwort von Klaus Wagenbach.
Wagenbach-Verlag 2004. ISBN: 3-8031-2491-3. |
|
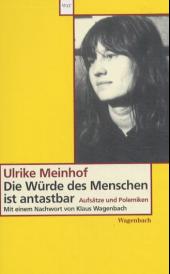
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Diese Ausgabe sammelt alle wichtigen Texte Ulrike Meinhofs aus den
Jahren 1959 bis 1969: Beispiele eines entschiedenen Journalismus,
der nicht von den Höhen der Macht skandiert, sondern den
politischen Widerspruch aufzufinden versteht. Mit Ausnahme der
Aufsätze "Provinz und klein kariert" sowie "Falsches Bewußtsein"
erschienen sie alle in der Zeitschrift KONKRET, in der Ulrike
Marie Meinhof von 1962 bis 1964 Chefredakteurin war.
Diese Auswahl von Kolumnen, Berichten, Reportagen und Polemiken,
deren Schwerpunkt auf den programmatischen Texten liegt, wurde
wenige Jahre nach ihrem Tod zusammengestellt. Die Texte sind
ungekürzt, datiert und (bis auf stillschweigende
Rechtschreibkorrekturen) unverändert. Sie lesen sich heute als ein Abriss
deutscher Nachkriegsgeschichte und ihrer Deformationen: Meinhof
analysiert die Unfähigkeit wirklicher Verarbeitung des Nazismus
und die eilige Rekonstruktion der Macht, sie beschreibt das
Verkümmern der Demokratie am Fall des Einzelnen – seine Würde wird
antastbar.
"Meinhofs Texte sind nicht akrobatisch. Sie überzeugen meist durch
ruhigen Ernst, Gründlichkeit der Überlegung und eine Sprache, in
der jedes Wort auf die Sache passt." (KONKRET)
Zur Autorin
Ulrike Marie Meinhof, 1934 in Oldenburg geboren, war von 1959 bis
1969 Mitarbeiterin der Zeitschrift KONKRET. 1970 ging sie in den
Untergrund, wurde 1972 verhaftet und starb 1976 im Gefängnis
Stuttgart-Stammheim.
Verlagsinformation |
|
|
Paul Nolte: Generation Reform. Jenseits der blockierten
Republik. C.H. Beck-Verlag 2004. ISBN: 3-406-51089-2. |
|
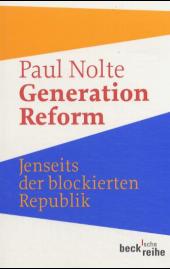
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Deutschland braucht dringend grundlegende Reformen - doch wohin
diese Reformen eigentlich führen sollen, das scheint selbst vielen
Politikern nicht recht klar zu sein. Paul Nolte analysiert die
Schieflagen und Sackgassen, in die wir in den letzten Jahr-zehnten
hineingesteuert sind, und plädiert für eine neue
Bürgergesellschaft, in der Individualismus, Initiative und
Verantwortung nicht im Gegensatz zu einer solidarischen
Gemeinschaft stehen. Seine klaren und manchmal provokativen Thesen
über die Zumutungen, die wir uns alle in diesem Reformprozess
gefallen lassen müssen, sorgen für Zündstoff in einer scheinbar
ausgelaugten Debatte. Gegen die ängstliche Verteidigung von
Besitzständen ebenso wie gegen die Leichtigkeit der
Spaßgesellschaft artikuliert sich hier die wache intellektuelle
Stimme einer "Generation Reform".
Zum Autor
Paul Nolte, geboren 1963, studierte Geschichtswissenschaft und
Soziologie in Düsseldorf, Bielefeld und Baltimore. 1993/94 war er
Fellow an der Harvard University, 1998/99 am Wissenschaftskolleg
zu Berlin. Seit 2001 ist er Professor für Geschichte an der
International University Bremen. Er lehrt und forscht im Bereich
der Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte vor allem Deutschlands
und der USA seit dem 18. Jahrhundert. Seine politischen und
sozialkritischen Essays haben in den letzten Jahren breite
Aufmerksamkeit in Öffentlichkeit und Politik gefunden. Von ihm
liegt bei C.H. Beck vor: "Die
Ordnung der deutschen Gesellschaft" (2000).
Verlagsinformation |
|
|
|
|
März
2004 |
|
|
|
Rolf Hofmeier/Andreas
Mehler (Hrsg.): Kleines Afrika-Lexikon.
Politik, Wirtschaft, Kultur. C.H. Beck-Verlag
2004. ISBN: 3-406-51071-X. |
|
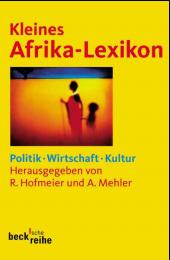
mehr
Infos
bestellen
|
Auf der Grundlage langjähriger wissenschaftlicher und praktischer
Erfahrungen entwerfen die Autoren ein breites Panorama der
verschiedenen Länder und Regionen Afrikas. Sie bieten in kompakter
Form einen Überblick über die aktuelle Situation in allen Staaten,
Territorien und Regionalorganisationen. Die Erläuterung zentraler
Begriffe und Themen der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft,
Entwicklungshilfe, aber auch der internationalen Beziehungen und
Kultur vermitteln ein umfassendes Bild von Vergangenheit und
Gegenwart des heutigen Afrika.
Ein ausführliches Stichwortregister sowie Kurzbiographien der
wichtigsten Persönlichkeiten Afrikas runden den Band ab.
Verlagsinformation |
|
|
Florian Rötzer/Rudolf
Maresch (Hrsg.): Renaissance der Utopie: Zukunftsfiguren des
21. Jahrhunderts. Suhrkamp-Verlag
2004.
ISBN: 3-518-12360-2. |
|
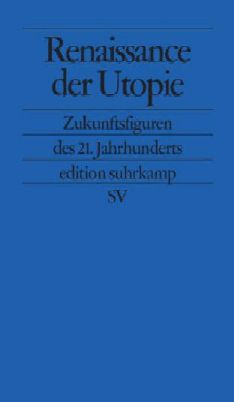
mehr Infos
bestellen
|
Utopien scheinen außer Mode. Kriege, ökologische Katastrophen und
zunehmende Ungleichheiten nähren Apathie und Pessimismus. Zwar
gibt es Stimmen, die bekunden, dass eine
andere Welt möglich sei, doch es fehlen Visionen, die aus der
Gegenwart tragen. Vergangene Utopien sind hauptsächlich deswegen
gescheitert, weil sie die Komplexität der sozialen Evolution und
die Widersprüche der menschlichen Natur nicht beachtet haben. Hier
setzt der Band an. Ihm geht es darum, einfache, aber realistische
Utopien anzureißen, die Science und Fiction narrativ aufeinander
beziehen. Die Aufmerksamkeit der Autorinnen und Autoren, darunter
Francis Heylighen, Peter Glotz, Claus Leggewie und Gundolf
Freyermuth, richtet sich dabei nicht bloß auf die neuen
Crossover-Wissenschaften, auf Maschinen-, Bio- und
Netzwerktechnologien, sondern auch auf die klassischen Bereiche
der Utopie, auf Politik, Arbeit und Gesellschaft.
Verlagsinformation |
|
|
Jerry Mander/Edward Goldsmith
(Hrsg.): Schwarzbuch Globalisierung. Eine
fatale Entwicklung mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern.
Goldmann-Verlag 2004. ISBN:
3-442-15263-1. |
|
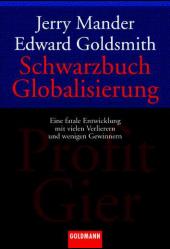
mehr Infos
bestellen |
Zum Buch
Fundierte Beiträge international profilierter
GlobalisierungskritikerInnen machen das Schwarzbuch zu einem
Grundlagenwerk. Es mahnt, dass nicht die Forcierung einer globalen
Freihandelszone, sondern nur die Stärkung lokaler
Wirtschaftsformen die Grundlage für soziale Sicherheit, kulturelle
Vielfalt und den nachhaltigen Schutz der Ressourcen schafft.
Jerry Mander und Edward Goldsmith
versammeln in ihrem Buch die internationale Crème der
Globalisierungskritiker aus den Bereichen Wirtschaft,
Landwirtschaft, Finanzwesen, Kultur und Umwelt. In ihren Analysen
zeigen sie auf, dass die heute praktizierte Form der
Globalisierung in vielen Bereichen das Gegenteil von dem bewirkt,
was ihre Befürworter versprechen. Nach temporärem Anstieg des
Wohlstands speziell in den Wirtschaftswunderjahren 1950-1980 ist
die Einkommensschere in den vergangenen zwei Jahrzehnten
dramatisch auseinandergegangen. Milliarden Menschen weltweit raubt
der globale Handel mit Gütern und Dienstleistungen ihre
funktionierenden Wirtschafts- und Sozialstrukturen. Armut und
Elend sowie die Zerstörung der kulturellen Vielfalt und eine
großflächige Vernichtung natürlicher Ressourcen gehören zu den
Folgen.
Die vorliegende Ausgabe enthält u.a. Originalbeiträge von Carl
Amery (Philosoph), Naomi Klein (Autorin von "No
Logo"), José Lutzenberger (ehemaliger
brasilianischer Umweltminister), Wolfgang Sachs (Wuppertal
Institut), Hermann Scheer
(SPD-Umweltexperte und Präsident von Eurosolar)
und Vandana Shiva (Indische Globalisierungskritikerin).
"Schwarzbuch Globalisierung": DAS
Grundlagenwerk für alle, denen reiner Materialismus als Vision für
das 21. Jahrhundert nicht genügt.
"Wer wissen will, was die Globalisierungskritiker
wollen, der bekommt es hier aus den radikalen Quellen ... Ein
Arsenal von Zahlen, Argumenten und Ideen, mit deren Hilfe der
Kampf um die 'Volkssouveränität' geführt wird." (Aus der
Einleitung)
Zu den Herausgebern
Edward Goldsmith ist
Autor und Mitautor einer Reihe von Büchern, die sich mit Fragen
der ökologischen und sozialen Entwicklung befassen. 1969 gründete
er die Zeitschrift "The Ecologist", heute Europas führendes
Umweltmagazin. Er lehrte an mehreren Universitäten und ist
Mitglied des International Forum on Globalization (IFG), einer
Vereinigung von sechzig Organisationen aus zwanzig Ländern, die
Aufklärung über Fragen der globalen Wirtschaft betreibt sowie
Kampagnen organisiert.
Jerry Mander
studierte an der Business School der Columbia Universität und
leitete in den sechziger Jahren eine große Werbeagentur in San
Francisco, ehe er seine Talente für Kampagnen zum Schutz der
Umwelt einsetzte. 1971 gründete er Public Interest Communications,
die erste gemeinnützige Werbeagentur für sozial- und
umweltpolitische Aktionsgruppen. Darüber hinaus verfasste er
zahlreiche Bücher. Heute ist er Präsident des International Forum
on Globalization, Programmdirektor der Foundation for Deep Ecology
und Mitglied des Public Media Center, einem gemeinnützigen
Werbeunternehmen für soziale und Umweltfragen.
Verlagsinformation/Michael Kraus |
|
|
Sebastian Haffner: Das Leben der Fußgänger.
Feuilletons 1933-1938. Herausgegeben von Jürgen P. Schmied.
Hanser-Verlag 2004. ISBN: 3-446-20490-3. |
|
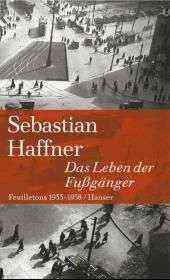
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der andere Haffner: Als junger Feuilletonist berichtete er über Leben
und Lebensgefühl der 30er Jahre. Komische Glossen stehen neben
Reiseskizzen, Kindheitserinnerungen und skeptischen Betrachtungen
über moderne technische Errungenschaften. Und wer genau liest,
wird immer wieder Hinweise finden auf Haffners sicheres Gespür für
die Katastrophe, auf die Deutschland in diesen Jahren zusteuerte.
Leseprobe
Zum Autor
Sebastian Haffner, geboren 1907 in Berlin, emigrierte 1938 nach England, wo
er mit "Germany: Jekyll & Hyde" eine scharfsinnige Analyse zum
zeitgenössischen Deutschland schrieb. 1954 kehrte er nach
Deutschland zurück. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die
"Anmerkungen zu Hitler",
"Von Bismarck zu Hitler"
und
"Der
Verrat – Deutschland 1918/1919". Sebastian Haffner starb sechs Tage
nach seinem 91. Geburtstag 1999 in Berlin.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Februar 2004 |
|
|
|
Martin L. Hofmann/Tobias F. Korta/Sibylle
Niekisch (Hrsg.): Culture Club.
Suhrkamp-Verlag 2004.
ISBN: 3-518-29268-4. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
"Kultur" ist zur
Zauberformel unserer Gegenwart geworden. Von Popkultur über
Unternehmenskultur bis zur Kultur des Krieges hat sich der Begriff
in die verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhänge
eingeschlichen. Für ein genaueres Verständnis der Bedeutung des
Kulturbegriffs ist allerdings eine Kenntnis seiner pluralen
Traditionslinien von entscheidender Bedeutung. Der vorliegende
Band bietet eine Orientierung durch einen Überblick in das Werk
und Denken zentraler Kulturtheoretiker von Freud, Simmel und
Cassirer bis hin zu Luhmann, Bourdieu, Butler und Latour.
Zu den HerausgeberInnen
Martin Ludwig Hofmann ist Soziologe und
Journalist, Tobias E. Korta Soziologe und Verwaltungsbeamter.
Sibylle Niekisch, geboren 1973, studierte an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Soziologie und
Ethnologie. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Medientheorie,
Populärkultur, Kultursoziologie, Ethnologie und Cultural Studies.
Verlagsinformation |
|
|
Francis Fukuyama: Das Ende des Menschen. Deutscher
Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-423-34070-3. |
|
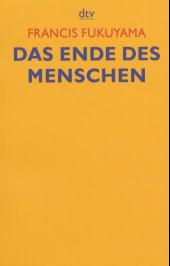
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Vielleicht
können wir bald alle über 100 Jahre alt werden und unsere
Nachkommen genetisch manipuliert werden. Mit welchen Folgen?
Bestsellerautor Francis Fukuyama warnt eindringlich vor den
Auswirkungen der Biotechnologien auf unsere demokratische
Gesellschaft.
Aldous Huxley
hatte recht. In seinem Roman 'Schöne neue Welt' entwarf er die
Vision von einer Gesellschaft, in der alle zufrieden
gestellt sind – um den Preis, dass
Menschlichkeit verloren ist.
Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Immer mehr Menschen
wünschen sich schon jetzt, ihre Intelligenz, das Gedächtnis, ihre
emotionale Empfindungsfähigkeit und Sexualität zu stärken. Noch
wählen sie nicht die Gentechnik, sondern nehmen Psychopharmaka,
Drogen, um sich den Wunsch nach einem
sorgen- und angstfreien Leben zu erfüllen. Fukuyamas These ist, dass
sich eine Mehrheit der Menschen mittels Gentechnik perfektionieren
möchte. Dies wirft dramatische Fragen nach der politischen Ordnung
zukünftiger Gesellschaften auf. Fukuyama warnt eindringlich davor,
Menschen bedenkenlos gentechnisch zu designen, und mahnt die
politisch Handelnden zur Umkehr.
Zum Autor
Francis Fukuyama, geboren 1952 in Chicago, gehört zu den
herausragenden geschichtsphilosophischen Denkern unserer Zeit.
Sein Buch über das "Ende der Geschichte" fand weltweit breites
Echo. Fukuyama lehrt Politische Ökonomie an der Johns Hopkins
Universität in Baltimore.
Verlagsinformation
|
|
|
|
|
Januar 2004 |
|
|
|
Mike Davis: Ökologie der Angst. Das
Leben mit der Katastrophe. Piper-Verlag
2004. ISBN: 3-492-23819-X. |
|
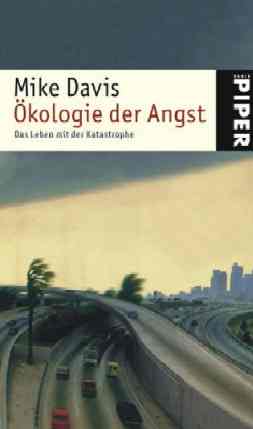
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
In Los Angeles, einst der Garten Eden im Land des
ewigen Sonnenscheins, macht sich Angst breit. In den
letzten Jahrzehnten wurde die Stadt von
einer Reihe alttestamentarisch anmutender
Katastrophen heimgesucht: Sturmfluten, Tornados,
Erdbeben, Dürre. Zugleich wird lustvoll in
Dutzenden von Filmen und Romanen der Untergang der
Großstadt an der US-amerikanischen Westküste
fiktiv inszeniert. Doch was steht eigentlich hinter diesen
Endzeitvisionen?
Am Beispiel der Megalopolis Los Angeles analysiert der
Soziologe und herausragende Interpret der modernen
Großstadt, Mike Davis, wie ein größenwahnsinniger
Urbanismus Katastrophen gebiert und zugleich von ihnen ablenkt.
Davis enthüllt in seinem Buch den engen
Zusammenhang zwischen ökologischen Todsünden, sozialer
Ungerechtigkeit und einer Stadtentwicklung, die allein den
Marktgesetzen folgt. Dabei wird klar: Die drohende
ökologische wie soziale Apokalypse ist hausgemacht. Ein
unentbehrliches Buch für alle, die sich für die Zukunft unserer
Städte interessieren.
"L.A. braucht Leute wie Mike Davis, deren Fantasie das ergänzt,
was in der Wirklichkeit nicht mehr oder noch nicht sichtbar ist."
(DIE ZEIT)
Zum Autor
Mike Davis, geboren 1946, arbeitete als Fernfahrer und im
Schlachthof, studierte Ökonomie und schrieb 1990 "City of Quartz.
Ausgrabungen der Zukunft in Los Angeles" (dt.
Ausgabe 1999), das heute als Klassiker gilt. Er lehrt
Stadtsoziologie an der University of California, Irvine. Außerdem
liegen auf deutsch vor: "Casino
Zombies. Und andere Fabeln aus dem Neon-Westen der USA" (dt.
Ausgabe 1999) und "Die Geburt der
Dritten Welt" (dt.
Ausgabe 2004).
Verlagsinformation
Weitere Informationen
Mike Davis über
den Supermarktstreik in Südkalifornien (a+k Nr. 480 vom
16.01.2004)
|
|
|
Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.):
Deutsche Zustände: Folge
2. Suhrkamp-Verlag 2003. ISBN:
3-518-12332-7. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Die Reihe "Deutsche Zustände" untersucht Erscheinungsweisen,
Ursachen und Entwicklungen "Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit" wie Rassismus, Antisemitismus,
Fremdenfeindlichkeit, Heterophobie (gegen Obdachlose,
Homosexuelle, Muslime etc.) und Sexismus, wobei wissenschaftliche
Analysen mit exemplarischen Fallgeschichten, Essays und Interviews
verbunden werden.
In dieser zweiten Folge bildet das Problem der
Demokratieentleerung einen Schwerpunkt. Zu klären ist, inwieweit
mit der Schwächung demokratischen Selbstverständnisses eine
Qualitätsverschiebung der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
einhergeht. Weitere Analysen betreffen unter
anderem die Islamfeindlichkeit in der Bevölkerung und die
Frage, welche Rolle Bildung in diesem
Zusammenhang spielt. Bei den Fallgeschichten werden einige aus dem
ersten Band
fortgeschrieben. Die Essays beschäftigen sich unter
anderem mit Illegalen in Deutschland, mit Gewalt gegen
Behinderte sowie der Situation der Menschenrechte in Deutschland.
Zum Autor
Wilhelm Heitmeyer ist Professor für Sozialisation an der
Universität Bielefeld und leitet dort das Institut für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Januar – Dezember 2003 |
|
|
|