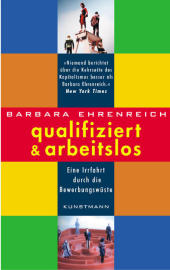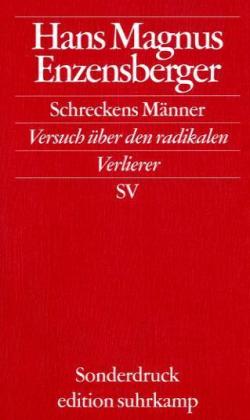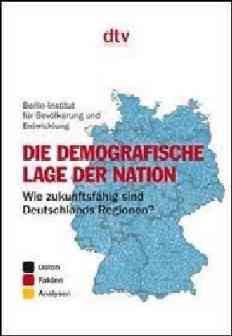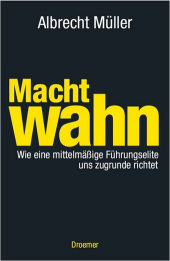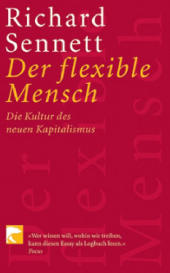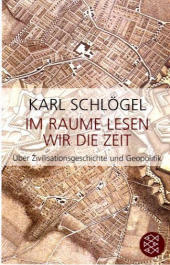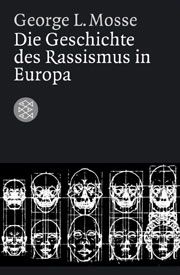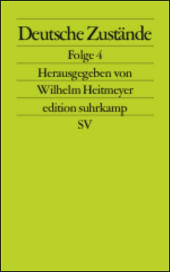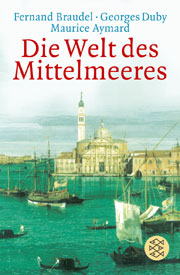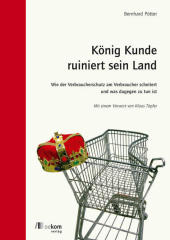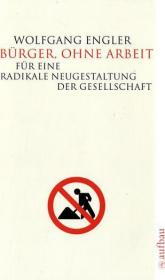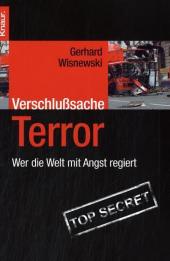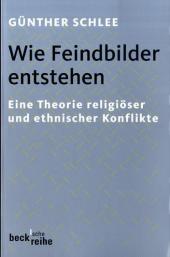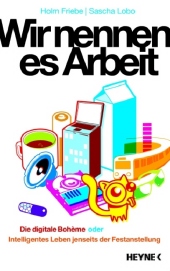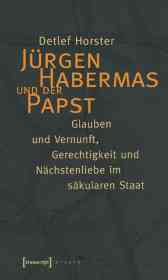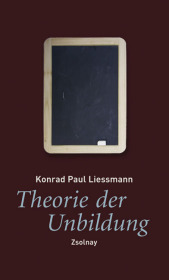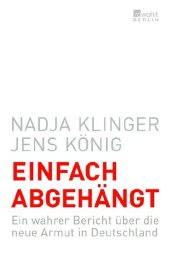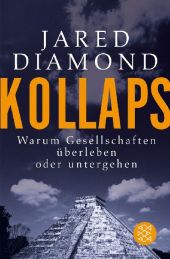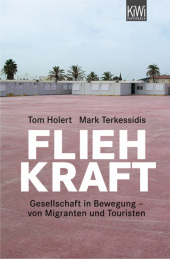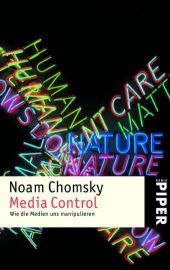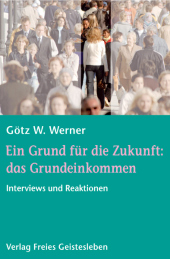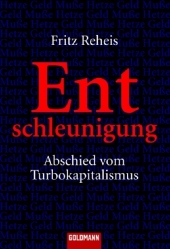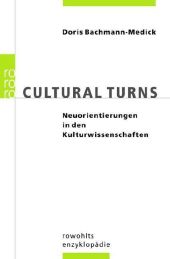|
Dezember
2006 |
|
|
|
Wolfgang Engler: Bürger, ohne
Arbeit.
Für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft.
Aufbau-Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 978-3-7466-7057-7. |
|
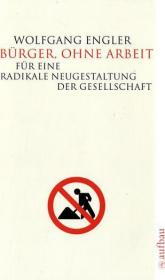
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Wirtschafts- und Sozialethik in Zeiten der Globalisierung:
Vollbeschäftigung ist eine Utopie, die "Sachzwänge" des "freien
Marktes" verschärfen soziale Konflikte. Wolfgang Englers Kritik an
der Herrschaft der Wirtschaft über alle anderen gesellschaftlichen
Sphären und der Selbstentmachtung der Politik mündet in den Appell
an die Bürger, das Ideal einer Gesellschaft selbst bestimmter
Menschen nicht preiszugeben.
Im Zeitalter der dritten industriellen Revolution ist die
Vorstellung, jeder könne ein Leben auf Erwerbsarbeit aufbauen,
anachronistisch geworden. Die Rezepte neoliberaler Ökonomen und
Politiker – Einfrieren der Löhne und Gehälter, expandierende
Arbeitszeit, Mobilmachung der arbeitsfähigen Bevölkerung,
geringere Sozialleistungen bei Teilprivatisierung der
Sozialsysteme – weisen keinen Ausweg aus der Krise. Im Gegenteil,
die wachsende Diskrepanz zwischen Produktivität, Wachstum und
Beschäftigung zehrt die kulturelle Mitgift des Kapitalismus auf:
Zukunftsorientierung, Gemeinsinn, Arbeitsethos über die
Klassenschranken hinweg schwinden.
Auch ohne Arbeit oder weiterführende Ausbildung die Existenz zu
sichern und die persönliche Würde zu wahren wird für immer mehr
Menschen zur wichtigsten Überlebenstechnik. Die Befugnis und die
Macht zur Umkehr liegen nicht bei einer Elite, sondern beim Willen
aller einzelnen, für ihre Bürgerrechte zu kämpfen. Der Umsturz der
vom Staat sanktionierten Wirtschaftsgesellschaft beginnt mit der
Wiederentdeckung der eigenen Urteilskraft als Keimzelle des
Politischen.
Rezensionen
"Auch wenn das Buch keine endgültigen Antworten gibt, wie eine
individuellere, humanere Gesellschaft in Zukunft verwirklicht
werden könnte: Englers Ideen bringen frischen Wind in die
Diskussion um Arbeitslosigkeit und Stellenabbau. Gerade diese neue
Perspektive auf die Probleme unserer Zeit macht "Bürger, ohne
Arbeit" lesenswert." (NDR, März 2005)
"Sein Buch wagt konkrete Vorschläge für ein Umdenken. Er gibt sich
damit genauso angreifbar wie geerdet. [...] Engler wirft Gedanken
in den Ring, die es lohnen, kritisch zu prüfen, wenn es darum
geht, über den Tellerrand der Zustandsbeschreibung zu blicken. Mit
diesem Buch ist ein Anfang gemacht." (Märkische Allgemeine,
12./13.03.2005)
"In seinem facetten- und materialreichen Buch sichtet Engler die
alten bürgerlichen Theorien, die das Lob der Arbeit sangen, und,
nicht ohne rhetorischen Ingrimm, die neueren Diskurse über das
Ende der Arbeitsgesellschaft." (Literaturen 03/2005)
Zum Autor
Wolfgang Engler, geboren 1952 in Dresden, Soziologe, lehrt an der
Schauspielschule ”Ernst Busch” in Berlin. Er publizierte
zahlreiche Studien über Lebensformen in Ost und West und kritische
Analysen über die Moderne, Demokratie sowie den Wandel des
Politischen und der Öffentlichkeit in den industriellen
Massengesellschaften. Jüngste Buchveröffentlichungen sind: "Die
zivilisatorische Lücke. Versuche über den Staatssozialismus" und
"Die ungewollte Moderne. Ost-West-Passagen".
Verlagsinformation
|
|
|
Gerhard Wisnewski:
Verschlusssache Terror. Wer die Welt mit Angst regiert. Top
Secret. Droemer/Knaur-Verlag 2006. ISBN: 978-3-426-77932-3. |
|
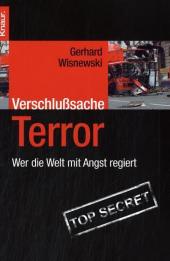
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Seit dem 11. September 2001 werden die Sicherheitsapparate immer
mehr ausgebaut – neue Anschläge konnten sie trotzdem nicht
verhindern. Warum nicht? Mit kriminalistischem Spürsinn analysiert
Gerhard Wisnewski die Anschläge von Madrid und London. Und er
entwirft ein beklemmend realistisches Szenario, in dem die
Terroristen nur Handlanger in einem viel größeren Plan sind. Soll
im Windschatten von Terroranschlägen und Kriegen unsere Demokratie
zerstört und ein autoritäres Regime errichtet werden?
Zum Autor
Gerhard Wisnewski, geboren 1959, Studium der
Politikwissenschaften. Seit 1986 freier Autor, Schriftsteller und
Dokumentarfilmer. Mehrere Buchveröffentlichungen. Auszeichnungen
2000 mit dem 3sat-Zuschauerpreis und dem Adolf-Grimme-Preis.
Verlagsinformation
|
|
|
November
2006 |
|
|
|
Günther Schlee: Wie Feindbilder
entstehen. Eine Theorie religiöser und ethnischer Konflikte.
C.H. Beck-Verlag 2006. ISBN: 3-406-54743-5. |
|
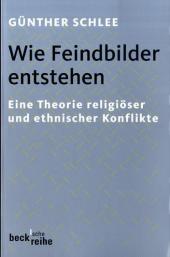
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Als Hauptursachen von Konflikten zwischen Gesellschaften oder
gesellschaftlichen Gruppen gelten religiöse Unterschiede und
ethnische Zugehörigkeit. Dieses Buch zeigt anhand von Beispielen,
die von Ex-Jugoslawien bis Somalia reichen, dass die wirklichen
Ursachen in der Regel ganz anders gelagert sind. Nutznießer von
kriegerischen Auseinandersetzungen sind meistens wenige, die
jedoch einflussreich genug sind, einen Konflikt auch gegen das
Interesse der großen Mehrheit eskalieren zu lassen.
Dahinter
verbergen sich allzu oft handfeste Auseinandersetzungen um
Bodenschätze, Erwerbsnischen, Ämter und Gehälter. Darüber hinaus
stellt sich die Frage sozialer Identifikation. Nach welchen
Merkmalen bilden Menschen Gruppen, unterscheiden sie zwischen
Freund und Feind, schließen sie Bündnisse oder bilden sie
Koalitionen? Erst die Beantwortung dieser Fragen erlaubt auch die
Entwicklung Erfolg versprechender Strategien der
Konfliktschlichtung.
Zum Autor
Günther Schlee, geboren 1951, ist Direktor des
Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle.
Verlagsinformation
|
|
|
Holm Friebe/Sascha Lobo: Wir nennen
es Arbeit.
Die digitale Bohème oder: Intelligentes Leben jenseits der
Festanstellung. Heyne-Verlag 2006. ISBN: 3-453-12092-2. |
|
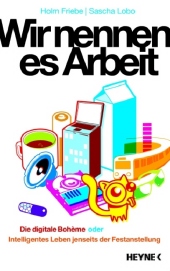
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Sie verzichten dankend auf einen Arbeitsvertrag und verwirklichen
den alten Traum vom selbstbestimmten Leben. Mittels neuer
Technologien kreieren sie ihre eigenen Projekte, Labels und
Betätigungsfelder. Das Internet ist für sie nicht nur Werkzeug und
Spielwiese, sondern Einkommens- und Lebensader: die digitale
Boheme. Ihre Ideen erreichen anders als bei der früheren Boheme
vor allem über das Web ein großes Publikum und finanzieren sich
damit. Ein zeitgemäßer Lebensstil, der sich zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor entwickelt.
Auf Angestellten-Frust kann man mit der Entdeckung der Faulheit
reagieren, wie es Corinne Maier in ihrem Bestseller fordert:
Arbeitszeit absitzen, sicheres Gehalt einstreichen. Die digitale
Boheme repräsentiert die mutigere Alternative: Immer mehr junge
Kreative entscheiden sich für das Leben in Freiheit. Ihr Hauptziel
ist nicht das Geldverdienen, sondern ein selbst bestimmter
Arbeitsstil, der den eigenen Motiven folgt in unsicheren Zeiten
vielleicht die überlegene Strategie. Denn ihre enge Einbindung in
soziale, künstlerische und digitale Netzwerke bringt ständig neue,
teilweise überraschende Erwerbsmöglichkeiten mit sich. Sie
schalten Werbebanner auf ihren Websites, handeln mit virtuellen
Immobilien, lassen sich Projekte sponsern oder verkaufen eine Idee
an einen Konzern. Ihre Produkte und ihre Arbeitsweise verändern
den Charakter der Medien und des Internets, bald auch den der
Gesellschaft.
Holm Friebe und Sascha Lobo porträtieren die digitale Boheme: Sie
stellen erfolgreiche Konzepte und innovative Ansätze vor und
erklären wirtschaftliche, technische und soziale Entwicklungen und
Hintergründe. Ihre spannende Analyse einer zukunftsgewandten
Daseinsform inspiriert dazu, so zu arbeiten, wie man leben will.
Rezension
"Das Buch 'Wir nennen es Arbeit' von Holm Friebe und Sascha Lobo
[...] berichtet von intelligenten Versuchen 'jenseits der
Festanstellung' zu leben. Die beeindruckenden Geschichten aus der
'digitalen Bohème' erzählen von neuen Formen der Arbeitswelt, von
denen, die weder ALG II noch ein festes Gehalt beziehen,
selbstbewusst und ideenreich darauf reagieren, dass es dramatisch
weniger feste Stellen gibt. [...] Als Bericht über die
Bloggerszene und die Welt der Computerspiele ist das Buch hoch
willkommen. Es enthält glänzende Beobachtungen." (Süddeutsche
Zeitung)
Verlagsinformation
|
|
|
Oktober 2006 |
|
|
|
Detlef Horster: Jürgen Habermas
und der Papst.
Glauben und Vernunft, Gerechtigkeit und Nächstenliebe im säkularen
Staat. X-texte zu Kultur und Gesellschaft. transcript-Verlag 2006.
ISBN: 3-89942-411-5. |
|
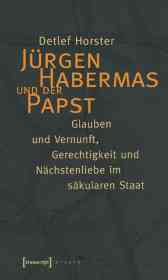
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
In der Gegenwartsgesellschaft dringe die Sprache des Marktes in
alle Poren des Sozialen. Selbst unsere rationale Moral mit ihren
reziproken Rechten und Pflichten sei dem merkantilen
Vertragsprinzip nachgebildet. Darum bringt Habermas das
Moralprinzip Nächstenliebe ins Spiel, das auch zentraler
Gegenstand der ersten Enzyklika des neuen Pontifex ist, die
weltweit hohe Aufmerksamkeit erregt.
Habermas und der spätere Papst waren sich bei ihrem
Zusammentreffen 2004 in ihrer Gesellschaftsanalyse einig und auch
darin, dass Gerechtigkeit hergestellt und darüber hinaus die
Nächstenliebe angemahnt werden müsse. Unterschiedlich sehen beide
allerdings die Rolle der Religion im säkularen Staat. Detlef
Horster setzt sich in seinem Essay kritisch mit den beiden
Positionen auseinander und fragt von einem sozialphilosophischen
Standpunkt aus nach den Möglichkeiten und Grenzen religiöser
Impulse für die Moral der Gegenwart.
Zum Autor
Detlef Horster, geboren 1942, ist Professor für Sozialphilosophie
an der Universität Hannover. Er studierte Philosophie,
Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie in Köln und
Frankfurt am Main. 1976 promovierte er im Fach Soziologie.
Zahlreiche Veröffentlichungen u.a. auch Einführungen zu Ernst
Bloch und Jürgen Habermas vor.
Verlagsinformation |
|
|
Konrad P. Liessmann: Theorie der
Unbildung.
Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Zsolnay-Verlag 2006. ISBN:
3-552-05382-4. |
|
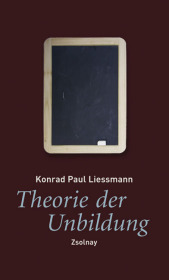
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was weiß die Wissensgesellschaft? Wer wird Millionär? Wirklich
derjenige, der am meisten weiß? Wissen und Bildung sind, so heißt
es, die wichtigsten Ressourcen des rohstoffarmen Europa. Debatten
um mangelnde Qualität von Schulen und Studienbedingungen –
Stichwort Pisa! – haben dennoch heute die Titelseiten erobert. In
seinem hochaktuellen Buch entlarvt der Wiener Philosoph Konrad
Paul Liessmann vieles, was unter dem Titel Wissensgesellschaft
propagiert wird, als rhetorische Geste: Weniger um die Idee von
Bildung gehe es dabei, als um handfeste politische und ökonomische
Interessen. Eine fesselnde Streitschrift wider den Ungeist der
Zeit.
Leseprobe
Wer wird Millionär – oder: Alles, was man wissen muss
Die in Deutschland von einem Privatsender ausgestrahlte Quizshow
"Wer wird Millionär", die in Österreich unter dem Titel
"Millionenshow" vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet
wird, gehört seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten
Formaten dieser Art. Neben dem Erfolg von Dietrich Schwanitz’
Sachbuch-Bestseller "Bildung. Alles, was man wissen muss" und den
Harry-Potter-Romanen von Joanne K. Rowling gehören diese Shows für
viele Kulturoptimisten zu jenen Indizien, die zeigen, dass die
Bildungs- und Leselust der Menschen ungebrochen ist.
Dass sich immer wieder und immer noch Menschen finden, die sich –
durch das Studium von Lexika und einschlägigen Handbüchern mehr
oder weniger gut vorbereitet – vor einem Millionenpublikum einem
Wissenstest stellen, ist in der Tat bemerkenswert. Verantwortlich
dafür mag nicht nur die Aussicht auf den Gewinn sein, auch nicht
nur die Simulation einer Prüfungssituation, deren Beobachtung
immer schon mit beträchtlichem Lustgewinn verbunden war, sondern
auch die Sache selbst, um die es geht: das Wissen. Genau in diesem
Punkt demonstriert diese Show, kulturindustrielles Produkt par
excellence, einiges davon, wie es um das Wissen in der
Wissensgesellschaft bestellt ist.
Die Konstruktion der Show ist denkbar einfach. Einem Kandidaten,
der es nach verschiedenen Vorauswahlverfahren bis ins Zentrum des
Geschehens geschafft hat, werden bis zu fünfzehn Fragen gestellt,
deren Schwierigkeitsgrad mit dem für die richtigen Antworten
ausgesetzten Preisgeld steigt. Im Gegensatz zur herrschenden
Ideologie der Vernetzung wird in dieser Show einzig nach einem
punktuellen Wissen gefragt. Die aus Multiple-Choice-Verfahren
bekannten vorgegebenen Antworten, aus denen eine auszuwählen ist,
ermöglichen nicht nur eine rasche und unmittelbare Reaktion,
sondern zeigen auch in nuce, wo die Grenzen zwischen Raten,
Vermuten, Wissen und Bildung verlaufen.
Dort, wo Kandidaten ihre Wahl mit Formeln wie "Das kommt mir
bekannt vor" oder "Davon habe ich schon einmal gehört" begründen,
triumphiert das Bekannte über das Gewusste, dort, wo mit
Wahrscheinlichem oder Plausibilitäten gearbeitet wird, regieren
Ahnungen und dunkle Erinnerungen, und wenn jemand tatsächlich
etwas weiß, wird als Begründung für die Wahl der Antwort dann auch
folgerichtig gesagt: Das weiß ich.
Ein Hauch von Bildung schleicht sich schließlich dann ein, wenn es
einem Kandidaten gelingt, aufgrund seiner Kenntnisse etwa des
Lateinischen oder gar Griechischen die Bedeutung von ihm an sich
nicht geläufigen Fachausdrücken zu erschließen. Die Show, und das
mag ihre Attraktivität mit bedingen, simuliert so Bewegungen im
Wissensraum, die jeder kennt und nachvollziehen kann: Nur sehr
wenig haben wir verstanden, einiges wissen wir, manches kann
vermutet werden, das meiste ist uns aber nicht geläufig und kann
höchstens erraten werden.
Zum Autor
Konrad Paul Liessmann, geboren 1953 in Villach, studierte
Germanistik, Geschichte und Philosophie in Wien. Er arbeitet als
Professor (am Institut für Philosophie der Universität Wien),
Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Liessmann
veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und Essays
aus den Bereichen der Ästhetik, Kunst- und Kulturphilosophie,
Gesellschafts- und Medientheorie, Technikphilosophie sowie der
Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts.
Verlagsinformation |
|
|
Nadja Klinger/Jens König: Einfach
abgehängt.
Ein wahrer Bericht über die neue Armut in Deutschland.
Rowohlt-Verlag, Berlin 2006. ISBN: 3-87134-552-0. |
|
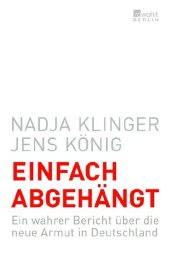
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die neue Unterschicht – ein Land vergisst seine Armen: Was heißt
es, wenn man im Monat von 345 Euro leben muss? Oder wenn man von
30.000 Euro Schulden erdrückt wird? Wie tief fällt ein Ingenieur,
der aus einem scheinbar gesicherten Dasein in die Armut stürzt?
Wie schlägt sich eine Mutter durch, die höchstens 88 Cent für ein
Frühstück ausgeben kann? Oder die vierköpfige Familie, die von
Arbeitslosengeld II lebt?
Nadja Klinger und Jens König porträtieren Menschen, die von der
Gesellschaft abgehängt werden. Denn die Armut in Deutschland
breitet sich immer mehr aus, die Mittelschicht ist vom Abstieg
bedroht – und die Kluft zwischen Arm und Reich groß wie nie. So
hat sich fast unmerklich eine Gruppe gebildet, die beständig
wächst: die neue Unterschicht der Besitz- und Bildungslosen.
Zu ihr zählen Hartz IV-Empfänger genauso wie gescheiterte
Architekten. Die einen sind tief gefallen, die anderen nie
aufgestiegen. Das Buch versammelt eindrucksvolle Porträts und
zugleich eine scharfsinnige Analyse über einen gesellschaftlichen
Skandal, der uns alle in Zukunft mehr interessieren wird, als wir
uns heute eingestehen.
Zu den AutorInnen
Nadja Klinger, geboren 1965 in Berlin, lebt dort als freie
Autorin. Sie schreibt vor allem Porträts und große Reportagen für
den Berliner Tagesspiegel, die taz und das Magazin. 1997 erschien
ihr Buch "Ich ziehe einen Kreis". Für ihre Reportage "Rennen auf
der Stelle" über die Situation einer Hartz-IV-Empfängerin, die
sich umschulen lassen will, ist sie gerade mit dem "Deutschen
Sozialpreis der Wohlfahrtsverbände" ausgezeichnet worden.
Jens König, geboren 1964, ist Journalist. Von 1989 bis 1994 stand
er als Chefredakteur der "Jungen Welt" vor. Heute leitet König das
Parlamentsbüro der Tageszeitung. 2005 erschien sein Buch "Gregor
Gysi. Eine Biographie" (Rowohlt Berlin).
Verlagsinformation |
|
|
Jared Diamond:
Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen.
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2006. ISBN: 3-596-16730-2. |
|
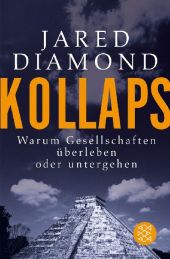
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die überwucherten Tempelruinen von Angkor Wat, die zerfallenden
Pyramiden der Maya in Yucatan und die rätselhaften Moai-Statuen
der Osterinsel, stille Zeugen einstmals blühender Kulturen, aber
auch Mahnmale für heutige Gesellschaften. Wann beginnt das Ende?
Was sind die Warnsignale? Jared Diamond zeichnet die Muster nach,
die zum Untergang von Imperien führen, und zeigt uns, dass die
Zukunft in unserer Hand liegt.
Rezension
"Jared Diamond erzählt nicht nur von menschlichen Gesellschaften,
die untergegangen sind, er erzählt vor allem von denen, die Erfolg
hatten. Er zeigt, welche Faktoren ihnen geholfen haben, und er tut
dies glänzend. Grandioser Lesestoff für alle, die wollen, dass
unsere Geschichte noch lange weitergeht." (Prof. Dr. Ernst
Peter Fischer)
Zum Autor
Jared Diamond, 1938 in Boston geboren, ist Professor für
Geographie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Für
seine Arbeit auf dem Feld der Anthropologie und Genetik ist Jared
Diamond vielfach ausgezeichnet worden. 1994 erschien bei S.
Fischer Der dritte Schimpanse, 1998 sein internationaler
Millionenbestseller Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher
Gesellschaften, für den Jared Diamond den Pulitzer-Preis erhielt.
Verlagsinformation
|
|
|
Tom Holert/Mark Terkessidis:
Fliehkraft. Gesellschaft in Bewegung – von Migranten und
Touristen. Verlag
Kiepenheuer & Witsch 2006. ISBN: 3-462-03743-9. |
|
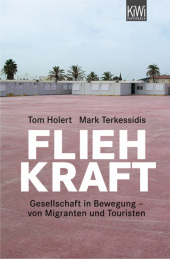
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die Menschheit ist in Bewegung. Grenzüberschreitend. Der Druck der
Migration, notiert die "Süddeutsche Zeitung", wird das Thema dieses
Jahrhunderts werden. Zur gleichen Zeit steigt der Tourismus zum
größten Wirtschaftszweig der Welt auf. Das ist kein Zufall, wie
die Autoren zeigen. Und sie stellen die Frage: Wie verändert sich
die Gesellschaft unter dem Einfluss dieser neuen Mobilität? Für
ihr Buch waren die Autoren entlang der Grenzen Europas unterwegs.
In Spanien, Marokko, Deutschland, Frankreich, Italien, Albanien,
Kroatien und Israel besuchten sie Orte, wo sich die Routen von
Flüchtlingen und Strandurlaubern, von Arbeitsmigranten und
Individualtouristen kreuzen. Sie konnten beobachten, wie auf den
Pfaden der Migranten überall provisorische Unterkünfte und Lager
entstehen. Sie erfuhren, wie Landschaften durch die Bauprojekte
der Tourismusindustrie neu erfunden werden. Und sie sahen das
Wachsen neuer Städte - angetrieben von den Investitionen der
Auswanderer in ihren Herkunftsländern. Heute entsteht eine ganze
Welt von seltsamen Übergangslösungen, eine Welt von saisonal oder
vorübergehend bewohnten Orten, manchmal überfüllt, manchmal
gespenstisch leer. Diese Orte werden im Alltag oft übersehen, aber
sie prägen unsere Lebensweise bereits entscheidend mit. Mit ihren
Recherchen liefern die Autoren die Beschreibung einer
Gesellschaft, die unterwegs ist. Dabei ergeben sich erstaunliche
Parallelen und Übergänge zwischen Visabetrug und Pauschalreise,
zwischen Flüchtlingslager und Feriensiedlung, zwischen
Einwanderungspolitik und Tourismusplanung. Eine neue
Klassengesellschaft bildet sich heraus, in der nur gewinnt, wer
sich den Zugang zu Mobilität sichert. Die Bewegung der Menschen
ist eine Fliehkraft, die unsere Vorstellungen von Demokratie
radikal in Frage stellt.
Zu den Autoren
Tom Holert, geboren 1962, freier Kulturwissenschaftler und
Journalist in Köln, war Redakteur bei "Texte zur Kunst" und
Mitherausgeber von Spex. Heute ist er Autor u.a. für Die
Tageszeitung, Jungle World, Süddeutsche Zeitung, Literaturen und
Artforum. Im Jahr 2000 gab er den Band "Imagineering. Visuelle
Kultur und Politik der Sichtbarkeit" heraus.
Mark Terkessidis, geboren 1966, Diplom-Psychologe, war von 1992
bis 1994 Redakteur der Zeitschrift Spex und arbeitet seitdem als
freier Autor zu den Themen Populärkultur, Identitätsbildung und
Rassismus. Zahlreiche Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation
|
|
|
September
2006 |
|
|
|
Martin L. Hofmann/Tobias F.
Korta/Sibylle Niekisch (Hrsg.): Culture Club, Bd.2:
Klassiker der Kulturtheorie. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN:
3-518-29398-2. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was heißt "Kultur"? Kaum ein anderer Begriff durchzieht die
theoretische Debatte der letzten Jahrzehnte mit solch einer Wucht.
Kulturtheorie ist nicht nur zu einem interdisziplinären, sondern
auch zu einem internationalen intellektuellen Abenteuer geworden.
Auch der zweite Band des Culture Club bietet eine Orientierung in
diesem schwer überschaubaren Feld, indem er einen Überblick über
das jeweilige Werk und Denken zentraler Kulturtheoretiker gibt.
Vorgestellt werden Max Weber, Siegfried Kracauer, Martin
Heidegger, Helmuth Plessner, Margaret Mead, Hannah Arendt,
Marshall McLuhan, Richard Hoggart, Vilem Flusser, Raymond
Williams, Paul Feyerabend, Jean-François Lyotard, Ivan Illich,
Clifford Geertz, Jacques Derrida und Stuart Hall.
Zur Herausgeberin
Sibylle Niekisch, geboren 1973, studierte an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. Soziologie und
Ethnologie. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Medientheorie,
Populärkultur, Kultursoziologie, Ethnologie und Cultural Studies.
Verlagsinformation
|
|
|
August 2006 |
|
|
|
Noam Chomsky: Media Control.
Wie die Medien uns manipulieren. Piper-Verlag 2006. ISBN:
3-492-24653-2. |
|
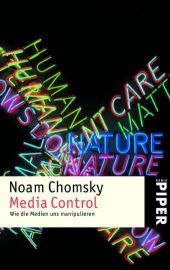
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Nicht erst im Irakkrieg spielten die US-Massenmedien eine fatale
Rolle als Propagandainstrumente der Außenpolitik. Noam Chomsky,
einer der wichtigsten Querdenker der USA, wirft den Medien vor,
unbequeme Tatsachen bereitwillig zu verschleiern und die
Verbrechen des "Feindes" wie mit der Lupe zu betrachten.
Obwohl sie keiner direkten staatlichen Kontrolle unterliegen,
verstehen sich die Massenmedien in den USA nicht als kritische
Gegner, sondern als Partner der Regierung und ihrer hegemonialen
Ziele. "Fern von jeder abgehobenen Medienphilosophie begibt sich
Noam Chomsky auch in die Untiefen der Auseinandersetzung mit den
konkreten Inhalten von politischem Journalismus." (Frankfurter
Rundschau)
Zum Autor
Noam Chomsky, geboren am 7. Dezember 1928, ist seit 1961 als
Professor am Massachusetts Institute of Technology, MIT, tätig;
seine Bücher über Linguistik, Philosophie und Politik erschienen
in allen wichtigen Sprachen der Erde. Noam Chomsky hat seit den
sechziger Jahren unsere Vorstellungen über Sprache und Denken
revolutioniert. Zugleich ist er einer der schärfsten Kritiker der
gegenwärtigen Weltordnung und des US-Imperialismus.
Verlagsinformation
|
|
|
Stephan Leibfried/Michael Zürn
(Hrsg.): Transformationen des Staates?
Edition Zweite Moderne. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-41743-6. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Reform, Zurückdrängung, Abschaffung, Auflösung – wie geht es
weiter mit dem Staat? Wie ist es um seine demokratische
Legitimation, die Rechtsstaatlichkeit in Zukunft bestellt? Kann er
seine klassischen Aufgaben, Sicherheit im Innern und nach außen,
Garantie sozialer Gerechtigkeit, noch erfüllen? Diese Fragen
machen deutlich: Angelegenheiten des angeblich bürgerfernen
Staates treffen in das Zentrum des Alltags des einzelnen.
Von A wie Abfall bis Z wie Zulassung von Fahrzeugen, von äußerer
Sicherheit und Krieg über Verbrechensbekämpfung und Terrorabwehr
zu Nahverkehr und Autobahn und Verbraucher- oder Umweltschutz –
der Staat gilt als all- und endverantwortlich. In seinem "Goldenen
Zeitalter" in den sechziger Jahren des 20.Jahrhunderts vermochte
er diese Aufgaben als souveräner Nationalstaat mit unangetasteter
Legitimität zu bewältigen.
Das ist heute nicht mehr der Fall. Es entsteht zwar weder ein
Weltstaat, noch wird das Gewaltmonopol zum Privateigentum. Aber
der Staat zerfasert unübersehbar: Einzelne Funktionen werden an
internationale Organisationen abgegeben, wieder andere an
Unternehmen.
Die Diagnose der Gegenwart und eine empirisch fundierte Prognose
der Zukunft des Staates sind das Anliegen der neun Untersuchungen,
die zu der Schlussfolgerung gelangen: Wir werden eine Vielzahl von
einschneidenden Transformationen erleben, und es stellt sich die
Frage, ob man den Staat der Zukunft überhaupt noch Staat nennen
kann.
Zu den Herausgebern
Prof. Dr. Stefan Leibfried leitet am Zentrum für Sozialpolitik der
Universität Bremen sowie das DFG-Projekt "Staatlichkeit im Wandel"
(Uni Bremen).
Dr. Michael Zürn leitet seit Oktober 2004 als Direktor die neue
Abteilung "Transnationale Konflikte und Internationale
Institutionen" des WZB. Er wurde 1959 in Esslingen a. N. geboren.
Vor seinem Wechsel ans WZB und der Aufnahme seiner Tätigkeit als
Dean der Hertie School of Governance war er Sprecher des
DFG-Sonderforschungsbereichs "Staatlichkeit im Wandel". Seine
Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit Themen wie
Globalisierung, ihre politische Regelung durch internationale
Institutionen und deren normative Grundlage.
Verlagsinformation
|
|
|
Götz W. Werner: Ein Grund für die
Zukunft: das Grundeinkommen.
Interviews und Reaktionen. 60 Seiten. Verlag Freies Geistesleben
2006. ISBN: 3-7725-1789-7. |
|
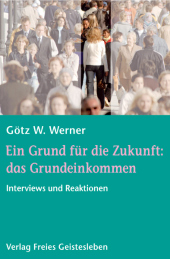
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der Gründer der dm-Drogeriemärkte, Götz W. Werner, tritt in
vielen Vorträgen und Interviews für ein bedingungsloses
Grundeinkommen ein, das alle Bürger erhalten sollen.
Die Einführung eines solchen Einkommens geht das Problem der
Arbeitslosigkeit auf völlig neue Weise an und ermöglicht ein
anderes Verhältnis zur Arbeit. Wie lässt sich ein Bürgergeld
finanzieren, welche Auswirkungen hätte es? Auf diese und viele
weitere Fragen gibt Götz Werner überraschende, aber einleuchtende
Antworten.
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens zielt auf eine
Trennung von Arbeit und Einkommen – ein notwendiger Schritt
angesichts eines veränderten Arbeitsmarkts mit immer weiter
fortschreitender Rationalisierung, damit einher gehenden
Stellenabbaus und eines überforderten Staatshaushalts, der
kulturelle und soziale Angebote immer weniger ermöglichen kann.
Ein Bürgergeld für alle würde hier viele neue Chancen eröffnen.
Wie sich ein solches Einkommen gesellschaftlich und kulturell
auswirken würde, das skizzieren die Beiträge dieses Bandes.
Die Idee des voraussetzungslosen Grundeinkommens ist ein wichtiger
Beitrag zur Gestaltung unserer künftigen Wirtschaft und
Gesellschaft. Ein Bürgergeld für alle wird seit kurzem auch in der
politischen Öffentlichkeit diskutiert, selbst Bundespräsident
Horst Köhler regte an, über "eine Art Grundeinkommen"
nachzudenken. Der weitest gehende Ansatz wird dabei von dem
Unternehmer Prof. Götz Werner vertreten. In Interviews und
Textbeiträgen wird seine Idee des Grundeinkommens vorgestellt.
Auch andere bekannte Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft,
die für ein Bürgergeld werben, kommen im ergänzenden Teil des
Buches zu Wort, u.a. der Leiter des Hamburgischen
Weltwirtschafts-Instituts (HWWI), Prof. Dr. Thomas Straubhaar, der
Steuerfachmann Dr. Benediktus Hardorp sowie der Soziologe und
Hochschulrektor Prof. Dr. Wolfgang Engler. Erläuternde Zahlen,
Grafiken und Literaturangaben im Anhang ermöglichen eine weiter
gehende Beschäftigung mit dem Thema.
Zum Autor
Götz W. Werner, geb. 1944 in Heidelberg, machte nach der mittleren
Reife in Konstanz eine Lehre zum Drogisten. 1973 gründete er
seinen ersten Laden in Karlsruhe. Heute umfasst seine
Drogeriemarktkette dm europaweit rund 1.500 Filialen, in denen
21.000 Mitarbeiter rund 3,1 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften. Bei
seiner Unternehmensführung stellt er den Menschen in den
Mittelpunkt. Er ist Vorsitzender der dm-Geschäftsführung und
leitet zudem als Professor das Interfakultative Institut für Entrepreneurship der Universität Karlsruhe (TH). Werner ist in
zweiter Ehe verheiratet und hat sieben Kinder.
Verlagsinformation
|
|
|
Juli
2006 |
|
|
|
Fritz Reheis: Entschleunigung.
Abschied vom Turbokapitalismus. Goldmann-Verlag 2006. ISBN:
3-442-15380-8. |
|
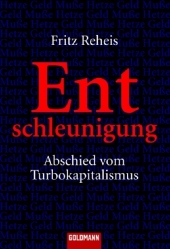
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
"Entschleunigung" verbindet fundierte Analyse mit pragmatischen
Vorschlägen, wie wir persönlich Zeitqualität zurückgewinnen und
dem Turbokapitalismus Paroli bieten können.
Ist unsere Hochgeschwindigkeitsgesellschaft zukunftsfähig? Der
freie Markt und im Besonderen die Dynamik des zinsgetriebenen
Geldes führen viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens in
"Beschleunigungsfallen", Punkte, an denen die Steigerung des
Tempos umschlägt in Zerstörung und Destruktion. Reheis zeigt
Möglichkeiten auf, aus dieser unheilvollen Dynamik auszubrechen
und unsere Gesellschaft zu entschleunigen.
"Gott schuf die Zeit. Von Eile hat er nichts gesagt." (Inschrift
über dem Eingang einer Tiroler Almhütte)
Rezension
Zu Reheis' Buch "Die Kreativität der Langsamkeit": "Als einer der
ersten hat Reheis umfassend den aktuellen Stand der Diskussion zur
'Ökologie der Zeit' zusammengefasst und mit realen Alternativen
verbunden." (Frankfurter Rundschau)
Zum Autor
Fritz Reheis, geboren 1949, studierte Deutsch, Geschichte,
Sozialkunde und Pädagogik. Promotion in Soziologie und
Absolvierung eines Erweiterungsstudiums in Philosophie für das
Lehramt an Gymnasien. Seit 1983 Gymnasiallehrer in Neustadt bei
Coburg. Zusätzlich nebenamtlich tätig als Lehrbeauftragter für
Politik, Zeitgeschichte, Soziologie und Pädagogik an mehreren
Hochschulen.
Verlagsinformation
|
|
|
Doris Bachmann-Medick:
Cultural Turns.
Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften.
Rowohlt-Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-499-55675-8. |
|
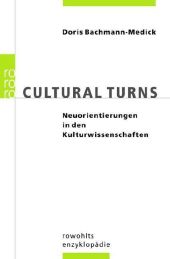
mehr Infos
bestellen
|
Die gegenwärtigen
Kulturwissenschaften bilden eine ausgeprägte Theorie- und
Forschungslandschaft. Ihre Dynamik entspringt vor allem dem
Spannungsfeld wechselnder "cultural turns" quer durch die
Disziplinen:
interpretive turn,
performative turn,
reflexive turn/literary turn,
postcolonial turn,
translational turn,
spatial turn,
iconic turn.
Der Band stellt diese "Wenden" in ihren systematischen
Fragestellungen, Erkenntnisumbrüchen sowie Wechselbeziehungen vor
und zeigt ihre Anwendung in konkreten Forschungsfeldern. Damit
wird eine "Kartierung" der neueren Kulturwissenschaften geleistet
und zugleich ein umfassender Überblick über ihre Entwicklungen und
Ausrichtungen geboten – mit einer Fülle verarbeiteter
internationaler Forschungsliteratur.
Verlagsinformation
|
|
|
April 2006 |
|
|
|
Barbara Ehrenreich:
Qualifiziert und arbeitslos. Eine Irrfahrt durch die
Bewerbungswüste. Kunstmann-Verlag 2006. ISBN: 3-88897-436-4. |
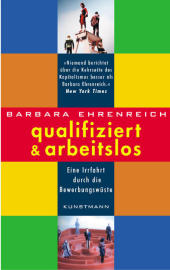
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
In "Arbeit poor" hat Barbara Ehrenreich im Selbstversuch erkundet,
ob (und wie) man von den Jobs im so genannten "Niedriglohnsektor"
leben kann. In ihrem neuen Buch beleuchtet sie einen weiteren
dunklen Fleck der liberalisierten Arbeitswelt: den arbeitslosen
Mittelstand. Ausgerüstet mit einer neuen Identität und einem
Lebenslauf voller Qualifikationsnachweise versucht sie fast ein
Jahr lang mit vollem Einsatz, Arbeit zu finden.
Doch aus dem geplanten direkten Weg zu einer neuen Festanstellung
wird eine Irrfahrt durch die Bewerbungswüste. Eine Schattenwelt
tut sich auf: Vermittlungsagenturen, Berater und Karrierecoachs
bieten ihre Dienste an, Imagepflege, Networking und der Besuch von
Jobmessen füllen die Tage. Obwohl die Arbeitssuche sich zum
Fulltimejob auswächst, schafft Barbara Ehrenreich es kaum bis zum
ersten Vorstellungsgespräch.
Umso tiefer sind ihre Einsichten in die Selektionsmechanismen
einer Arbeitswelt, die längst auch die nicht mehr verschont, die
studiert, sich qualifiziert und somit "alles richtig gemacht"
haben.
Rezensionen
-
Die Welt als Power-Point-Präsentation (Frankfurter Rundschau,
04.04.2006)
-
Die Bekämpfung der Arbeitslosen (DIE
ZEIT, 16.03.2006)
-
Vom Millionär zum Tellerwäscher (taz, 16.03.2006)
Zur Autorin
Barbara Ehrenreich hat zunächst Chemie, Physik und
Molekularbiologie studiert und zählt heute zu den bekanntesten
Publizistinnen Amerikas. Ihre Essays und Reportagen erscheinen u.a.
im "New York Times Magazine", "Harpers", "Vogue", "Wallstreet
Journal" und der ZEIT.
Verlagsinformation |
|
|
Hans M. Enzensberger:
Schreckens Männer.
Versuch über den radikalen Verlierer. Originalausgabe.
Sonderdruck. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-06820-2. |
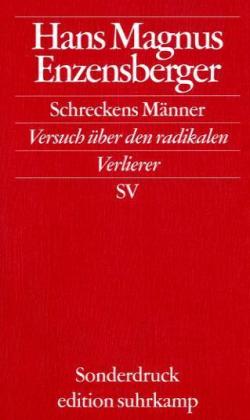
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der Eifer, mit dem Schüler und Gotteskrieger, Familienväter und
Selbstmordattentäter, mit Schrotflinten und Bomben ihrem eigenen
und dem Leben möglichst vieler anderer ein Ende machen, ist den
meisten von uns rätselhaft. "Man muss nicht alles verstehen, aber
ein Versuch kann nicht schaden": das ist das Motto dieses Essays,
den Hans Magnus Enzensberger dem "Radikalen Verlierer" widmet.
Gibt es, jenseits aller Ideologie, Gemeinsamkeiten zwischen dem
einsamen Amokläufer, der in einem deutschen Gymnasium um sich
schießt, und den organisierten Tätern aus dem islamistischen
Untergrund? Größenphantasie und Rachsucht, Männlichkeitswahn und
Todeswunsch gehen auf der verzweifelten Suche nach einem
Sündenbock – beim isolierten Täter wie im Kollektiv der Fanatiker
– eine brisante Mischung ein, bis der radikale Verlierer
explodiert und sich und andere für sein eigenes Versagen bestraft.
Zum Autor
Hans Magnus Enzensberger, geboren 1929 in Kaufbeuren, lebt heute
in München. Seit einiger Zeit schreibt der Autor auch Kinder- und
Jugendbücher. Sein Buch "Der Zahlenteufel" wurde mit dem
"Luchs"
ausgezeichnet. 1963 erhielt Hans Magnus Enzensberger den
Georg-Büchner-Preis.
Verlagsinformation |
|
|
Nienke van Olst/Reiner Klingholz:
Die demografische Lage der Nation.
Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen? Daten, Fakten,
Analysen. Originalausgabe. Mit zahlreichen Farbabbildungen.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-423-34296-X. |
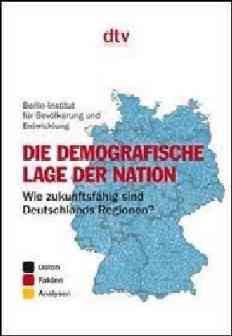
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Die Autoren entwerfen ein aussagekräftiges Bild des demografischen
Wandels und seiner Folgen. Dieser Blick in die Zukunft ist
unverzichtbar für Führungskräfte in Politik und Wirtschaft, für
Medien, Kommunen, Parteien, Verbände, Stiftungen und Vereine.
Jeder Bürger kann hier nachlesen, wie es um die Zukunftsfähigkeit
seiner Region bestellt ist.
Leseprobe
Verlagsinformation |
|
|
Albrecht Müller: Machtwahn.
Wie eine mittelmäßige Führungselite uns zu Grunde richtet. Droemer/Knaur-Verlag
2006. ISBN: 3-426-27386-1. |
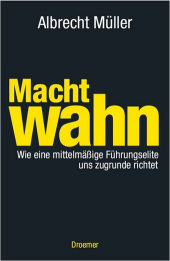
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Sie sind unteres Mittelmaß, und sie sind rücksichtslos
zerstörerisch: unsere "Eliten". Mit ihren Reformen zerschlagen sie
gewachsene Strukturen, ohne zu wissen, wo es hingehen soll.
Nacheinander werden der Sozialstaat, unsere Moral, unsere Werte,
die Sicherheit der Menschen und die Demokratie zur Disposition
gestellt. Rücksichtslos räumen die Eliten ab. Und sie arbeiten auf
eigene Rechnung.
Früher waren wir wirtschaftlich und sozial stark, doch die
Dummheit der vermeintlichen Führungskräfte und Meinungsmacher
beraubt das Land seiner Kraft. Ein Netzwerk mittelmäßiger Eliten
droht uns zu Grunde zu richten. Es sind dieselben, die uns seit
Jahr und Tag einreden, dieses Land sei am Ende, damit sie ihr
Ideal einer Wirtschaft ohne Regeln besser durchpeitschen können –
dabei haben sie die Zustände selbst verursacht, die sie so
lauthals beklagen.
Es sind die Führungskräfte aus Politik und Publizistik, aus
Wissenschaft und Wirtschaft, und sie tragen prominente Namen:
Horst Köhler, Angela Merkel, Gerhard Schröder, Friedrich Merz,
Josef Ackermann, die Bertelsmann-Stiftung, Roland Berger,
Hans-Werner Sinn und viele andere. Noch einmal geht Albrecht
Müller in "Machtwahn" zur Sache: Er benennt die Verantwortlichen,
zeigt ihre Motive auf, belegt die Strategie, der sie folgen, und
weist nach, wie sie ein Meinungskartell bilden, in dem einer den
anderen stützt.
Zum Autor
Albrecht Müller absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann,
und arbeitete nach seinem Abschluss als Diplom-Volkswirt als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität München. 1968
wurde Müller Ghostwriter bei Bundeswirtschaftsminister Prof. Dr.
Karl Schiller, 1970 Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit bei
der SPD. Als solcher war er verantwortlich für den erfolgreichen
Bundestagswahlkampf der SPD 1972. Ab 1973 fungierte er als Leiter
der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt und
Helmut Schmidt, 1987 bis 1994 arbeitete er als Abgeordneter des
Deutschen Bundestages. Heute ist Albrecht Müller Autor, Politik-
und Unternehmensberater sowie Herausgeber von NachDenkSeiten.de .
Verlagsinformation |
|
|
Februar 2006 |
|
|
|
Richard
Sennett: Der flexible Mensch.
Die Kultur des neuen Kapitalismus. Ausgezeichnet mit dem Preis
"Das politische Buch" 1999 der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Übersetzung: Martin Richter. Berliner Taschenbuch Verlag 2006.
ISBN: 3-8333-0342-5. |
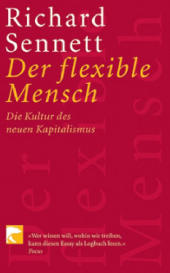
mehr Info
bestellen
|
In
diesem Buch geht der renommierte US-amerikanische Soziologe
Richard Sennett auf die gesellschaftlichen Folgen einer globalen
kapitalistischen Ökonomie ein. "Drift" ist für ihn der
Schlüsselbegriff dieser Ära: Die Mobilität, die
Internationalität, welche die neue Ordnung fordern, führen zu
einem gleichgültigen "Dahintreiben", zu
Orientierungslosigkeit und Isolation. Selbst die scheinbaren
"GewinnerInnen" des Globalisierung leiden unter dem
Verlust von Bindung, Werten und Verlässlichkeit, der mit dem
Siegeszug des postfordistischen Kapitalismus fest verbunden ist.
Verlagsinformation |
|
|
Karl
Schlögel: Im Raume lesen wir die Zeit.
Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik.
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2006. ISBN: 3-596-16718-3. |
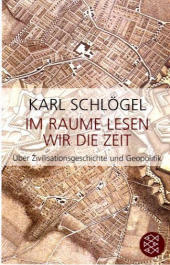
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Was sagt uns der Grundriss einer amerikanischen Stadt über den
amerikanischen Traum? Wie haben Eisenbahn, Auto und Flugzeug
unseren Sinn für Distanzen verändert? Auf solche Fragen geben
herkömmliche Geschichtsbücher keine Antwort. Karl Schlögel findet
sie an überraschenden Stellen: in Fahrplänen und Adressbüchern,
auf Landkarten und Grundrissen. Er holt damit die Geschichte an
ihre Schauplätze zurück, macht sie anschaulich, lebendig und
wunderbar lesbar.
Rezensionen
"Ein Buch von tiefem Ernst und großer Leichtigkeit, ein Pamphlet
und eine Spurenlese, dicht und welthaltig. Nur zu glänzen ist
schon eine ganze Menge. Dieses Buch glüht von innen." (Jürgen
Osterhammel, Die Zeit)
"Eine wunderbare Lektüre... Karl Schlögel ist ein grandioser
Landschaftsmaler, vor allem bei der Charakterisierung
osteuropäischer Räume. Er hat ein Werk der Leidenschaft
geschrieben, wie es die Geschichtswissenschaft in jeder Generation
nur wenige Male hervorbringt. Hier hat ein König gebaut, der noch
vielen Kärrnern zu tun geben wird." (Gustav Seibt, Literaturen)
Zum Autor
Karl Schlögel, geboren 1948 im Allgäu, hat an der Freien
Universität Berlin, in Moskau und St. Petersburg Philosophie,
Soziologie, Osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert und
lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.
Verlagsinformation |
|
|
George L. Mosse:
Die Geschichte des Rassismus in Europa.
Die Zeit des Nationalsozialismus. Fischer-Taschenbuch-Verlag 2006,
Frankfurt 2006. ISBN: 3-596-16770-1. |
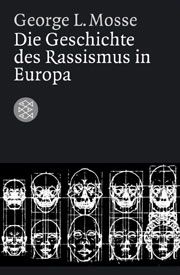
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der weltbekannte amerikanische Historiker George L. Mosse weist in
diesem Buch – einem Standardwerk, das seit 1978 immer wieder
aufgelegt wird – nach, dass der Rassismus keinen Seitenerscheinung,
sondern ein grundlegendes Element der europäischen
Kulturentwicklung gewesen ist: Der moderne Rassismus entspringt
denselben Quellen, die auch die Grundströmungen moderner
europäischer Kultur gespeist haben: Aufklärung und Pietismus,
Rationalismus und Romantik.
Mosse stellt die Geschichte des Rassismus in den Zusammenhang mit
der europäischen Geschichte. Indem er die einzelnen
Entwicklungsphasen beschreibt, kann er zeigen, wie und warum
rassistisches Denken in alle gesellschaftlichen Bereiche, v. a. in
die Wissenschaften, eindringen konnte. Der Autor untersucht
außerdem die wechselseitigen Beziehungen zwischen Rationalismus
und Christentum sowie den Verfall der humanistischen Tradition in
Europa. Schließlich setzt er sich mit der Herausbildung von
Stereotypen wie der "überlegenen" und "minderwertigen" Rasse
auseinander, die am Ende zur "Endlösung der Judenfrage" durch die
Nationalsozialisten geführt hat.
Rezension
"Mosse hat eine kurze, allgemein verständliche Geschichte des
Rassismus vorgelegt, eine Geschichte der ideologischen Wurzeln,
der konkurrierenden und verwandten Bewegungen und Ideen." (American
Historical Review)
Zum Autor
George L. Mosse (1918-2002), Enkel des Pressezaren Rudolf Mosse,
wurde in Berlin geboren, musste mit der elterlichen Familie 1933
vor den Nationalsozialisten fliehen. In Cambridge/GB studierte er
Geschichte und Politik. Kurz vor dem II. Weltkrieg emigrierte er
in die USA und vollendete an der Harvard Universität seine
Studien. Jahrzehntelang wirkte er als Professor für Europäische
Geschichte in Madison/Wisconsin und lehrte außerdem deutsche
Geschichte in Jerusalem. Mosse war einer der unkonventionellsten
und produktivsten Historiker des 20. Jahrhunderts.
Verlagsinformation |
|
|
Katajun
Amirpur/Ludwig Ammann (Hrsg.): Der Islam am Wendepunkt.
Liberale und konservative Reformer einer Weltreligion.
Herder-Verlag, Freiburg 2006. ISBN: 3-451-05665-8. |

mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Der Mord am niederländischen Filmemacher Theo van Gogh hat die
Frage verschärft: Ist der Islam mit der Moderne überhaupt
vereinbar? Auch in der islamischen Welt und unter den Muslimen
Europas wird diese Frage heftig diskutiert. Die Bereitschaft zur
Kritik der eigenen Tradition geht zwar unterschiedlich weit. Aber
nicht wenige Denker kommen zu dem Schluss: Eine grundlegende
Reform des Islams ist nötig – und möglich.
Themen wie Gewalt, Koranauslegung, Frauenrechte, Demokratie stehen
im Zentrum. Dieses Buch zeigt in spannenden Porträts das Gesicht
des Islams der Zukunft: Wegweisende Vorschläge zur Rückbesinnung
auf den wahren Kern der Religion und Neuauslegung des Glaubens,
die hierzulande noch viel zu wenig bekannt sind.
Zu den HerausgeberInnen
Katajun Amirpur, geboren 1971, hat an den
Universitäten Bonn und Teheran Islamwissenschaft studiert.
Ihre
Dissertation
über "die Entpolitisierung des Islam – Werk und Wirkung von
Abdol Karim Soroush in der islamischen Republik Iran"
schrieb sie in Bamberg. Heute widmet sich Amirpur –
seit Mai 2003 über ein Emmy-Noeter-Jungprofessorenstipendium
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
gefördert – der schiitischen Koranexegese.
Aufgewachsen mit den religiösen Geschichten von Anne de Fries und
den adaptierten Korangeschichten, gehört
Katajun Amirpur zu jenen Expertinnen, die sich kompetent und ohne
die Brille einer einseitigen Orientrezeption den modernen
Islamwissenschaften widmet.
Ludwig Ammann, geboren 1961, Studium der Islamwissenschaft,
Literaturwissenschaft und Völkerkunde in Freiburg im Breisgau.
Abschlüsse: M.A. Literaturwissenschaft, Dr. phil.
Islamwissenschaft; seit 1988 freie Kunst-, Buch- und Filmkritik
u.a. für Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), European
Photography und Merkur. 1997 Fellow am Kulturwissenschaftlichen
Institut in Essen in der Studiengruppe "Sinnkonzepte als
Orientierungssysteme".
Verlagsinformation |
|
|
Januar 2006 |
|
|
|
Wilhelm Heitmeyer: Deutsche
Zustände, Folge 4. Herausgegeben von Edition Suhrkamp Nr.
2454. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-12454-4. |
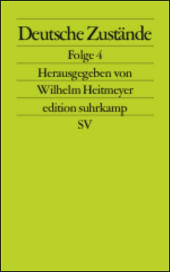
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Die Langzeitstudie "Deutsche Zustände" legt kontinuierlich
Rechenschaft über den sozialen, politischen und mentalen Zustand
der Republik ab. Sie untersucht Erscheinungsweisen, Ursachen und
Entwicklungen "gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" anhand von
wissenschaftlichen Analysen und anschaulichen Fallgeschichten,
Essays, Interviews und – diesmal – einer Fotogeschichte.
In der neuen, vierten Folge stehen Desintegration, Verschiebungen
in der politischen Kultur, Diskriminierung und religiös
eingefärbte Feindseligkeit im Mittelpunkt. In der Sektion
"Fallgeschichten" werden u. a. die Abschottung der Muslime und die
Zunahme junger Obdachloser behandelt. Die Essays beschäftigen sich
mit den Vorgängen im sächsischen Landtag rund um die NPD, mit der
Zukunft des Antidiskriminierungsgesetzes und dem Beitrag der
Eliten zur Politikverdrossenheit.
Zum Autor
Dr. Wilhelm Heitmeyer ist Professor an der Universität Bielefeld
und Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung.
Verlagsinformation |
|
|
Fernand Braudel/Georges
Duby/Maurice Aymard: Die Welt des Mittelmeeres. Zur Geschichte
und Geographie kultureller Lebensformen.
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2006 (Neuausgabe). ISBN:
3-596-16853-8. |
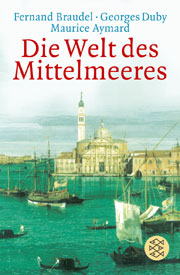
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Die mediterrane Welt zeigt (geographisch, gesellschaftlich,
ideengeschichtlich und politisch) nicht nur ein "westliches"
Gesicht, sondern auch ein "östliches" und ein "afrikanisches"; sie
war und ist das Laboratorium nicht einer einzigen, sondern
mehrerer Zivilisationen. Eben darin steckt ihre anhaltende
Faszinationskraft, die den Reisenden genau so wie den Historiker
lockt. Sie führt den anschaulichen Beweis für die Vielsprachigkeit
der Lebensformen, für den Bildungsprozess kultureller Identität
durch Widerspiel und Nachbarschaft, Öffnung und Selbstbehauptung.
Mit guten Gründen hat man den Mittelmeer-Raum die "Wiege Europas"
genannt. Die Geschichte des Abendlandes hat von dort ihren Ausgang
genommen. Zugleich liegen dort die Anfänge eines vielfältigen,
spannungsvollen Austausches zwischen großen Kulturen. Die
mediterrane Welt zeigt (geographisch, gesellschaftlich,
ideengeschichtlich, politisch) nicht nur ein "westliches" Gesicht,
sondern auch ein "östliches" und ein "afrikanisches"; sie war und
ist das Laboratorium nicht einer einzigen, sondern mehrerer
Zivilisationen.
Eben darin steckt ihre anhaltende Faszinationskraft, die den
Reisenden genauso wie den Historiker lockt. Sie führt den
anschaulichen Beweis für die Vielsprachigkeit der Lebensformen,
für den Bildungsprozess kultureller Identität durch Widerspiel und
Nachbarschaft, Öffnung und Selbstbehauptung. Kein systematisches
historiographisches Werk, sondern neun Innenansichten der
Mittelmeer-Welt, ihrer Zivilisationszeichen und ihrer
geschichtlichen Entwicklungsverläufe.
Rezensionen
"Fernand Braudels "Die Welt des Mittelmeers" ist eine
Liebeserklärung." (Herfried Münkler, in: FAZ)
"Was hier vorliegt, ist im Leben des Wissenschaftlers Braudel
vielleicht das, was man beim Eiskunstlaufen die Kür nennt. Und in
der Tat sind – um im Bilde zu bleiben – bei dieser Kür einige
höchste Schwierigkeiten mit einer selten erreichten Virtuosität
bewältigt." (NDR-Hörfunk)
"Der schmale Band ist eine geglückte Visitenkarte der
Annalles-Schule. Wer bislang noch nichts von dieser französischen
Historikergruppe gelesen haben sollte, findet hier eine glänzend
formulierte Kostprobe ihrer Thesen und Auffassungen." (Jens
Petersen [Dt. Hist. Inst., Rom], in: Annot. Bibliogr. f. d. polit.
Bildg.)
Zu zwei der drei Autoren
Fernand Braudel (1902-1986) war nach Marc Bloch und Lucien Febvre
die herausragende Gründerfigur der neuen französischen
Geschichtswissenschaft. Er hat an französischen und ausländischen
Universitäten gelehrt, zuletzt war er Direktor an der École
Pratique des Hautes Études in Paris.
Georges Duby, Mediävist und einer der wichtigsten Vertreter der
Annales-Schule, wurde 1919 in Paris geboren. Ab 1970 hatte er
einen Lehrstuhl als Professor für mittelalterliche Geschichte am
College de France und verfasste zahlreiche Abhandlungen über
Historie und Kunst des Mittelalters. Seit 1987 Mitglied der
Academie française, war Duby unter anderem Vorsitzender im
Aufsichtsrat von La Sept sowie Leiter der Zeitschriften "Etudes
rurales" und "Moyen Age". Er starb 1996 im Alter von 77 Jahren in
Aix-en-Provence.
Verlagsinformation |
|
|
Bernhard Pötter: König Kunde
ruiniert sein Land. Wie der Verbraucherschutz am Verbraucher
scheitert. Und was dagegen zu tun ist. Vorwort von Klaus Töpfer.
Ökom-Verlag 2006. ISBN: 3-936581-92-4. |
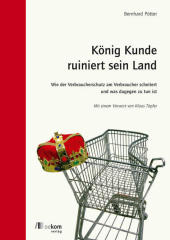
mehr Info
bestellen
|
Zum
Buch
Wer trägt am meisten Verantwortung für Umweltzerstörung und
Sozialdumping: Die Industrie? Die Politik? Falsch: Es sind die
Konsumenten. Die meisten Probleme werden durch die Nachfrage der
Verbraucher verursacht. Denn König Kunde pfeift auf Öko, wenn nur
der Preis stimmt. Bernhard Pötter erzählt die Geschichte des
Konsums und analysiert das Verhalten des Verbrauchers: Warum
verwirklicht er so selten, was er eigentlich will? Warum führt er
seinen inneren Schweinehund an der langen Leine?
Der Autor gibt praktische Tipps für kleine Verhaltensänderungen
mit großer Wirkung. Und er diskutiert, wie es gelingen kann, aus
uns Schnäppchenjägern verantwortungsvolle Konsumenten zu machen –
jedenfalls immer mal wieder. Unterhaltsam und gut recherchiert
hält uns der Autor einen Spiegel vor. Er zeigt, dass Geiz gar
nicht geil ist und jeder etwas für mehr Nachhaltigkeit tun kann:
durch ein anderes Konsumverhalten.
Zum Autor
Bernhard Pötter, geboren 1965, ist Redakteur bei der Berliner "tageszeitung".
Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine Hobbys sind
Marathonlauf und Erziehungsurlaub.
Verlagsinformation |
|
|
|
|
Januar – Dezember 2005 |
|
|
|