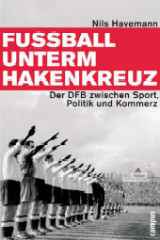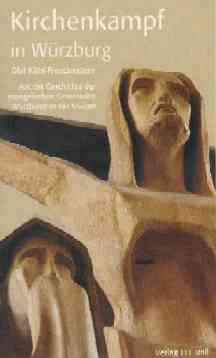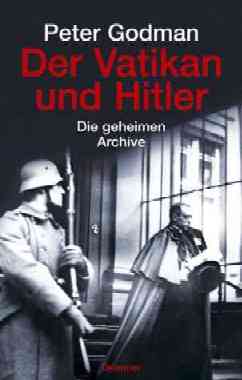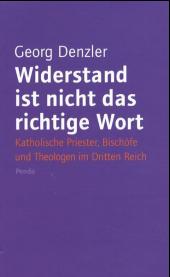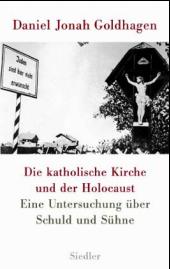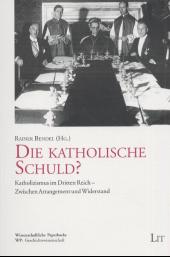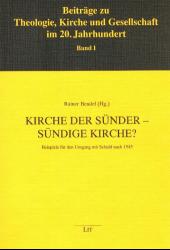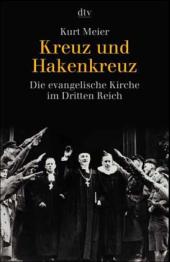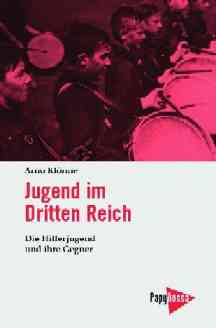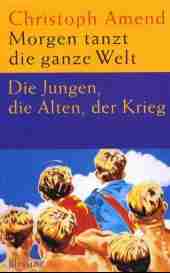|
Ärzte
/ Kirche / Justiz / Jugend |
|
|
|
Nils Havemann: Fußball unterm
Hakenkreuz.
Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz. Campus-Verlag 2005.
ISBN: 3-593-37906-6. |
|
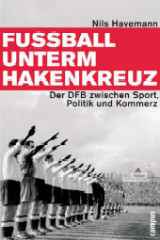
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der DFB stellt sich seiner Vergangenheit: Bisher wurde der
Deutsche Fußball-Bund im "Dritten Reich" entweder als gänzlich
"unbefleckt" oder als williger Handlanger des Regimes dargestellt.
Nun hat der DFB selber die Aufarbeitung seiner Vergangenheit
initiiert. Herausgekommen ist eine differenzierte Studie, in der
Nils Havemann das Verhalten des DFB gegenüber der NS-Diktatur
untersucht.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Fußball
zur beliebtesten Sportart in Deutschland, und schon damals
versuchten Politiker, das Spiel auf dem Rasen zur Durchsetzung
eigener Ziele zu missbrauchen. Mit dem Beginn der
nationalsozialistischen Herrschaft 1933 verlor der Fußball
endgültig seine Unschuld: Er verkam zu einem Werkzeug der Nazis,
die den Sport hemmungslos zur Verwirklichung ihrer
verbrecherischen Rassen- und Kriegspolitik einsetzten.
Der Deutsche Fußball-Bund wurde "gleichgeschaltet", jüdische
Sportler und Funktionäre verfolgt und das "Führerprinzip"
eingeführt Verband wie Vereine, Funktionäre wie Mäzene, Trainer
wie Spieler ließen sich von den bombastisch aufgezogenen
Massenveranstaltungen und der magischen Atmosphäre in den Stadien
faszinieren. Die Beibehaltung und Vermehrung ihrer materiellen
Privilegien war für viele wichtiger als der Widerstand gegen ein
verbrecherisches Regime.
Obwohl nur wenige von ihnen der menschenverachtenden NS-Ideologie
anhingen, trugen die meisten Funktionäre und Mitglieder des DFB
zur Stabilität der nationalsozialistischen Herrschaft bei und
machten sich dadurch mitschuldig an Unterdrückung, Verfolgung,
Krieg und Vernichtung. Die brillant geschriebene Studie basiert
auf bislang unbekannten Dokumenten aus über 40 Archiven im In- und
Ausland.
Nils Havemann beschreibt in ihr nicht nur ein zentrales Kapitel
aus der Geschichte des DFB. Er zeigt an diesem Beispiel ebenso,
mit welchen Mitteln es den Nationalsozialisten gelang, an sich
unpolitische Vereine und Verbände für ihre Zwecke zu gewinnen –
und wie leicht sich viele Menschen verführen ließen.
Rezensionen
"Entlastungszeugnisse klingen anders. Havemann kommt zu einem
Ergebnis, das an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig lässt." (Neue
Zürcher Zeitung, "Schmarotzer unterm Hakenkreuz", 05.10.2005)
"Nils Havemann ist es gelungen, die erste wirklich umfassende
Darstellung der nationalsozialistischen Vergangenheit des DFB auf
wissenschaftlicher Grundlage zu liefern." (Die Tageszeitung,
"Ein später Auftrag", 24.09.2005)
"473 lesenswerte Seiten ... Havemanns Verdienst ist es, sowohl die
Schicksale von Opfern als auch von Tätern in den Reihen des DFB zu
dokumentieren." (Neues Deutschland, "Flaggezeigen mit 60 Jahren
Verspätung", 17.09.2005)
"Alle folgenden sporthistorischen Untersuchungen werden sich an
dem Vorbild, das diese Studie abgibt, messen lassen müssen." (Rheinische
Post, "Fußball unter Hitler", 14.09.2005)
"Breite Quellenbasis, wissenschaftliche Strenge, souveräner Stil
... ein überaus lesenswertes Buch." (Der Tagesspiegel, "Hitlers
willige Fußballer", 14.09.2005)
"Methodisch und systematisch über jeden Zweifel erhaben. Wohl nie
zuvor sind die verfügbaren Quellen so umfänglich und sorgfältig
ausgewertet worden, was Havemanns Buch ... auf Jahre unverzichtbar
machen wird." (Frankfurter Rundschau, "NS-Vergangenheit",
14.09.2005)
Zum Autor
Nils Havemann, Dr. phil., studierte Geschichte, Romanistik und
Politische Wissenschaft in Bonn, Paris und Salamanca. Er
promovierte 1996 an der Universität Bonn und arbeitet als Lektor
in Mainz.
Verlagsinformation |
|
|
Stephan Malinowski: Vom König zum Führer.
Deutscher Adel und Nationalsozialismus. Dissertation.
Ausgezeichnet mit dem Hans-Rosenberg-Preis 2004.
Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-596-16365-X. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Malinowski
erstellte mit seiner Dissertation die erste umfassende Analyse des
Niedergangs der jahrhundertealten Herrschaftselite des deutschen
Adels. Die Selbstzerstörung adliger Traditionen und Werte, die im
Kaiserreich mit der Annäherung an rechtsradikale Bewegungen
beginnt, kulminierte in der widersprüchlichen Mitwirkung in der
NS-Bewegung. Malinowskis Buch wurde ausgezeichnet mit dem
Hans-Rosenberg-Preis 2004.
Über die
immense Bedeutung des deutschen Adels weit über das Jahr 1918
hinaus herrscht in der Literatur Einigkeit. Kurioserweise ist
jedoch über den Adel des 20. Jahrhunderts bisher sehr viel
behauptet und sehr wenig geforscht worden. Dieses Buch erregte
gleich nach Erscheinen großes Aufsehen und wurde innerhalb eines
halben Jahres zweimal nachgedruckt. Gestützt auf breite
Quellengrundlage liegt hier die erste umfassende Analyse des
Niedergangs einer jahrhundertealten Herrschaftselite vor, die die
Bastionen ihrer sozialen und kulturellen Macht selbst noch
innerhalb der industriellen Moderne äußerst hartnäckig und nicht
ohne Erfolg verteidigt hatte.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Selbstzerstörung adliger
Traditionen und Werte, die im späten Kaiserreich mit der
Annäherung an rechtsradikale Bewegungen beginnt und in der weit
gehenden Kollaboration mit der NS-Bewegung kulminierte. Dieser
Befund wird nicht ohne Folgen für die Interpretation und
Einordnung des so genannten "konservativen Widerstandes" bleiben.
Weitere Informationen:
-
Aufstand des
schlechten Gewissens (Rezension von Heinrich August Winkler in
der ZEIT, 18.09.2003)
Ausschnitt:
"Noch nie ist das Scheitern des deutschen Konservativismus in
Kaiserreich, Weimarer Republik und 'Drittem Reich' so quellennah
und so scharfsinnig dargestellt worden wie hier."
-
Anpassung und Widerstand: Der Adel und die Nazis, Teil 1 /
Teil 2
(ZDF,
09.03.2004)
-
Die
Männer des 20. Juli: Warum so spät? (DIE WELT, 20.07.2004)
-
Rezension von Christoph Franke, Deutsches Adelsarchiv, Marburg
(H-Soz-u-Kult, 01.08.2003)
Zum Autor
Stephan Malinowski studierte von 1989 bis 1995 Geschichte und
Politikwissenschaft an der TU Berlin, der FU Berlin und der
Université Paul Valéry (Montpellier). Dabei arbeitete er auch als
studentische Hilfskraft sowie als Tutor. 1995 bis 1998 war er
Stipendiat des DAAD am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz,
1998 bis 2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Geschichte und Kunstgeschichte der TU Berlin bei Prof. Dr. Heinz
Reif). Das vorliegende Buch stellt seine Promotion an der TU
Berlin dar (2002). Seit April 2003 arbeitet er als
wissenschaftlicher Assistent am Friedrich-Meinecke-Institut der FU
Berlin.
Verlagsinformation |
| |
|
Olaf
Kühl-Freudenstein: Kirchenkampf
in Würzburg. Aus der Geschichte
der evangelischen Gemeinden Würzburgs in der NS-Zeit.
Mit Geleitworten von Dekan Dr. Günter Breitenbach und Prof. Dr.
Horst F. Rupp. J.H. Röll-Verlag 2003. ISBN: 3-89754-218-8. |
|
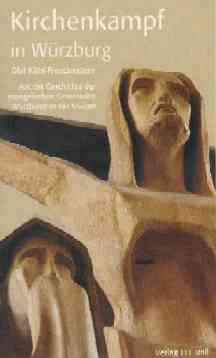
mehr
Infos
bestellen |
Zum Buch
Christus oder Hitler
– Kreuz oder
Hakenkreuz: Das waren die Entscheidungen, vor die sich die
evangelischen Christen in der NS-Zeit gestellt sahen und die
Auseinandersetzungen in den Gemeinden hervorriefen, die unter dem
Begriff "Kirchenkampf" in die Geschichte eingegangen sind.
Anlässlich des 200. Geburtstags der Evangelischen Kirche in
Würzburg im Jahr 2003 wird mit diesem Buch erstmals der Kampf um
das evangelische Bekenntnis in der Mainstadt dargestellt. In zwölf
mit zahlreichen Abbildungen illustrierten Kapiteln werden die
zunehmenden Bedrohungen nachgezeichnet, denen sich die Würzburger
evangelischen Christen damals ausgesetzt sahen. Manche Abwege
werden dabei zur Darstellung gebracht, aber auch zahlreiche
Beispiele für das mutige Festhalten am evangelischen Bekenntnis.
Klappentext
Das Buch "Kirchenkampf in Würzburg" enthält
–
sichtbar aus den Geleitworten des Würzburger Dekans Dr.
Breitenbach
–
die offizielle Sichtweise der protestantischen Amtskirche in
Würzburg auf ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus.
Dementsprechend wohlmeinend fällt die Analyse und insbesondere die
Wertung am Ende des Bandes aus.
Fragwürdig ist bereits der Ansatz der Studie: Es wird lediglich
danach gefragt, wie stark die von Hitler gewünschte
nationalsozialistische Kirche, die
"Glaubensbewegung Deutsche Christen" (DC), in Würzburg und Bayern
verankert war. Doch viel entscheidender als die reine
Organisationszugehörigkeit wäre die Frage gewesen, inwiefern sich
führende Mitglieder der protestantischen Kirche in Würzburg und
Bayern persönlich schuldig gemacht haben durch ihr Schweigen
gegenüber oder sogar ihre Zustimmung und Unterstützung für die
Verbrechen des Nazi-Regimes. Dieser Aspekt wird großenteils
ausgeklammert, so z.B. die wichtige Frage, wie viele Priester
Mitglied der NSDAP waren.
Auch die unselige Rolle, die der bayerische Landesbischof und
überzeugte Antisemit Hans Meiser gegenüber dem Nationalsozialismus
spielte, wird unterschlagen. Meiser forderte bereits in der
Weimarer Republik, Ende der 20er Jahre, Maßnahmen gegen die "Verjudung
unseres Volkes" wie z.B. Berufsverbote, Kennzeichnung usw. 1931
erklärte er, "wir erwarten uns von der NSDAP viel". Später wehrte
er sich dagegen, auf kirchlichen Synoden über das Thema
"Judenverfolgung" zu sprechen. Über den Transport geistig
Behinderter aus den evangelischen Einrichtungen in die Gaskammern
wusste er Bescheid, doch sagte er nichts dazu. Der ihm
unterstellte evangelische Arzt im Kirchendienst forderte die Nazis
auf, dieses Leben "dem Schöpfer zurückzugeben".
Meiser konnte auch nach dem 2. Weltkrieg ungestört weiter
amtieren. In München ist sogar eine Straße nach ihm benannt. In
dem Buch wird Meiser jedoch als entschiedener Nazigegner und
glaubenstreuer Protestant dargestellt. Wenn dies angesichts der
geistigen und tatsächlichen Kollaboration Meisers mit dem
Nationalsozialismus der ethische Maßstab ist, dann müssten
allerdings auch viele geistige Brandstifter des NS-Regimes
von Schuld freigesprochen werden, z.B. der Herausgeber des
antisemitischen STÜRMER, Julius Streicher. Dies kann doch nicht
das Ziel des Bandes sein?
An keiner Stelle wird auch darauf eingegangen, wie stark bereits
Martin Luther als Begründer der evangelisch-lutherischen Kirche
fragwürdige Traditionen gelegt hat. Er übernahm wesentliche
reaktionäre Elemente der römisch-katholischen Lehre, etwa den
Antisemitismus, und verstärkte sie teilweise sogar noch. So kann
man Luther nicht freisprechen von einer Mitverantwortung dafür,
dass die protestantische Kirche mitsamt
einem Großteil ihrer Gläubigen mit dem nationalsozialistischen Regimes
kollaborierten. Drei Viertel der deutschen Protestanten wählten
schon 1933 die NSDAP-nahe "Glaubensbewegung Deutsche Christen" (DC)
in die protestantischen Kirchenvorstände.
Luthers fragwürdige bis menschenverachtende Ansichten zu Frauen,
Juden, gesellschaftlichen Randgruppen (z.B. Behinderte) und zum
Kadavergehorsam gegenüber der Obrigkeit waren derart
anschlussfähig an die nationalsozialistische Ideologie, dass sich
Adolf Hitler bereits 1923 und der STÜRMER-Herausgeber Julius
Streicher, sogar noch bei den Nürnberger Prozessen am 29. April
1946 in ihrem Antisemitismus auf Martin Luther beriefen. Erst als sich die
Gleichschaltung der Diktatur auch massiv gegen die Kirchen richtete, bahnte
sich erstes Misstrauen und auch Widerstand zwischen vielen Christen und dem Nazi-Staat
an. Diese Aufmüpfigkeit bezog sich jedoch meist vor allem auf die
Verteidigung der organisatorischen Selbständigkeit der Kirche,
selten nur auf politische Forderungen.
All dies fehlt in dem kompakten Band, der jedoch zumindest einen
Anfang leistet bei der Vergangenheitsbewältigung der
protestantischen Kirche in Würzburg. Er ist nicht zuletzt aufgrund
der vielen zitierten Einzelquellen empfehlenswert – als Fundgrube
sowie als Grundlage für weitere, tiefer gehende Recherchen.
Michael Kraus
Zum Autor
Olaf Kühl-Freudenstein, 1965 in Berlin geboren, Lehramtsstudium
und Referendariat in Berlin, Wiss. Mitarbeiter an der Universität
Würzburg, Promotion 2002, zur Zeit Lehrbeauftragter und
Religionslehrer in Würzburg.
Klappentext
Weitere Informationen:
-
Martin Luther und die Juden
(Ursula Hohmann)
- Der lange Weg zum
Holocaust (John Weiss)
-
Diskussion über Martin Luther
(Wikipedia, die freie Enzyklopädie)
-
Luther –
ein reaktionärer Film im Kino (Indymedia)
- Antisemitismus:
Vom religiösen Antijudaismus bis zur "Endlösung"
(www.shoa.de)
- Luther
(Peter Möllers Philolex)
-
Luther-Zitate
(Rudolf O. Brändli)
-
Auge um Auge – 2000 Jahre christlicher Antijudaismus
(Telepolis) |
|
|
Peter Godman:
Der Vatikan und Hitler.
Die geheimen Archive. Droemer/Knaur-Verlag 2004. ISBN:
3-426-27308-X.
|
|
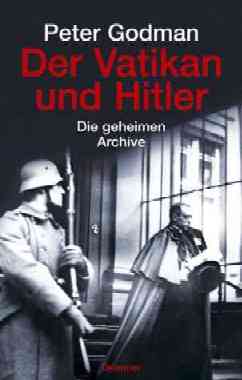
mehr
Infos
bestellen
|
"Die Kirche verurteilt
die Ansicht, dass jegliche Vermischung des Blutes mit einer
fremden und niedrigeren Rasse, insbesondere aber die Vermischung
der arischen mit der semitischen Rasse, ein äußerst frevelhaftes
Verbrechen wider die Natur sei." So begann eine Enzyklika des
Papstes, mit der der nationalsozialistische Rassismus verdammt
werden sollte. Der Text, 1936 geschrieben, wurde nie
veröffentlicht. Warum schwieg der Papst? Welche Kräfte hatten ein
Interesse daran, diese Verurteilung zu verhindern? Wurde der Papst
über die Judenvernichtung falsch informiert? Ist alle Schuld Pius
XII. anzulasten?
Bis heute verstellen zahlreiche Legenden den Blick auf das
Verhältnis des Vatikans zu Hitler-Deutschland. Ohne Zugang zu
Originaldokumenten aus jener Zeit waren die Entscheidungsprozesse
im Vatikan dem kritischen Blick der Öffentlichkeit bis vor kurzem
entzogen. Siebzig Jahre lang waren die entscheidenden Akten in den
geheimen Archiven des Vatikans unter Verschluss. Zum ersten Mal
kommt jetzt die Wahrheit über die Politik des Heiligen Stuhls in
den Jahren 1933 bis 1939 ans Licht. Peter Godman, ausgewiesener
Vatikan-Experte, hat die Unterlagen aufgespürt, die Aufschluss
geben über die Ereignisse jener Zeit. Die Ergebnisse seiner
Recherchen schildert er in diesem Buch.
Verlagsinformation
|
|
|
Georg
Denzler:
Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester,
Bischöfe und Theologen im Dritten Reich. Pendo-Verlag 2003. ISBN:
3-85842-479-X.
|
|
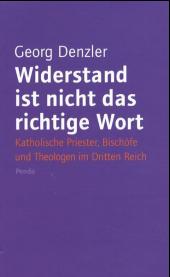
mehr
Infos
bestellen
|
Denzlers
kritische Perspektive auf die Geschichte der katholischen Kirche
ist bekannt. Im Gegensatz zu Goldhagen jedoch besticht der klare
Blick der hier herausgegebenen Vorträge, mit denen Denzler eine
Einführung in die Komplexität kirchlichen Lebens während des
"Tausendjährigen Reiches“ gibt. Er
entwickelt sie in der Hauptsache an Lebensläufen bekannter und
unbekannter Theologen, Priester und Bischöfe jener Zeit
(ausführlich gerät das Bistum Bamberg mit seiner
katholisch-theologischen Fakultät in den Blick; wiederholt
begegnet auch Würzburg). Oftmals ist man erschrocken über
völkische Vorstellungen im theologischen Denken; dankbar über die
Darstellung der gleichermaßen vorhandenen Stimmen des
Widerstandes. Beides wird zum Glück nicht gegeneinander
aufgewogen.
Stärker jedoch wirken die Beschreibungen kirchlich-theologischen
Alltagslebens, besonders wenn Zeitzeugen zu Wort kommen. Ein
wunderbarer Einstieg für diejenige, die sich mit dem komplexen
Thema der katholischen Kirche im Dritten Reich beschäftigen
möchte. Das Buch bietet keinen Gesamtüberblick, obgleich es die
wichtigsten Leitlinien diskutiert (S. 209-270). Gerade die enge (v.a.
regionale) Perspektive motiviert stark zu weiterer Beschäftigung.
Ein toller Einstieg ins Thema – auch für Nicht-Theologen!
Jörg Seiler
|
|
|
Daniel Jonah Goldhagen:
Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über
Schuld und Sühne. Siedler-Verlag 2002 (2. Auflage). ISBN:
3-88680-770-3.
|
|
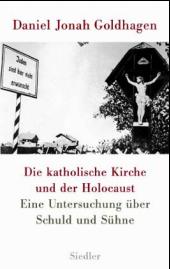
mehr
Infos
bestellen
|
Pius
XII., Papst von 1939 bis 1958, soll selig gesprochen werden. Seit
Jahren wird dieses Ansinnen vorangetrieben, das ursprünglich
festgesetzte Datum musste jedoch bereits verschoben werden: Zu
widersprüchlich sind die Aussagen über Pius' Verhalten während
des Holocaust. Während die einen in ihm einen engagierten Helfer
und sogar Retter der Verfolgten sehen, halten die anderen ihn für
einen eingefleischten Antisemiten.
Daniel Jonah Goldhagen nimmt die Auseinandersetzungen um Pius XII.
zum Anlass, die Haltung der gesamten katholischen Kirche zur Zeit
des Holocaust einer längst überfälligen, kritischen
Untersuchung zu unterziehen: Er zeigt, dass die Kirche und der
Papst weit tiefer in den Verfolgungsprozess verstrickt waren, als
man bisher angenommen hat. Die Kirchenführer waren über die
Verfolgung der europäischen Juden genau informiert. Doch anstatt
öffentlich dagegen Stellung zu beziehen und zum Widerstand
aufzurufen, unterstützten sie die Verfolgung in vielerlei
Hinsicht. Einige Kleriker beteiligten sich sogar am Massenmord.
Ausgehend von der historischen Untersuchung, wendet sich der Autor
der zentralen Frage von Schuld und Sühne zu: Wie verhält sich
die katholische Kirche, die moralische Instanz schlechthin, zu
ihrer Verstrickung in den Holocaust? Goldhagen entwickelt
Kriterien, anhand deren sich die schuldhafte Beteiligung der
Institution wie des Einzelnen bewerten lassen. Er zeigt, dass die
Kirche ihre Pflicht zur Sühne weder anerkannt noch erfüllt hat,
und umreißt die Maßnahmen, die die katholische Kirche ergreifen
müsste, um ihre Opfer moralisch zu entschädigen und sich selbst
als Religion der Liebe und Güte zu rehabilitieren.
Verlagsinformation |
|
|
Rainer
Bendel (Hrsg.): Die katholische Schuld?: Katholizismus im
Dritten Reich
– Zwischen Arrangement und Widerstand. LIT-Verlag
2002. ISBN: 3-8258-6334-4.
|
|
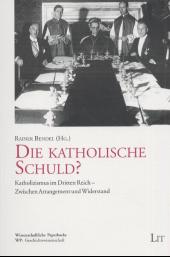
mehr
Infos
bestellen
|
Die
Frage nach der "Katholischen Schuld" ist spätestens
seit Hochhuths "Stellvertreter" ein öffentliches Thema.
Nun wird es von Goldhagen neu aufgeworfen, aufgeworfen als
moralische Frage - ohne fundierte Antwort.
Wer sich über den Zusammenhang von Katholizismus und
Nationalsozialismus fundiert informieren will, dem/der sei dieser
Band empfohlen: mit Beiträgen u. a. von Gerhard Besier, E. W. Böckenförde,
Heinz Hürten, Joachim Köhler, Johann Baptist Metz, Rudolf Morsey,
Ludwig Volk, Ottmar Fuchs und Stephan Leimgruber.
Verlagsinformation |
|
|
Rainer
Bendel (Hrsg.): Kirche der Sünder
– sündige Kirche?
Beispiele für den Umgang mit Schuld nach 1945. LIT-Verlag
2002. ISBN: 3-8258-5010-2.
|
|
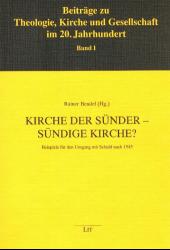
mehr
Infos
bestellen
|
Die
Beiträge dieses Bandes zeigen die Spannungen innerhalb des
Katholizismus der ersten Nachkriegsjahre auf und machen auf die
ideologischen Wurzeln der Engführungen aufmerksam: Wie sahen
Katholiken das Verhalten ihrer Kirche in der unmittelbaren
Vergangenheit? Wie versuchten sie ihre Erfahrungen fruchtbar zu
machen für eine Neukonzeption, für ein neues Mitgehen mit den
Menschen? Das Thema ist nach wie vor aktuell angesichts der
Debatten um Erinnerungskultur und der oberhirtlichen
Vergebungsbitten im Jubiläumsjahr 2000. Die Aufgabe, sich auch
den Schatten der Vergangenheit zu stellen, ist immer noch
schwierig. Notwendig bleibt die Trauerarbeit, die Konfrontation
mit den Opfern. Der Band will auf teils verschüttete Ansätze
christlicher Umkehrforderung hinweisen.
Verlagsinformation |
|
|
Vladimir
Dedijer: Jasenovac, das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan.
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Gottfried Niemietz.
Ahriman-Verlag 2001 (5. Auflage). ISBN: 3-922774-06-7.
|
|

mehr
Infos
bestellen
|
Umfassendes
Dokumentationsmaterial über eines der unbekanntesten
Massenverbrechen während des Zweiten Weltkrieges: die Ausrottung
von 800.000 orthodoxen Serben, Juden, Sinti und Roma im 'Reich
Gottes', Ustascha-Kroatien, durch Handlanger der katholischen
Kirche. Dieses Buch belegt die historische Wahrheit über die
Verbrechen des Klerus und der vatikanischen Hierarchie bis hinauf
zu Pius XII. und entlarvt gerade in jüngster Zeit wieder aktuelle
Geschichtslügen. Damit bietet es auch einen Schlüssel zum
Verständnis der aktuellen Ereignisse in Jugoslawien.
Verlagsinformation |
|
|
Kurt
Meier: Kreuz und Hakenkreuz. Die evangelische Kirche im
Dritten Reich. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2001 (Neuausgabe).
ISBN: 3-423-30810-9.
|
|
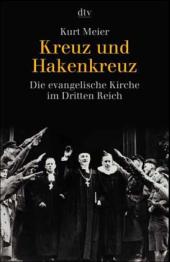
mehr
Infos
bestellen
|
Im
Rahmen der Feierlichkeiten zum Heiligen Jahr haben sich die beiden
großen christlichen Kirchen öffentlich für ihr Versagen an
entscheidenden Stationen ihrer langjährigen Geschichte
entschuldigt, darunter für ihre Unentschlossenheit gegenüber der
nationalsozialistischen Judenverfolgung. Kurt Meier untersucht die
Geschichte des von inneren Auseinandersetzungen gekennzeichneten
evangelischen Kirchenkampfes im "Dritten Reich" und
unterzieht die religiösen und politischen Konflikte, denen die
Kirche ausgesetzt war, sowie die Frage nach ihren Möglichkeiten,
als bedeutende gesellschaftliche Gruppierung Widerstand zu
leisten, einer kritischen Analyse. Neben dem aktiven Widerstand
einzelner Christen gegen das NS-System beschreibt er die
Gratwanderung zwischen Anpassung und Verweigerung sowie die
Weltanschauungskontroverse innerhalb der Kirche und die
zwiespältige Haltung der Protestanten zur Judenverfolgung.
Vergleichend nimmt Meier Bezug auf die Reaktion der katholischen
Kirche und gelangt zu einer abschließenden Bewertung kirchlichen
Widerstands unter dem Hitler-Regime.
Verlagsinformation |
|
|
Niedersächsisches
Justizministerium/NLpB (Hrsg.): Justiz im Nationalsozialismus.
Über Verbrechen im Namen des Deutschen Volkes. Beiträge und
Katalog zur Ausstellung. Nomos-Verlag 2002. ISBN: 3-7890-8179-5.
|
|

mehr
Infos
bestellen
|
Wie
deutsche Juristen sich ab 1933 willig dem NS-Regime zur Verfügung
stellten, zeigt die niedersächsische Justiz seit Ende 1999 in
einer Dauerausstellung. Eine zusätzliche und in der
Bundesrepublik einzigartige Fassung als Wanderausstellung mit
lokalen Ergänzungen der jeweiligen Gerichtsorte wurde bisher von
rund 50.000 Besuchern gesehen. Der Katalog beschreibt die Folgen,
als so genanntes "deutsches Recht" an die Stelle des
Rechtsstaats trat: politische und rassische Verfolgung, hohe
Freiheitsstrafen und mehr als 30.000 vollstreckte Todesurteile.
Nach 1945 setzten NS-Juristen ihre Karrieren ungehindert fort,
ihre Opfer wurden zum Teil erst im Jahr 2002 rehabilitiert –
auch dies regt zum Vergleich an mit der juristischen Aufarbeitung
anderer Unrechtsregimes. Aufsätze von Prof. Diemut Majer, Prof.
Ingo Müller, Prof. Joachim Perels u.a. beleuchten wichtige
Aspekte für juristisch, historisch und politisch Interessierte:
"Gesetzliches Unrecht" im NS-Staat, Handlungsspielräume
der Juristen, Strafvollzug, Sonderrecht als Auflösung des Rechts,
späte Einsicht im Nachkriegsdeutschland. Zahlreiche Biografien
machen Ausstellung und Katalogband besonders anschaulich für
Schulunterricht und politische Bildung.
Verlagsinformation |
|
|
Gerhard
Pauli (Hrsg.): Nationalsozialismus und Justiz: Vortragsreihe
im Amtsgericht Dortmund. Juristische Zeitgeschichte, Kleine Reihe
Band 5. Nomos-Verlag 2002. ISBN: 3-7890-7840-9. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Das
Buch dokumentiert eine Vortragsreihe in Dortmund anlässlich der
Enthüllung einer Gedenktafel für die Opfer der Justiz im
Nationalsozialismus im dortigen Landgericht. Der Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen, Jochen Dieckmann, gesteht
einleitend das Versagen der Justiz im Nationalsozialismus ein und
skizziert Gründe hierfür, die er mit dem Motto der Gedenktafel,
dem Zitat aus dem 5. Buch Mose "Du sollst das Recht nicht
beugen", verknüpft. In seinem Beitrag "Die Justiz und
die nationalsozialistische Judenverfolgung" wendet sich Prof.
Dr. Dr. Ingo Müller den Mechanismen zu, mit denen die deutsche
Justiz nach und nach Menschen jüdischer Abstammung aus der
Rechtsgemeinschaft ausschloss. Staatsanwalt Dr. Holger Schlüter
enttarnt in seinem Beitrag eine negative Ikone: den
Volksgerichtshof. Der Dortmunder Anwalt und Notar Dr. Werner
Himmelmann schließlich erinnert in seinen sehr persönlich
gehaltenen Ausführungen an die Lebensschicksale verfolgter
Juristen in der Zeit des Nationalsozialismus unter besonderer
Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
Rezension von Dr. Susanne Benöhr
(www.shoa.de)
|
|
|
Arno
Klönne: Jugend
im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und ihre Gegner. PapyRossa-Verlagsgesellschaft 2003.
ISBN: 3-89438-261-9.
|
|
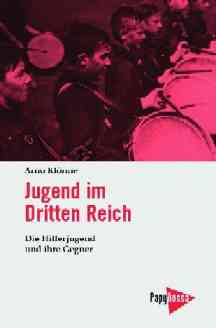
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
"Wer die Jugend hat, hat die Zukunft", verkündeten die Nazis. Bei
ihrer Machtausübung stützten sie sich auf einen weit verbreiteten
Jugendmythos. Ihr Herrschaftssystem nahm Jungen und Mädchen in
historisch einmaliger Weise in seinen Dienst, um sie zu "Garanten
der Zukunft" des großdeutschen Imperiums heranzuziehen.
Wichtigster Träger dieses Konzepts war die "Hitlerjugend". Als
Staatsjugendorganisation prägte sie die junge Generation aufs
nachhaltigste, stieß bei einer Minderheit aber auch auf Opposition
und Widerstand.
In seinem Standardwerk informiert Arno Klönne anhand zahlreicher
Dokumente und zeitgenössischer Berichte über: Formen und Realität
faschistischer Jugenderziehung; Organisation und Funktion,
Leitbilder und Praktiken der HJ; Wehrerziehung und Jugend im
Krieg; die soziale Demagogie in der NS-Jugendpolitik;
widerständige Jugendkulturen und jugendliche Widerstandsgruppen.
Zum Autor
Arno Klönne, geboren 1931,
ist Professor für Soziologie an der Universität Paderborn.
Von ihm sind zahlreiche Bücher und andere Publikationen zu
den Schwerpunkten Faschismus und Rechtsextremismus
erschienen.
Verlagsinformation |
|
|
Christoph
Amend: Morgen tanzt die ganze Welt. Die Jungen, die Alten,
der Krieg. Blessing-Verlag 2003. ISBN: 3-89667-199-5. |
|
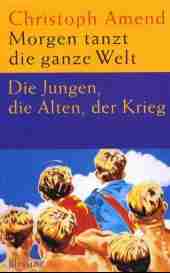
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Christoph Amend besucht Deutschlands Großväter, um mit ihnen
über ihre Jugend im Dritten Reich zu sprechen. Richard von
Weizsäcker, Egon Bahr, Joachim Fest, Hellmuth Karasek, Erich
Loest, Horst-Eberhard Richter und viele andere erzählen von ihren
Kriegserlebnissen und davon, was sie geprägt hat. Und was prägt
die Jugend von heute, die ihrerseits nach dem Niedergang der
Goldenen 1990er gerade eine Zeitenwende durchlebt?
Am Anfang
seiner Recherche fühlt es sich für den Autor an wie eine Reise
in ein fremdes Land. Als ob da noch ein zweites Deutschland
existiere, das auf den ersten Blick nichts mit der Gesellschaft
von heute zu tun hat, ein Land, in dem von Ostfronten, von
Fahnenjunkern und Pimpfen die Rede ist. Der 28-jährige Christoph
Amend hat sich aufgemacht, die Großväter der Bundesrepublik zu
treffen: einen früheren Bundespräsidenten, einen renommierten
Hitler-Biografen, mehrere Politiker, Kultur- und Mediengrößen.
Ihnen allen ist gemeinsam: Sie waren Soldaten im Zweiten
Weltkrieg. Und sie alle erlebten in ihrer Jugend eine Zeitenwende,
wie sie auch Amends Generation jetzt gerade durchmachen muss. Die
goldenen Neunzigerjahre sind vorbei, viele sind Opfer der
Wirtschaftskrise geworden, und alle fragen sich, was die Zukunft
bringen wird. So ist dieses Buch ein doppeltes
Generationsporträt: Enkel und Großväter treffen aufeinander und
reden über ihre Hoffnungen, Enttäuschungen und Ängste, die
einen
am
Anfang, die anderen am Ende ihres Lebens.
Zum Autor
Christoph Amend, geboren 1974 in Gießen, leitet die
Sonntagsbeilage des Tagesspiegel in Berlin. Von 1996 bis 1999
arbeitete er bei "Jetzt", dem Jugendmagazin der
Süddeutschen Zeitung, zuletzt als stellvertretender
Redaktionsleiter. Dies ist seine erste Buchveröffentlichung.
Klappentext
|
|
|
Winfried
Schulze/Otto G. Oexle u.a. (Hrsg.): Deutsche Historiker im
Nationalsozialismus. Fischer-Taschenbuch-Verlag 1999. ISBN:
3-596-14606-2.
|
|

mehr
Infos
bestellen
|
Über
die Rolle deutscher Historiker in der Zeit des Nationalsozialismus
ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Auf dem
Historikertag 1998 wurde diese Frage heftig diskutiert. Veröffentlicht
werden erstmals neueste Forschungsergebnisse über die
Verstrickung führender Historiker, die nach 1945 Karriere gemacht
und wichtige Schulen gegründet haben.
Verlagsinformation |
|
|