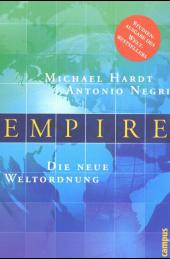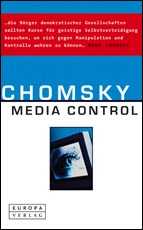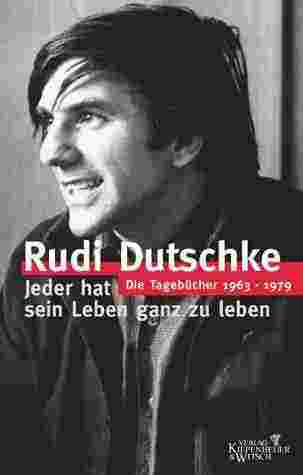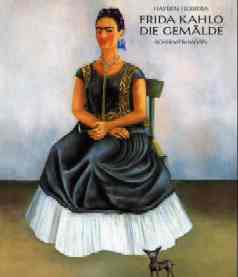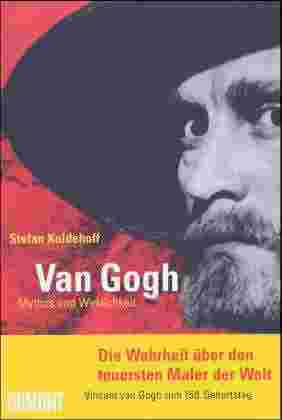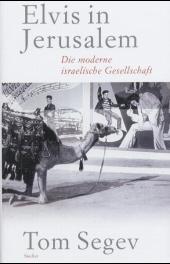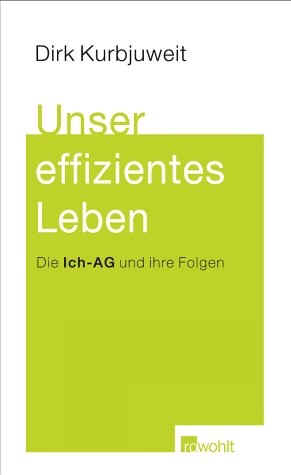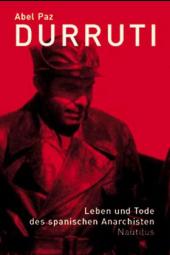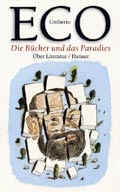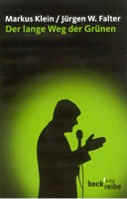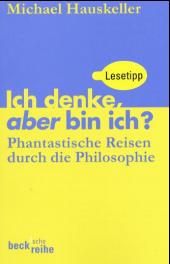|
Michael Hardt/Antonio Negri: Empire. Die
neue Weltordnung. Campus-Verlag 2003 (Durchgesehene
Studienausgabe). ISBN: 3-593-37230-4. |
|
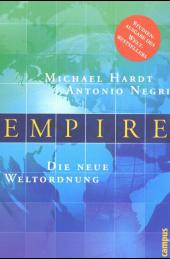
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Nach einem
Vierteljahrhundert politischer Theoriemüdigkeit haben Hardt und
Negri mit ihrer brillanten, provokanten und heiß diskutierten
Analyse des postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der
Globalisierung das Denken wieder in Bewegung gebracht. Der
Hoffnung auf die politische Gestaltbarkeit einer neuen,
gerechteren Weltordnung haben sie damit ein anspruchsvolles
theoretisches Fundament gegeben. Die nun erschienene, günstige
Studienausgabe des Buches macht Empire auch für den kleineren
Geldbeutel interessant.
Rezensionen
"Die Autoren
wollen nichts weniger als Marx' Erzählung der Weltgeschichte
fortsetzen und auf den neuesten Stand ... bringen. Das ist ihnen
so gut gelungen, dass es auch einen überzeugten Nichtmarxisten ...
erfreut, zumal der Versuch handwerklich hervorragend gearbeitet
ist." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
"Empire (ist) eine grandiose Gesellschaftsanalyse ..., die unser
Unbehagen bündelt und ihm eine Richtung gibt, für die in der Geschichte
der Philosophie das Wort vom 'guten Leben' steht." (DIE ZEIT)
"Das Jahrzehnt linker Melancholie ist vorüber." (NZZ)
"The next big theory. Empire füllt eine Lücke in den
Humanwissenschaften." (New York Times)
"... ein probates Mittel gegen die neoliberale Depression ..." (literaturen)
"Empire bringt die Geschichte der humanistischen Philosophie, des
Marxismus und der Moderne in einem großartigen politischen Entwurf
zusammen." (The Observer)
Zu den Autoren
Antonio Negri
war Professor für Philosophie in Padua und Paris und Abgeordneter
im italienischen Parlament. Er ist seit den sechziger Jahren einer
der führenden Theoretiker der italienischen Linken und lebt heute
in Rom.
Michael Hardt
ist Professor für Literaturwissenschaft an der Duke University
Durham.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
-
Leseprobe aus dem 1. Kapitel
-
Weiterführende Links
(Rosa-Luxemburg-Stiftung)
Rezensionen:
-
Empire, Neue Weltordnung
oder alter Imperialismus?
(Conne Island, Leipzig)
-
"Empire" befriedigt
das Bedürfnis nach linker Welterklärung, erklärt aber wenig
(jungle world, 04.09.2002) |
|
|
Noam Chomsky: Media Control. Übersetzt
von Michael Haupt. Europa-Verlag 2003. ISBN: 3-203-76015-0. |
|
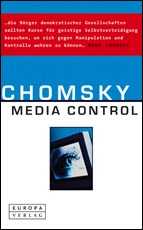
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Noam Chomsky begibt sich in seinem neuen Buch in ein
unerhörtes Spannungsfeld: "Media Control" – Kontrolle der
Medien. Zum einen sind die Medien – ohne direkter staatlicher
Kontrolle zu unterliegen – Propagandainstrumente der Außenpolitik,
zum anderen dienen sie der gesellschaftlichen Herstellung von
Konsens, unterdrücken Nachrichten, die die Bevölkerung
verunsichern könnten, mildern sie ab, so dass an der Einstellung
der politischen Führung kein Zweifel aufkommt. Dazu gehört die
Methode, Verbrechen des Feindes, wer immer es gerade sein mag,
akribisch zu beleuchten und mit dem Vergrößerungsglas zu
untersuchen, während eigene Untaten oder die verbündeter Staaten
in das milde Licht alles rechtfertigender Nachsicht getaucht
werden.
Zum Autor
Noam Chomsky hat seit den sechziger Jahren unsere Vorstellungen
über Sprache und Denken revolutioniert. Zugleich ist er einer der
schärfsten Kritiker der gegenwärtigen Weltordnung und des
US-Imperialismus. Der heute 71-Jährige ist als "der
einflussreichste westliche Intellektuelle" und als "der
bekannteste Dissident der Welt" bezeichnet worden.
Verlagsinformation
Rezension:
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen
(Jörg Seiler, April 2003) |
|
|
Rudi Dutschke: Jeder hat sein Leben ganz zu
leben. Die Tagebücher 1963-1979. Kiepenheuer & Witsch-Verlag
2003. ISBN: 3-462-03224-0. |
|
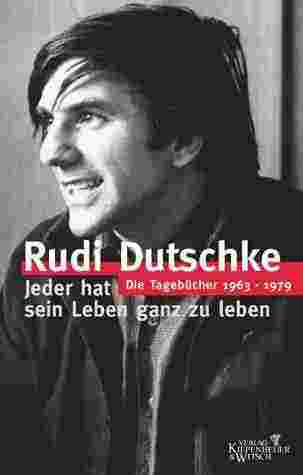
mehr Infos
bestellen
|
Der
unbekannte Rudi Dutschke – Lebenszeugnis des Idols einer
Generation
Zum ersten Mal werden Rudi Dutschkes Tagebücher vollständig
veröffentlicht. Sie dokumentieren das geistige Innenleben einer
der aufregendsten Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. Der
Wortführer der Außerparlamentarischen Opposition und Mitbegründer
der Grünen erweist sich in seinen Tagebüchern als ein kritischer
und selbstkritischer Denker von außerordentlicher Originalität.
Rudi Dutschke war einer der originellsten politischen Köpfe der
Bundesrepublik. Er kämpfte für eine sozialistische Revolution in
Westdeutschland und gegen den Spätstalinismus in Osteuropa. Er
gehörte zu den wenigen Linken, die die deutsche Einheit forderten.
Er war das Idol einer Generation, die den Wohlstandsmief wie die
Verdrängung des Nationalsozialismus in Frage stellte. Als er im
Dezember 1979 an den Folgen des Attentats vom April 1968 starb,
hinterließ er politisch eine Lücke, die nicht mehr geschlossen
werden konnte.
Rudi Dutschkes Tagebücher, die bisher nur in Auszügen bekannt
waren, werden in diesem Band zum ersten Mal vollständig
veröffentlicht. Sie offenbaren einen hellen Verstand und einen
sensiblen Geist. Dutschke beobachtet aufmerksam, manchmal
aufgeregt die Ereignisse seiner Zeit. Er protokolliert die
Angstattacken, die dem Attentat folgen. Er schildert, wie er sich
müht, seiner Rolle als Mann, Ehemann und Vater gerecht zu werden.
Die Tagebücher dokumentieren Zweifel und Ratlosigkeit und ebenso
seine unbeirrbare Überzeugung, dass die Gesellschaft radikal
verändert werden muss, damit der Mensch ein Mensch sein kann.
Verlagsinformation
Rezension:
Stephan Wackwitz: Geheime Signale kindlicher Gesten (taz,
09.04.2003) |
|
|
Hayden Herrera: Frida Kahlo, die Gemälde.
Schirmer/Mosel-Verlag 2003 (Neuauflage). ISBN: 3-88814-469-8. |
|
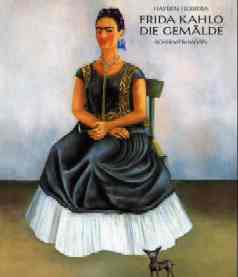
mehr Infos
bestellen
|
Was
sich die mexikanische Malerin
Frida Kahlo (1907-1954), die durch einen frühen Unfall ständig
Schmerzen und dem unaufhaltsamen Verfall ihres Körpers ausgesetzt
war, auf meist kleine Formaten in intensiven Farben buchstäblich
von der Seele malte, ist so ausdrucksstark wie ihre
Persönlichkeit. Die meisten ihrer rund 150 Gemälde sind
Selbstportraits, schonungslos aufrichtige Zeugnisse eines
erstaunlichen Überlebenswillen und einer großen künstlerischen
Begabung.
Verlagsinformation
|
|
|
Stefan Koldehoff: Van Gogh, Mythos und
Wirklichkeit. Die Wahrheit über den teuersten Maler der Welt.
Vincent van Gogh zum 150. Geburtstag. Mit einem Beitrag von Nora
Koldehoff. DuMont Literatur- und Kunst-Verlag 2003. ISBN:
3-8321-7267-X. |
|
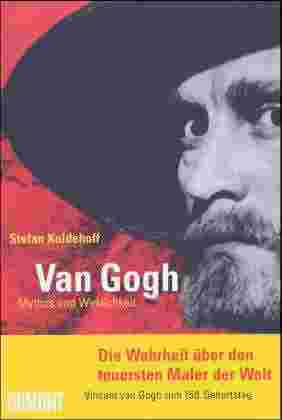
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Am 30.03.1853 wurde Vincent van Gogh geboren: Jeder verbindet
mit diesem Namen das rührend-romantische Klischee des einsamen
Künstlergenies, das zu Lebzeiten nur ein einziges Bild verkaufen
konnte, unter der Sonne Südfrankreichs wahnsinnig wurde, sich ein
Ohr abschnitt und schließlich aus Verzweiflung selbst erschoss.
Diese Künstlerlegende ist weitgehend reine Erfindung.
Stefan Koldehoff zeichnet die unbekannten Seiten von Leben und
Werk des modernen Van Gogh nach, der konsequent und energisch
seine Kunst entwickelte, unter seinen Künstlerkollegen die höchste
Anerkennung genoss und sich an den Kunstdebatten seiner Zeit
intensiv beteiligte. Er beschreibt, wie vor dem Ersten Weltkrieg
vorsätzlich der uns alle bis zum heutigen Tag begleitende
Van-Gogh-Mythos initiiert wurde, um den Erfolg des dem breiten
Publikum gänzlich unbekannten Malers einzuleiten, und wie dieser
Mythos dann tatsächlich zu einer fast hysterischen Nachfrage auf
dem Kunstmarkt und zu einer beispiellosen Fälschungsaffäre führte.
Mit nie gezeigtem dokumentarischem Material und Abbildungen vieler
fast unbekannter Werke eröffnet Koldehoff einen neuen Blick auf
van Gogh.
"Koldehoffs Buch ist in einer präzisen und verständlichen Sprache
verfasst; stellenweise liest es sich wie ein Kriminalroman. (...)
Es ist erhellend zu verfolgen, wie (er) in seiner
rezeptionsgeschichtlichen Grundlagenarbeit die Mythenschreibung
mit dem kunsthistorischen Skalpell zerlegt. (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
Zum Autor
Stefan Koldehoff, geboren 1967 in Wuppertal, hat nach einem
Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft
zunächst als freier Journalist für FAZ, taz und WDR gearbeitet.
Von 1998 bis 2001 war er Redakteur und zuletzt stellvertretender
Chefredakteur des Kunstmagazins ART in Hamburg. Heute arbeitet er
als Kulturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln.
Verlagsinformation
|
|
|
Tom Segev: Elvis in Jerusalem. Die moderne
israelische Gesellschaft. Siedler-Verlag 2003 (Überarbeitete
Ausgabe). ISBN: 3-88680-766-5.
|
|
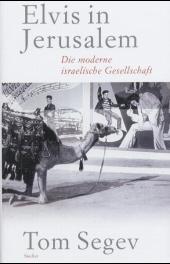
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
In seinen Werken zur Geschichte Israels hat Tom Segev immer wieder
fest verwurzelte Ansichten zu entscheidenden Momenten in der
israelischen Vergangenheit infrage gestellt. In seinem neuesten
Buch, einer prägnanten, scharfsinnigen Streitschrift, wendet sich
Segev dem heutigen Israel zu und fordert lieb gewonnene Annahmen
über die moderne israelische Gesellschaft und ihre ideologischen
Grundlagen heraus.
Untermauert durch persönliche Erfahrungen wie durch verschiedenste
Ausdrucksformen der israelischen Massenkultur – Shopping-Malls,
Fast Food, Kunst, Fernsehen, religiöser Kitsch –, kommt der Autor
zu einer provozierenden Schlussfolgerung: Die weitgehende
Amerikanisierung des Landes, von den meisten beklagt, hatte einen
ausgesprochen positiven Einfluss. Denn sie brachte nicht nur
McDavids und Dunkin Donuts, sondern auch Tugenden wie
Pragmatismus, Toleranz und Individualismus mit sich.
Die damit einhergehende Aufweichung der nationalen Identität und
Ideologie, die in den vergangenen zehn Jahren stattfand, könnte
ein Vorbote eines neuen Geistes von Kompromissbereitschaft und
Offenheit sein, so die These des bekannten israelischen
Journalisten. Ob sich dieser Geist angesichts der gegenwärtigen
Krise, in der sich Israelis und Palästinenser auch in
ideologischer Hinsicht verschanzen, durchsetzen kann, welche
Prägung den Terror überdauern wird – Zionismus oder
Amerikanisierung –, wird die Zukunft zeigen. Um zu verstehen, um
welche Positionen gerungen wird, ist Segevs "Elvis in Jerusalem"
ein leicht zugänglicher und elementarer Beitrag.
"Unverzichtbar für jeden, der die gegenwärtigen Ereignisse in
Israel und im Nahen Osten verstehen möchte." (Publishers Weekly)
Zum Autor
Tom Segev schreibt als Kolumnist für "Ha'aretz" und wurde bekannt
mit seinen Büchern zur israelischen Geschichte. Auszeichnung mit
dem National Jewish Book Award. Der Autor lebt in Jerusalem.
Verlagsinformation |
|
|
Dirk Kurbjuweit: Unser effizientes Leben.
Die Ich-AG und ihre Folgen. Rowohlt-Verlag 2003. ISBN:
3-498-03510-X. |
|
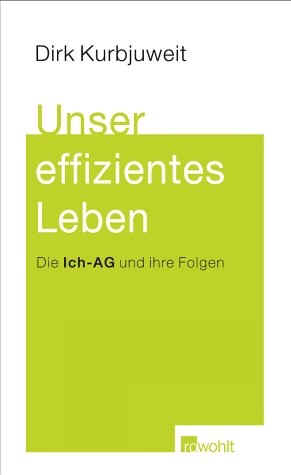
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Das Effizienzprinzip hat einen Namen: McKinsey. Die weltweit
operierenden Unternehmensberater sind die Speerspitze eines
umfassenden Wirtschaftlichkeitsdenkens, das längst alle unsere
Lebensbereiche durchdringt: Politik und Wirtschaft, Religion und
Kultur, Medizin und Gentechnik. Wie sieht sie aus, die
"McKinsey-Gesellschaft"? Was ist ihr Menschenbild? Wer sind ihre
Propheten und was treibt sie an?
Dirk Kurbjuweit porträtiert mit genauem Blick für Typisches und
Details die Macher und ihre Jünger von Jürgen Kluge über Friedrich
Merz bis hin zu jenem Pfarrer, der sich der "spirituellen
Marktwirtschaft" öffnet. Und er beschreibt anschaulich, wie das
Prinzip McKinsey uns alle immer mehr verwandelt. Eine geschlossene
Gesellschaft von Hochleistungsmenschen scheint am Horizont auf.
Und die Frage wird unausweichlich: Wollen wir das wirklich?
Zum Autor
Dirk Kurbjuweit, geboren 1962, ist Journalist und Buchautor.
Nach einem Studium der Volkswirtschaft war Kurbjuweit von 1990 bis
1999 Redakteur bei der ZEIT. 1999 wechselte er zum SPIEGEL, wo er
seit 2003 stellvertretender Büroleiter in Berlin ist. 1998 und
2002 jeweils Auszeichnung mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis.
Mehrere Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation |
|
|
Abel Paz: Durruti. Leben und Tode des
spanischen Anarchisten. Edition Nautilus 2003 (3. Auflage). ISBN:
3-89401-411-3. |
|
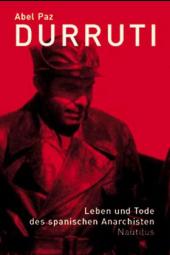
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Abel Paz beschreibt in seiner Biographie Buenaventura Durruti,
eine der legendären Gestalten des 20. Jahrhunderts, dessen
aufrührerisches Temperament ihn zu einem der gefürchtetsten
Aktivisten auf der iberischen Halbinsel machte. Paz' Buch führt in
Fabriken, Gefängnisse, abgelegene Dörfer und Verbannungsorte,
zeigt das Alltagsleben Durrutis und seiner Kampfgefährten,
schildert ihre Vorstellungen und Diskussionen, lässt die ganze
dramatische Atmosphäre von Streiks, Aufständen und verzweifelten
Aktionen intensiv vor dem Leser erstehen.
Schließlich beschreibt und analysiert der Autor jenen "kurzen
Sommer der Anarchie" (Enzensberger) innerhalb des spanischen
Bürgerkriegs (1936–1939) in den selbstverwalteten Fabriken und
landwirtschaftlichen Kollektiven. Abel Paz, der aktiv am
Bürgerkrieg teilnahm und mehr als zehn Jahre in Francos KZs und
Gefängnissen inhaftiert war, hat eine europäische Geschichte
aufgezeichnet, die den kämpferischen Willen zur sozialen und
ökonomischen Freiheit repräsentiert. "Durruti"
–
Eine Biografie über einen unbeugsamen Rebellen, die einem großen
Abenteuerroman in nichts nachsteht.
"Abel Paz ist eine sachliche und zugleich aufregende Analyse
gelungen, ohne dass er vergessen hat, auf welcher Seite er stand
und heute immer noch steht. Sein Bericht über Durrutis Leben und
Tod sollte nicht nur aus historischem Interesse gelesen werden."
(Elke Schubert, DIE ZEIT)
"Zu diesen leidenschaftlichen, mit Herzblut geschriebenen Büchern
gehört die Lebensgeschichte des Buenaventura Durruti von seinem
fünfundzwanzig Jahre jüngeren compañero Abel Paz. Es ist ein
sympathisches und vor allem notwendiges Buch." (Anica Falica,
Frankfurter Rundschau)
Zum Autor
Abel Paz, geb. 1921 in Almería, lebt in Barcelona. 1935 trat er
als Lehrling in einer Textilfabrik der anarchistischen
Gewerkschaft CNT bei. An den Kämpfen in Barcelona seit 1936 aktiv
beteiligt. 1939 nach Frankreich ins Exil, mit anderen
Spanienkämpfern im Konzentrationslager. 1942 Mitglied der
libertären Guerilla gegen die Militärdiktatur in Spanien.
Gefangenschaft und erneute Emigration nach Frankreich bis 1977.
Verlagsinformation |
|
|
Nikolai P. Anziferow: Die Seele
Petersburgs. Aus dem Russischen von Renata von Maydell. Mit
einem Vorwort von Karl Schlögel. Hanser-Verlag 2003. ISBN:
3-446-20317-6. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Sankt Petersburg entdecken mit den Augen der Dichter! Von Puschkin
über Gogol und Lermontow bis zur Achmatowa hat diese Stadt die
größten Autoren Russlands zu Gedichten und Erzählungen inspiriert.
Nikolai Anziferow, unvergleichlicher Chronist Petersburgs, folgt
auf der Suche nach der Seele seiner Stadt der Literatur ebenso wie
seiner eigenen Beobachtungsgabe. 1922 erschienen und jetzt zum
ersten Mal ins Deutsche übersetzt, ist das Buch eine Entdeckung
für Liebhaber der russischen Literatur und für alle, die
Petersburg bereisen möchten.
Verlagsinformation |
|
|
Umberto Eco: Die Bücher und das Paradies.
Über Literatur. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber.
Hanser-Verlag 2003. ISBN: 3-446-20313-3. |
|
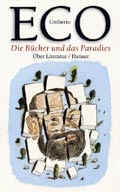
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Ohne Bücher kein Paradies
–
niemand weiß das besser als Umberto Eco: so schreibt er fesselnd
und gelehrt über sein ureigenstes Thema: die Literatur, die
Phantasie und das Erzählen. Von Don Quixote, von einer Lesart von
Dantes Paradies oder von den Paradoxien von Oscar Wilde handeln
seine Aufsätze. Und manchmal nimmt Eco sein eigenes Werk und sein
eigenes Erzählen zum Bezugspunkt seiner Überlegungen und wirft
damit ein deutliches Licht auf sein eigenes Schreiben.
Zum Autor
Umberto Eco wurde 1932 in
Alessandria geboren und
lebt heute in Mailand. Er studierte Pädagogik und Philosophie und
promovierte 1954 an der Universität Turin. Anschließend arbeitete
er beim Italienischen Fernsehen und war als freier Dozent für
Ästhetik und visuelle Kommunikation in Turin, Mailand und Florenz
tätig. Seit 1971 unterrichtet er Semiotik in Bologna. Eco erhielt
neben zahlreichen Auszeichnungen den Premio Strega (1981) und
wurde 1988 zum Ehrendoktor der Pariser Sorbonne ernannt.
Er verfasste
zahlreiche Schriften zur Theorie und Praxis der Zeichen, der
Literatur, der Kunst und nicht zuletzt der Ästhetik des
Mittelalters. Seine Romane
"Der Name der
Rose" und
"Das Foucaultsche
Pendel" sind Welterfolge geworden.
Verlagsinformation |
|
|
Markus Klein/Jürgen W. Falter: Der lange Weg
der Grünen. Eine Partei zwischen Protest und Regierung. C.H.
Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-49417-X. |
|
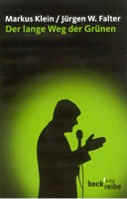
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die Grünen haben sich seit den frühen 1980er-Jahren von einer
systemkritischen sozialen Bewegung zu einer staatstragenden
Regierungspartei gewandelt. Das Buch zeichnet diesen Prozess nach
und untersucht erstmals dessen Auswirkungen auf die Wählerklientel
der Partei. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses der Bundestagswahl
2002 werden die Zukunftschancen einer Partei diskutiert, die wie
keine andere parteipolitische Skepsis verkörperte und sich
schließlich doch den parlamentarischen Gegebenheiten anpasste. Die
Autoren erörtern unter anderem die Frage, ob dieser
Anpassungsprozess Bedingung des parlamentarischen Überlebens der
Grünen ist.
Zu den Autoren
Jürgen W. Falter
ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Mainz und
durch zahlreiche Veröffentlichungen und Medienauftritte (z.B. bei
Sabine Christiansen) bekannt. Bei C.H. Beck erschien von ihm unter
anderem "Hitlers Wähler" (1991), "Wer wählt rechts?" (1994).
Markus Klein, Dr. rer. pol., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung der Universität Köln.
Verlagsinformation
Leseprobe |
|
|
Michael Hauskeller: Ich denke, aber bin
ich? Phantastische Reisen durch die Philosophie. C.H.
Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-49453-6. |
|
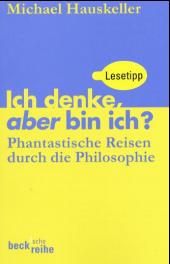
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Dieses Buch ist eine Sammlung
philosophischer Merkwürdigkeiten. Davon ist die Geschichte der
Philosophie so reich, dass
man leicht den Eindruck haben kann, diese sei nichts weiter als
eine Unterart der phantastischen Literatur.
Aber phantastisch sind die Ansichten der Philosophen oft nur
deshalb, weil sie Antworten auf Rätsel suchen, die uns, wenn wir
uns näher mit ihr beschäftigen, die Wirklichkeit selbst aufgibt.
Leseprobe
"Wer würde sich schon mit der Philosophie beschäftigen wollen,
wenn sie uns nur das bestätigen würde, was wir ohnehin schon
denken. Was wir von der Philosophie erwarten, ist ja nicht in
erster Linie die Wahrheit, sondern vor allem, dass es ihr gelingt,
unser Denken in Bewegung zu bringen. Das kann sie aber nur, wenn
sie unser vertrautes Bild der Welt erschüttert, wenn sie uns mit
neuen, ungewohnten Perspektiven konfrontiert, die etwas, das wir
bislang geneigt waren für selbstverständlich zuhalten, mit einem
Mal fragwürdig erscheinen lassen. Wer ein Philosoph werden will,
bemerkte darum einmal Bertrand Russell zu Recht, darf sich nicht
vor Absurditäten fürchten." (Michael Hauskeller, aus der
Einleitung)
Zum Autor
Michael Hauskeller, geboren 1964, studierte Philosophie in Dublin,
Berkeley und Bonn und lehrt derzeit an der Universität Darmstadt.
1997 erhielt er den Schopenhauer-Preis. Zahlreiche
Veröffentlichungen zur Naturphilosophie, Ethik, Ästhetik und
Geschichte der Philosophie
–
u.a.: "Alfred North Whitehead zur Einführung", "Was das Schöne
sei", "Atmosphäre erleben. Philosophische Untersuchungen zur
Sinneswahrnehmung".
Verlagsinformation
|
|
|