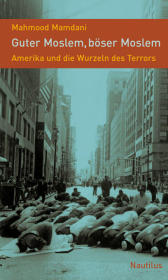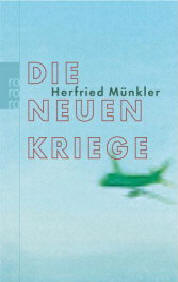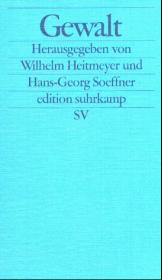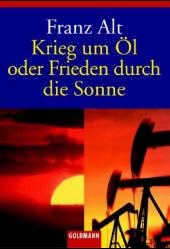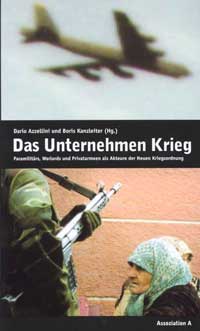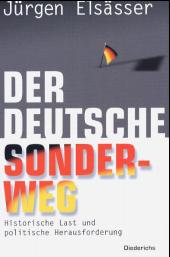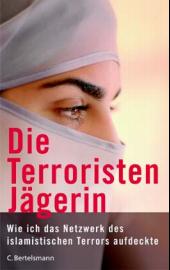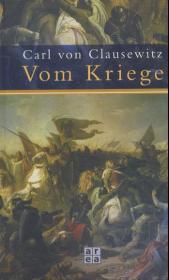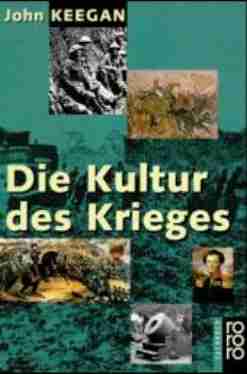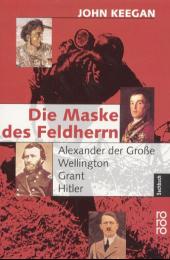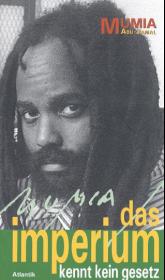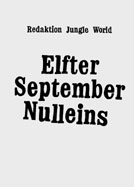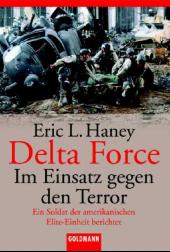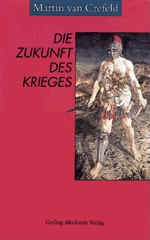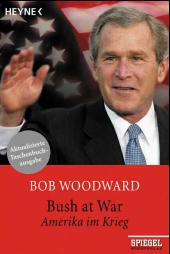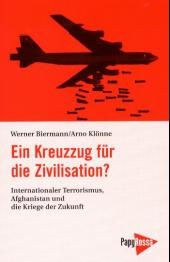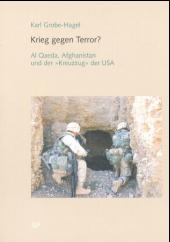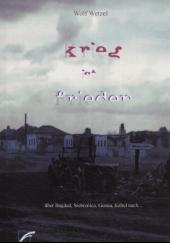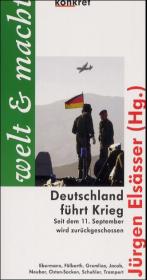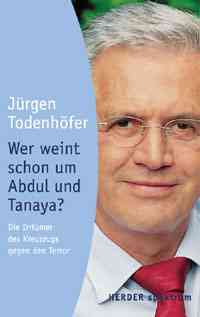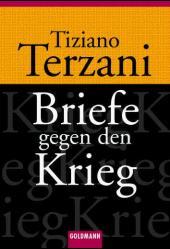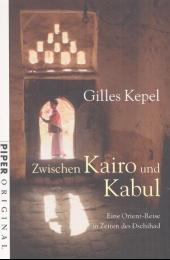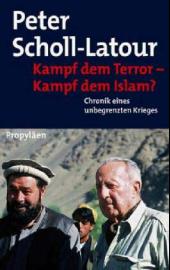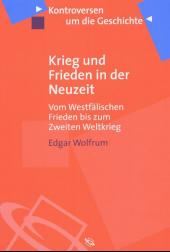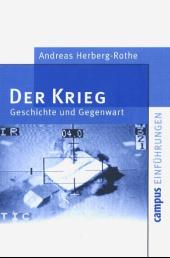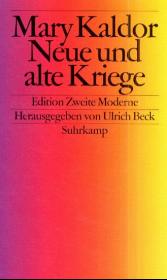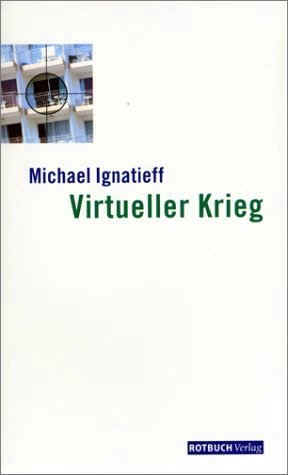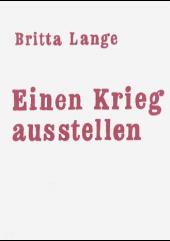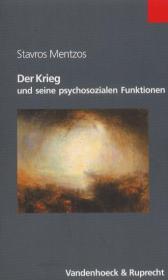|
"Anti-Terror"-Krieg |
|
|
|
Mahmood Mamdani: Guter Moslem,
böser Moslem. Amerika und die Wurzeln des Terrors. Edition
Nautilus 2006. ISBN: 3-89401-475-X.
|
|
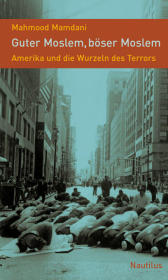
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
"Guter Moslem, böser Moslem" ist ein provokantes und wichtiges
Buch, das unser Verständnis der globalen politischen Probleme
grundlegend ändern wird.
Der in Uganda geborene Sohn indischer Einwanderer, heute Professor
an der Columbia Universität in New York, schreibt über religiösen
Fundamentalismus und seine politischen Auswirkungen. Er wendet
sich gegen die Vorstellung vom "clash of civilizations" zwischen
dem Islam und dem Westen und schildert, wie die "Achse des Bösen"
aus den von den US-Amerikanern geförderten antikommunistischen
Stellvertreterkriegen nach der Niederlage in Vietnam entstand. In
diesem Buch – protegiert von Edward Said – zeigt sich Mamdani als
leidenschaftlicher Häretiker.
Der renommierte Politikwissenschaftler und Anthropologe Mahmood
Mamdani verwirft die These von den "guten" (säkularisierten,
westlichen) und den "bösen" (vormodernen, fanatischen) Muslimen.
Er zeigt auf, dass diese Unterscheidung auf politische und nicht
auf religiöse und kulturelle Identitäten verweist. Dieses Buch
stellt das Auftauchen des politischen Islam als das Resultat des
Zusammenpralls mit den westlichen Mächten dar. Der Autor betont,
dass es sich bei der terroristischen Bewegung im Zentrum der
islamischen Politik um ein Phänomen handelt, das aus dem
US-amerikanischen Engagement in den Kriegen nach Ende des
Vietnamkriegs entstand. Die Ära dieser Stellvertreterkriege fand
ihr Ende mit der Invasion im Irak. Und hier werden die USA – wie
in Vietnam – erkennen müssen, dass es nicht um einen Feldzug gegen
den Terror geht, sondern um einen Krieg gegen den Nationalismus,
eine Schlacht, die nicht durch Okkupation zu gewinnen ist. Mamdani
schreibt mit umfassendem Einblick in die Politik der USA und
entlarvt die ideologisierte Politik der amerikanischen
Regierungen.
Rezensionen
"Mamdani deckt die Lügen, Stereotypisierungen und leichtfertigen
Generalisierungen auf, mit denen die USA ihr Verhalten gegenüber
der muslimischen Welt begründen. Bestürzend, aber essentiell." (J.
M. Coetzee)
"Dieses provokative und gedankenvolle Buch stellt unliebsame und
ernsthafte Fragen. Es ist ein wertvoller Beitrag für das Verstehen
einiger der wichtigsten Entwicklungen in der heutigen Zeit." (Noam
Chomsky)
Zum Autor
Mahmood Mamdani hat die Herbert-Lehmann-Professur am Institut für
Anthropologie an der Columbia Universität inne. Er ist ebenfalls
Direktor des Instituts für Afrika Studien. Sein guter Ruf als
Experte für afrikanische Geschichte, Politik und internationale
Beziehungen hat ihn zu einem der wichtigsten Vertreter der
zeitgenössischen Debatte über die sich verändernde Rolle Afrikas
im globalen Kontext werden lassen.
Sein Buch "Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy
of Late Colonialism" (Princeton University Press, 1996) gilt als
eines der besten, auf Englisch publizierten, wissenschaftlichen
Arbeiten über Afrika und gewann dafür den renommierten Herskovits
Award der African Studies Association in den USA (1998).
Verlagsinformation |
|
|
Herfried
Münkler: Die neuen Kriege. Rowohlt-Verlag 2004.
ISBN: 3-499-61653-X.
|
|
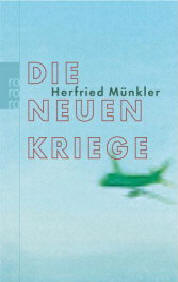
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der
klassische Staatenkrieg scheint zu einem historischen
Auslaufmodell geworden zu sein – was aber ist an ihre Stelle
getreten? Der Krieg ist keineswegs verschwunden, er hat nur seine
Erscheinungsform verändert. In den neuen Kriegen spielen nicht
mehr Staaten die Hauptrolle, sondern Warlords, Söldner und
Terroristen. Die Gewalt richtet sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung;
Hochhäuser werden zu Schlachtfeldern, Fernsehbilder zu Waffen.
Wo die Staaten nicht mehr das Monopol auf die militärische Gewalt
besitzen, tritt an die Stelle des Friedensschlusses ein
langwieriger, stets von Scheitern bedrohter Friedensprozess.
Zum Autor
Herfried Münkler, geboren 1951 in Friedberg, ist Professor für
Politikwissenschaft an der Humbold-Universität zu Berlin und
Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Er ist mit zahlreichen Studien zur politischen Ideengeschichte und
zur Theorie des Krieges hervorgetreten. Nicht wenige davon sind
mittlerweile Standardwerke, so etwa "Machiavelli" (1982), "Gewalt
und Ordnung" (1992), "Über
den Krieg" (2002) und "Die
neuen Kriege" (2004).
Verlagsinformation |
|
|
Wilhelm Heitmeyer/Hans-Georg Soeffner (Hrsg.): Gewalt:
Entwicklungen, Strukturen, Analyseprobleme. Suhrkamp-Verlag 2004.
ISBN: 3-518-12246-0. |
|
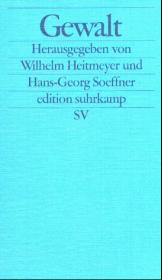
mehr
Infos
bestellen
|
Neuartige
Gewaltphänomene erfordern neue analytische Zugänge. Die
sozialwissenschaftliche
Gewaltforschung steht
daher vor einer Reihe gravierender Herausforderungen. So hat sie
immer noch zu kämpfen mit einer angemessenen und fundierten
grundsätzlichen Analyse des Verhältnisses von Modernität und
Barbarei. Hinzu kommen neue irritierende Gewaltentwicklungen, die
auch die Frage aufwerfen, ob die Gewaltforschung nahe genug an die
Phänomene heranrückt und dazu die richtigen Vorgehensweisen wählt.
Folgende Fragen stehen u.a. auf dem Prüfstand: Kann der Begriff
der physischen Gewalt noch leitend sein, oder muss die
Gewaltanalyse sich wieder stärker der strukturellen Gewalt, der
"Gewalt ohne Gesicht" zuwenden? Sind vor dem Hintergrund neuer
Ansätze in Biologie und Medizin die sozialen Hintergründe von
Gewalttaten weniger bedeutend, als bisher angenommen? Muss man
sich z.B. von der Vorstellung verabschieden, dass Bürgerkriege
durch Verhandlungslösungen beendet werden können?
Eingefahrene Erklärungsmuster, so u.a. zur langfristigen
Entwicklung von Gewaltkriminalität, zu Makroverbrechen, zu neuen
Kriegen, zur Deutungsrelevanz sozialwissenschaftlicher Forschung
im Vergleich mit Erkenntnissen der Evolutionsgeschichte des
Menschen und zur eigenen Prognosefähigkeit, müssen kritisch
überprüft werden. Angesichts neuer Gewaltentwicklungen wie den
Anschlägen des 11. September, "kleinen Kriegen" oder Amokläufen
von Jugendlichen stellt sich die Frage, ob die Gewaltforschung auf
die Zukunft der Gewalt im 21. Jahrhundert vorbereitet ist. Die
Beiträge dieses Bandes analysieren aus unterschiedlicher
disziplinärer Perspektive die verschiedenen Gewaltphänomene, ohne
sich von falschen und vorschnellen Verallgemeinerungen leiten zu
lassen.
Verlagsinformation |
|
|
Franz Alt: Krieg um Öl oder Frieden
durch die Sonne.
Goldmann-Verlag 2004. ISBN: 3-442-15289-5. |
|
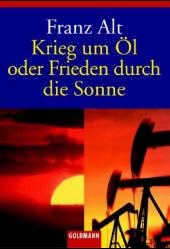
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Zu Beginn des 3. Jahrtausends ist der Energieverbrauch der
Menschheit größer denn je. Als Folge der Treibhausgase prophezeien
Wissenschaftler einen dramatischen Temperaturanstieg für dieses
Jahrhundert – mit unabsehbaren Folgen für unsere Gesellschaft.
Franz Alt belegt, dass die von den USA nach dem 11. September
angestiftete Antiterror-Allianz auch auf die Sicherung der
zentralasiatischen Ölvorkommen zielt. Eine Fortschreibung der
gegenwärtigen Entwicklung würde jedoch zu weiterem Terror und noch
größeren Umweltbelastungen führen. Franz Alt macht ganz deutlich:
Nur wenn wir vom Öl wegkommen, wird sich das Klima verändern. Nur
mit sanften Energien können wir auf eine friedliche Zukunft
hoffen.
Franz Alts brisantes Buch weist nach, dass Politik und
Energiewirtschaft aufs engste verknüpft sind. Und es benennt die
wahren strategischen Ziele der Antiterror-Allianz.
Leidenschaftlich appelliert der Autor: Schaffen wir die Nutzung
fossiler Energien ab, bevor diese uns abschafft! Frieden durch die
Sonne statt die Katastrophe durch Öl!
Zum Autor
Franz Alt, geboren 1938, studierte Politische Wissenschaften,
Geschichte, Philosophie und Theologie. Seit 1968 arbeitet er beim
SWF. 20 Jahre moderierte er das Politmagazin "Report". Seit 1992
Leitung der Sendereihe "Zeitsprung" im SWF und seit 1997 des
Magazins "Quer-Denker" in 3SAT. Neben den von ihm moderierten
Sendungen hat sich Franz Alt als Buchautor einen Namen gemacht
sowie durch sein engagiertes Eintreten für ökologisches Handeln.
Hierfür erhielt er u. a. den Umweltpreis "Goldene Schwalbe" (1992)
sowie den "Europäischen Solarpreis" (1997).
Verlagsinformation
|
|
|
Jonathan
Schell: Die Politik des Friedens.
Macht, Gewaltlosigkeit und die Interessen der Völker.
Hanser-Verlag 2004. ISBN: 3-446-20482-2. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Jugoslawien,
Afghanistan, Irak: Wir sind dabei, uns an den Krieg zu gewöhnen.
Neue Konflikte und neue Waffen, die eine "saubere" Kriegsführung
versprechen, haben Argumente verdrängt, die jahrzehntelang gegen
den Krieg vorgebracht wurden. Jonathan Schell, der mit dem
"Schicksal der Erde" seinerzeit ein Gründungsmanifest aller
ökologischen Politik vorgelegt hat, widerspricht
mit seinem neuen Buch dieser Schein-Logik der Gewalt.
Und er hat die besseren Argumente auf seiner Seite: Kein Konflikt
der vergangenen Jahrzehnte wurde mit Waffengewalt gelöst, immer
wurden Freiheit und Demokratie gewaltfrei erkämpft.
Die westlichen Staaten müssen sich von der Vorstellung
verabschieden, sie könnten ihre Ziele militärisch durchsetzen. Und
vielleicht muss sogar das Prinzip der staatlichen Souveränität auf
den Prüfstand, wenn sich internationale Konfliktlösungen als
dauerhafter erweisen. Das klingt naiv? Es wäre nicht zum ersten
Mal, dass Jonathan Schell am Ende recht behält gegen so genannte
"Pragmatiker" und "Realisten".
Zum Autor
Jonathan Schell, 1943 in New York geboren, lehrte
u.a. an der Princeton und Wesleyan University. Er schreibt
regelmäßig für "Harper's", "Foreign Affairs" sowie "The Nation"
und wurde vor allem durch sein Buch "Das Schicksal der Erde"
bekannt, das die weltweite ökologische Bewegung maßgeblich
voranbrachte. Jonathan Schell lebt in New York.
Verlagsinformation |
|
|
Dario
Azzellini/Boris Kanzleiter (Hrsg.): Das Unternehmen Krieg: Die
Washington-Pristina-Kabul-Bogota-Luanda-Berlin-Connection. Verlag
Assoziation A 2003. ISBN: 3-935936-17-6. |
|
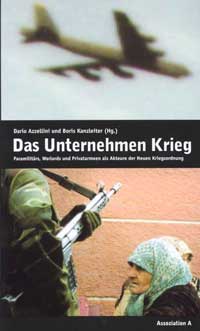
mehr
Infos
bestellen
|
Im
Neoliberalismus werden nicht nur Staatsbetriebe privatisiert,
sondern auch die Kriegführung. So übernehmen private
Militärunternehmen im Auftrag des Pentagon verstärkt
Kampfaufträge. In Afrika verwandeln sich reguläre Armeen in
private Bergbauunternehmen. Zur Aufstandsbekämpfung rüsten in
Kolumbien und der Türkei Politiker private Paramilitärs aus, die
gleichzeitig vom Drogenhandel profitieren. In Afghanistan werden
Warlords unter Protektoratsherrschaft mit Regierungsgewalt
ausgestattet.
"Das Unternehmen Krieg" geht neuen Formen der
Kriegsführung nach. Statt "Staatszerfall" und
"Chaos", wie in den Medien oft beschworen, zeichnen sich
dabei die Konturen einer "Neuen Kriegsordnung" ab. In
ihr werden private militärische Akteure von Eliten eingesetzt, um
Herrschaft zu sichern. Dabei ist oft nicht mehr ein militärischer
Sieg, sondern die Kriegführung selbst das Ziel, um Profite
erzielen zu können. Hinterlassen werden Hunderttausende von
Opfern und Gesellschaften, in denen Wege zur Emanzipation neu
eröffnet werden müssen.
Der Sammelband füllt diese Thesen mit Länderkapiteln zu
Kolumbien, der Türkei, Mexico, Guatemala, Jugoslawien,
Afghanistan, Indonesien, Kongo, Angola und den USA. Die AutorInnen
versuchen einen Beitrag zur Information und Diskussion der Neuen
Kriege zu leisten und zielen damit nicht zuletzt auf die Anti-Kriegs-
und die Friedensbewegung ab. Wichtig erscheint dabei insbesondere
die Erkenntnis, dass sich die Grenzen zwischen Krieg und Frieden
immer weiter verwischen.
Wie die im Buch dargestellten Entwicklungen zeigen, ist das
Bombardement Bagdads oder Belgrads eben keineswegs die kurzzeitige
Unterbrechung eines imaginierten "Friedens" durch den
Ausnahmezustand "Krieg". Vielmehr breitet sich in
größer werdenden Teilen des Globus ein permanenter Kriegszustand
unterschiedlicher Intensität aus, der komplexere Antworten
erfordert, als die Forderung nach dem Ende der Bombardierungen.
Quelle:
Bewegung-in-Bochum |
|
|
Jürgen
Elsässer: Der
deutsche Sonderweg. Historische Last und politische
Herausforderung. Diederichs-Verlag 2003. ISBN: 3-7205-2440-X. |
|
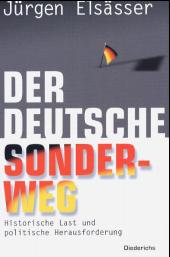
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Schröders Nein zur offenen Unterstützung des Irak-Krieges hat in
Paris und Moskau Hoffnungen geweckt, in Washington und London
hingegen schlimmste Befürchtungen: Droht ein neuer deutscher
Sonderweg? Knüpft die deutsche Politik an die Katastrophen der
Vergangenheit an? Oder nimmt Deutschland die Gelegenheit wahr, die
Abhängigkeit von den USA aufzugeben und in einer Achse mit
Frankreich und Russland eine neue europäische Entspannungspolitik
voranzutreiben?
Fundiert und kritisch analysiert Jürgen Elsässer: der deutsche
Sonderweg richtete sich, anders als meist dargestellt, nie gegen
die USA, sondern immer gegen Europa, vor allem gegen Frankreich
und Russland. Die Zerstörung Europas betrieb Deutschland bis 1945
im Alleingang. Dieser Sonderweg wurde nach der deutschen Vereinigung
von 1989 im Bündnis mit den USA fortgeführt. Die Verweigerung
beim zweiten Irak-Krieg eröffnet der Berliner Republik erstmals
die Chance zu einem Ausgleich mit seinen europäischen Nachbarn.
Elsässer deckt den Interessenkonflikt zwischen der
Vormachtstellung der USA und deutschem Dominanzstreben in Europa
auf. Der Autor steckt den Spielraum ab, der Deutschland trotz
seiner Exportabhängigkeit von den Amerikanern bleibt. Damit
liefert er den Schlüssel zum Verständnis deutscher Außenpolitik.
Die große Chance, so Elsässer, liege in der
Rückbesinnung auf eine europäische Entspannungspolitik.
Zum Autor
Jürgen Elsässer (Jahrgang 1957) ist Verfasser zahlreicher
Bücher über die deutsche Außenpolitik. "Wenn Joschka
Fischer zurücktreten muss, dann hoffentlich deswegen",
urteilte die Wiener Tageszeitung "Die Presse" über
"Kriegsverbrechen", sein Standardwerk zum
Jugoslawienkrieg. Im Deutschlandfunk wurde bemerkt, dass "seine
Thesen den Raum für eine grundlegende, spannende und notwendige
Debatte" eröffnen. Dem "Spiegel" galt er hingegen
als "professionelle(r) Zyniker mit altlinken Klischees".
Elsässer war bis Juni 1997 leitender Redakteur der Berliner
Tageszeitung "junge Welt" und von April 1999 bis
Dezember 2002 Redakteur der KONKRET. Daneben arbeitet er unter
anderem für die "Allgemeine Jüdische Wochenzeitung",
die "Süddeutsche Zeitung", den WDR und das
"Kursbuch". Seit Anfang 2003 schreibt er wieder für die
"junge Welt".
Verlagsinformation
Weitere Informationen
-
Paris – Berlin – Moskau (junge
Welt, 25.04.2003)
-
Inhaltsverzeichnis
(Medienanalyse International)
|
|
|
Edward
Luttwak: Strategie.
Die Logik von Krieg und Frieden. Zu Klampen
Verlag
2002. ISBN: 3-934920-12-8.
|
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der schnellste, leichteste, kürzeste Weg zum Ziel ist auch der
beste. Im Normalfall. Nicht so im Konfliktfall, wenn Gegner
aufeinandertreffen, die ihren Willen mit Gewaltdrohung oder gar
Gewaltanwendung durchsetzen möchten. Wer im Konfliktfall nicht
untergehen will, muss den Bereich geradlinigen Denkens,
eingleisiger Optimierung, linearer Logik verlassen und strategisch
zu denken beginnen. Strategisch denken aber heißt in Paradoxa
denken. "Wenn Du Frieden willst, bereite den Krieg";
"Aufrüstung mit offensiven Waffen kann ausschließlich
defensive Zwecke haben"; "Die schlechteste Straße kann
der beste Weg in die Schlacht sein": Edward Luttwak zeigt,
dass das Reich der Strategie von solchen scheinbar widersprüchlichen
Aussagen durchzogen ist.
Mit zahllosen Beispielen aus der Geschichte kann er belegen, dass
ein Sieg sich durch Maßlosigkeit in eine Niederlage verwandelt,
dass Krieg durch Erschöpfung in Frieden übergeht, dass
UNO-Friedensmissionen oft das Gegenteil des Gewollten erreichen,
weil sie den Krieg verlängern, statt die zugrunde liegenden
Konflikte zu lösen. In seinem Werk exerziert Luttwak die paradoxe
Logik des Strategischen auf den verschiedenen Konfliktebenen
durch: von den großen strategischen Szenarien in Politik und
Generalstäben bis hin zur Gefechtsebene auf dem Schlachtfeld.
Dabei reflektiert er auch die jüngsten kriegerischen
Auseinandersetzungen wie den Golfkrieg 1991, den Kosovo-Krieg und
die Ereignisse nach dem 11. September 2001. Mit Strategie hat
Edward Luttwak ein Grundlagenwerk geschaffen, das die Logik
kriegerischer Konflikte ebenso erhellt wie die der großen
politischen und geostrategischen Auseinandersetzungen.
Rezensionen
"Für Kriegsfürsten wie für Friedensstifter ist 'Strategie.
Die Logik von Krieg und Frieden' unabdingbare Lektüre."
(Harry G. Summers, New York Times Book Review)
"Man muss Luttwaks 'realpolitische' Einstellung nicht mögen,
um den immensen Nutzen dieses Buches schätzen zu können. Luttwak
kennt die Materie militärischer und politischer Strategie und
stellt sie intelligent und verständlich dar. In einer Zeit, in
der der Einsatz von Militär wieder zum Mittel der Politik
geworden ist, von der Terrorismusbekämpfung bis zur
Friedenssicherung, ist es auch für die Skeptiker unerlässlich,
die Grundlagen des dahinter stehenden Denkens zu kennen. Luttwaks
Arbeit ist dafür eine denkbar geeignete Handreichung."
(Harald Müller, Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung)
"Kenntnisreich, historisch genau, scharf, schonungslos. Man
kann Luttwaks erbarmungslosen Stil mögen oder nicht, man kann
seinen ungeschützten Urteilen zustimmen oder nicht. In jedem
Falle ist dieses Buch ein enorm wichtiger Beitrag zum Verständnis
dessen, was Strategie ist." (Thomas C. Schelling, Harvard
University)
"Nicht immer überzeugt Luttwak, aber immer provoziert er. In
diesem superben Buch, das zu einem Klassiker der Strategie werden
wird, tut er beides. Seine Definitionen der fünf Ebenen von
Strategie bereichern unser Wissen, und seine historischen
Beispiele faszinieren." (Gregory F. Treverton, Foreign
Affairs)
Zum Autor
Edward Luttwak wurde 1942 in Siebenbürgen geboren, studierte in
Italien, England und den USA. Er war Berater des Secretary of
Defence, des U.S. Department of State und des japanischen
Finanzministers. Er ist Senior Fellow am Center for Strategic and
International Studies in Washington D.C. und Mitherausgeber von
"Geopolitique" und "Washington Quarterly".
Seine Bücher – darunter Coup d'Etat (1968), Strategy: The Logic
of War and Peace (1987), The Endangered American Dream (1993) –
wurden in vierzehn Sprachen übersetzt. In Deutschland erschien
1994 Weltwirtschaftskrieg – Export als Waffe (Ullstein).
Verlagsinformation |
|
|
Anonymous:
Die Terroristenjägerin. Wie ich das Netzwerk des
islamistischen Terrors aufdeckte. Bertelsmann-Verlag 2003. ISBN:
3-570-00756-1.
|
|
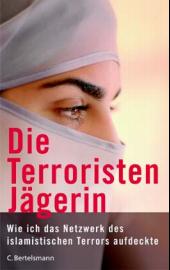
mehr
Infos
bestellen
|
Eine
Frau wagt sich ins Herz des radikalislamischen Terrors und
düpiert die mächtigsten Geheimdienste der Welt. Erstmals
berichtet die 'Terroristenjägerin', eine im Irak geborene Jüdin,
über ihr Doppelleben als Undercover-Agentin in den USA. Tagsüber
ist sie eine muslimische Frau mit besten Kontakten zu
radikalislamischen Gruppen, die in Amerika operieren; abends ist
sie jüdische Ehefrau und Mutter von vier Kindern.
Bereits in den Neunzigerjahren stößt sie zunächst zufällig auf
islamische Extremisten mit besten Kontakten in amerikanische
Regierungskreise. Ihre Kenntnisse der arabischen Welt und Sprachen
bringen sie auf die Spur eines engmaschigen antiamerikanischen
Terrornetzes, in das saudiarabische Millionen wie amerikanische
Steuergelder fließen. Die Aktivitäten von Bin Laden und Al-Kaida
waren ihr lange vor dem 11. September 2001 bekannt. Doch weder CIA
noch FBI waren sonderlich daran interessiert.
Das Urteil der 'Terroristenjägerin' nach dem Anschlag auf das
World Trade Center: Die US-Geheimdienste und das Weiße Haus haben
komplett versagt; sie haben Informationen aus Eitelkeit und
Ignoranz negiert oder falsch interpretiert. Und sie haben bis
heute keine Ahnung von Wesen und Struktur des islamistischen
Terrors. Der 11. September hätte verhindert werden können. Doch
die Bedrohung Amerikas durch radikalislamische Terroristen ist
ungebrochen. In diesem aufrüttelnden Buch entlarvt eine einzelne
Frau die Unfähigkeit von Geheimdiensten und der Regierung einer
Weltmacht.
Verlagsinformation |
|
|
Carl
von Clausewitz: Vom Kriege. Ullstein-Verlag 2003. ISBN:
3-89996-014-9. |
|
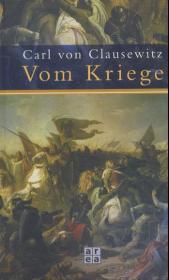
mehr
Infos
bestellen
|
"Vom
Kriege" gilt als das bedeutendste Werk, das jemals über die
Kriegsführung verfasst wurde. Seinen Rang verdankt es
insbesondere den ersten Kapiteln, in denen Clausewitz eine
allgemeine Wesensbestimmung des Krieges vornimmt. In seinen
Kernaussagen, wie der These vom politischen Charakter des Krieges,
von seiner Doppelnatur als traditionellem und revolutionärem
Krieg und seiner Bestimmung als Gewaltakt, der der Erfüllung des
eigenen Willens dient, reicht sein Ansatz weit über den
militärischen Bereich hinaus.
Von Clausewitz analysiert, wie der ursprüngliche Titel besagt,
Krieg und Kriegsführung, und zwar als ein allgemeines Phänomen.
Zwar erkennt auch Clausewitz an, dass der Krieg ein "Akt der
Gewalt [ist], um unseren Gegner zu zwingen, unseren Willen zu tun",
aber sieht ihn immer als einen Teil der Politik. Clausewitz
liefert mit seinem Werk keine einfachen strategischen Regeln zur
sofortigen Anwendung, sondern formuliert allgemeine Erkenntnisse,
die den Leser zu eigenen Schlüssen und Einsichten führen sollen.
Darüber hinaus betont er bei der Darstellung der Strategie immer
das psychologische Moment und den unvorhersehbaren Einfluss des
Zufalls, die beide zwangsläufig dazu führen, dass Kriegsführung
– oder Strategie im Allgemeinen – keine exakte Wissenschaft sein
kann. Schon wegen solcher Einsichten nähert er sich dem Problem
weit vielschichtiger an, als dies das bekannteste Zitat aus dem
Werk vermuten lässt, nach dem der Krieg bloß die Fortsetzung der
Politik mit anderen Mitteln sei.
Verlagsinformation
|
|
|
John Keegan: Die Kultur des
Krieges. Rowohlt-Verlag 1997. ISBN: 3-499-60248-2. |
|
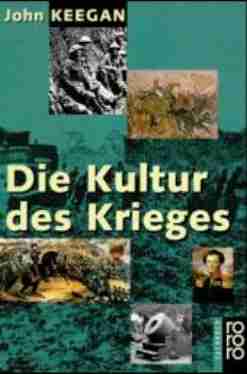
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die Geschichte des Krieges und der Kriegskunst ist immer auch als
Geschichte der menschlichen Zivilisation zu verstehen. Und
umgekehrt: erst wenn sich ein technischer oder sozialer
Fortschritt auch für die Zwecke des Krieges nutzen ließ, war er
auf Dauer durchsetzbar. John Keegan spannt den Bogen von den
Kämpfen der Steinzeit bis zur drohenden Apokalypse der
Massenvernichtungswaffen unserer Tage, und immer trägt die
menschliche Aggression andere Züge. Das Buch zeigt exemplarisch,
dass Kultur und Zerstörung Hand in Hand gehen und dass die Art,
wie ein Volk Krieg führt, Rückschlüsse auf den Stand seiner
Zivilisation zulässt.
"John Keegan ist der lesenswerteste
und zugleich originellste Militärhistoriker der Gegenwart. In
seinem neuen Buch werden die Erkenntnisse der Anthropologie, Ethnologie,
Psychologie und Geschichte zu einer ebenso knappen wie
erschöpfenden Synthese zusammengezogen..."
(Michael Howard, The New York Times
Book Review)
Zum Autor
John Keegan, geboren 1934, gilt als einer der bedeutendsten
britischen Historiker. Er lehrte viele Jahre an der
Militärakademie in Sandhurst und hat zahlreiche Bücher verfasst.
Verlagsinformation
|
|
|
John
Keegan:
Die
Maske des Feldherrn.
Alexander der Große, Wellington, Grant, Hitler.
Rowohlt-Verlag
2000. ISBN: 3-499-60737-9. |
|
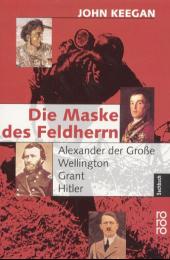
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
An
der Spitze einer jeglichen militärischen Streitmacht stehen die
Feldherren. Deren Kunst, ein Amalgam
aus Handwerk, Psychologie und Theatralik, ist beredter Ausdruck
ihrer Epoche. Über
eine Spanne von 2000 Jahren analysiert John Keegan vier Archetypen
von Führerschaft in vier verschiedenen Gesellschaften. Am
Beispiel von Alexander dem Großen, Wellington, Grant und Hitler
beschreibt der Autor Mythos und Moral militärischer Führerschaft
und zieht Folgerungen für die Gegenwart. Dabei
reicht die luzide Psychologie dieser vier biographischen Skizzen
weit über das nur Militärische hinaus. Krieg,
so die These des Autors,
ist der barbarische Begleiter einer jeden Zivilisation.
Zum Autor
John Keegan, geboren 1934, gilt als einer der bedeutendsten
britischen Historiker. Er lehrte viele Jahre an der
Militärakademie in Sandhurst und hat zahlreiche Bücher verfasst.
Verlagsinformation
|
|
|
Mumia
Abu-Jamal: Das Imperium kennt kein Gesetz. Texte gegen Globalisierung
und Krieg. Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von
Jürgen Heiser. Atlantik-Verlag 2003. ISBN: 3-926529-59-8. |
|
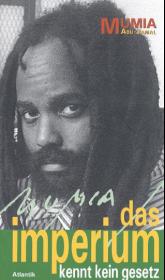
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der zu Unrecht zum Tode verurteilte afroamerikanische Journalist
und Autor Mumia Abu Jamal legt mit diesem bislang nur in
Deutschland erschienenen Buch eine Auswahl seiner aktuellen Essays
vor, die seit Dezember 2000 als Kolumnen in der Samstagsausgabe
der Berliner Tageszeitung junge Welt veröffentlicht wurden.
Auszug aus dem Vorwort des Buches:
"...Mumia Abu-Jamals Essays fordern uns auf zu handeln und
die oppositionellen Strömungen in allen gesellschaftlichen
Bereichen zu integrieren und zu bündeln und sie gerade jetzt, in
diesem historischen Moment, zu einer Kraft zu entwickeln, die den
Kriegstreibern ihre wichtigste Waffe aus der Hand nimmt: Die
Zustimmung der Bevölkerung, egal in welchem Land der Erde.
Letztlich geht es darum, der neuen Weltkriegsordnung, die jetzt
unter Führung der USA errichtet werden soll, eine von der
gesellschaftlichen Basis her aufgebaute gerechte und soziale
Weltordnung entgegenzusetzen.
In jedem Land, jedem Ort auf diesem Planeten gibt es Menschen, die
von dieser Einsicht getragen werden und die nicht stumm und
tatenlos zusehen wollen, wie die Zukunft der Menschheit von
unverantwortlichen Kriegstreibern und Machtbesessenen verspielt
wird. An diese Menschen richtet sich Mumia Abu-Jamal.
Dass seine Essays in dieser Zusammenstellung zuerst in Deutschland
erscheinen, ist kein Zufall. Die europäischen NATO-Mitgliedsstaaten
und so auch die deutsche Regierung haben nach dem Zweiten
Weltkrieg ausnahmslos jedes Verbrechen der US-Außenpolitik
gedeckt und mitgetragen. Diese Mittäterschaft spiegelt sich auch
in den Essays von Mumia Abu-Jamal, selbst wenn sie nicht direkt
erwähnt wird. Die europäischen NATO-Staaten werden sich auch
jetzt trotz aller bündnisinternen Widersprüche, trotz zum Teil
entgegengesetzter Interessen zwischen USA und Europa und daraus
folgenden taktischen Manövern aus keinem Krieg heraushalten, bei
dem es um die neokoloniale Aufteilung des Nahen und Mittleren
Ostens und die Eroberung der Energieressourcen zur Sicherung und
Aufrechterhaltung der herrschenden Wirtschaftsordnung geht.
Der Konflikt um Palästina und Israel ist bestes Beispiel dafür.
Und nichts wird vergessen. Auch Rolle, Verfassungsbruch und
Verbrechen der deutschen Regierung im Krieg gegen das Volk
Jugoslawiens 1999 nicht. Dafür sorgt das Erbe, das wir von den
Frauen und Männern aus dem antifaschistischen Widerstand übernommen
haben: "Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!" Es ist
gerade deswegen von großer Bedeutung, dass die Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten und
Antifaschistinnen (VVN-BdA) Mumia Abu-Jamal im letzten Jahr auf
ihrem Kongress zu ihrem Ehrenmitglied ernannt hat."
Zum Autor
Seit zwei Jahrzehnten schreibt Mumia Abu-Jamal aus der Todeszelle
seine kritischen Essays und Kolumnen, die der Öffentlichkeit ein
schonungsloses Bild aus den Todestrakten der USA zeigen, was den
Abgeordneten Mike McCeehan zu der Äußerung veranlasste: "Ob
er einen Polizisten umbringt oder einen Buchvertrag im Gefängnis
unterschreibt - für das eine wie das andere wird er büßen."
Seine Veröffentlichungen lösten heftige Kontroversen aus und
trugen wesentlich dazu bei, dass sich die öffentliche Meinung über
die Todesstrafe veränderte. In diesem Klima kämpft er um die
Wiederaufnahme seines Verfahrens, unterstützt von einer großen
internationalen Solidaritätsbewegung.
Verlagsinformation
|
|
|
Die
Redaktion Jungle World (Hrsg): Elfter September Nulleins.
Die Anschläge, Ursachen und Folgen. Ein Kongress-Reader.
Verbrecher-Verlag 2002. ISBN: 3-935843-17-8.
|
|
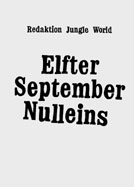
mehr
Infos
bestellen
|
Kurz
nach dem elften September Nulleins wurden
die
unterschiedlichsten Ansichten vertreten: Manche neigten zu der
These, dass die Anschläge auf das World Trade Center und das
Pentagon nur einen Vorwand lieferten, um einen neuen
imperialistischen Krieg zu führen. Andere sahen darin die
Offensive einer faschistischen islamischen Bewegung, die mit allen
Mitteln gestoppt werden sollte. Was hat sich ein Jahr danach bestätigt,
was muss man revidieren? Und welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für eine emanzipatorische Kritik der Verhältnisse?
Vom 6. bis zum 8. September 2002 fand an der Technischen Universität
(TU) in Berlin ein Kongress zum Thema 11. September statt. Er
sollte eine erste Zwischenbilanz nach den Anschlägen in den USA
darstellen und dabei internationale Debatten mit einbeziehen. Die
Rezeption der Ereignisse vom 11. September in Deutschland und
Europa und die damit verbundene Zunahme des Antisemitismus
bildeten dabei einen Schwerpunkt der Diskussionen. Auch die
Kontroverse über den möglichen Krieg gegen den Irak zog sich
durch alle Foren.
Der hier nun vorliegende Band soll die Diskussionen, die auf dem
Kongress geführt wurden, dokumentieren. Die Beiträge, die in
diesem Buch versammelt sind, spiegeln die unterschiedlichen
Positionen der Teilnehmer des Kongresses wider. Bereits vor dem
Kongress veröffentlichte die "Jungle World" eine Reihe
von Texten, die sich meist sachlich, zum Teil polemisch mit der
Haltung der Linken zu den Anschlägen beschäftigte. Auch sie sind
in diesem Reader nachzulesen.
Verlagsinformation/Michael
Kraus
Leseprobe |
|
|
Eric
L. Haney: Delta Force, Im Einsatz gegen den Terror. Ein Soldat
der amerikanischen Elite-Einheit berichtet.
Goldmann-Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN: 3-442-15215-1. |
|
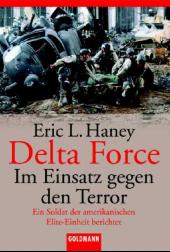
mehr
Infos
bestellen |
Topaktuell:
Ein fesselnder Insider-Report über die amerikanische
Anti-Terror-Einheit Delta Force. Die modernen Krieger der
Elite-Kampftruppe sind zum Schutz der Nation in Krisengebieten auf
der ganzen Welt im Einsatz. Eric L. Haney ist einer der
Mitbegründer dieser Spezialeinheit, der er über zwanzig Jahre
angehörte. Anwärter müssen sich einem harten Testverfahren
unterziehen, nur die Besten werden mit den riskanten Missionen
betraut. Packend, intelligent, von atemberaubender Spannung.
Verlagsinformation |
|
|
Martin
van Creveld: Die Zukunft des Krieges. Vorwort von Peter
Waldmann. Gerling Akademie-Verlag 1998. ISBN: 3-932425-04-9. |
|
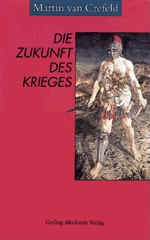
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der Krieg der Zukunft: ohne Regeln, der politischen Kontrolle
entzogen, ohne klare Fronten. Diese neue Logik zu erkennen ist
notwendig, um politische Steuerung und Präventivkraft
zurückzugewinnen. Martin van Creveld hat ein aktuelles,
politisches Sachbuch vorgelegt, klar geschrieben und entfernt von
plattem Militarismus oder einem von ihm als unrealistisch
eingeschätztem Pazifismus.
Bürgerkriege, Massaker an Zivilbevölkerungen, Guerillakämpfe,
internationaler Terrorismus: gegenwärtige Formen kriegerischer
Aktionen, die mit den Kategorien des klassischen Krieges nicht
mehr zu beschreiben sind. Die organisierte große Armee, die
staatliche Führung als oberster Befehlshaber und die Nation, aus
der sich die Armee rekrutiert, haben ihre Rolle an Milizionäre,
Berufsterroristen, Stammeskrieger und Söldner abgetreten. Sie
werden, und das in wachsendem Maße, die zukünftigen Kriege
beherrschen.
Martin van Creveld, israelischer Militärtheoretiker von
internationalem Ansehen, hat in seinem Buch die Dynamik und Logik
dieser Kriege beschrieben: "Low intensity wars"
durchbrechen völkerrechtliche Konventionen, entziehen sich der
politischen Kontrolle und missachten die Trennung von
organisierter Armee und unbewaffneter Zivilbevölkerung. Die
Analyse von Creveld, konkret entwickelt aus den gegenwärtigen
Kriegsereignissen im ehemaligen Jugoslawien, im Libanon, in
Algerien, Ruanda, Georgien und anderswo, ist von höchster
politischer Bedeutung. Liefert sie doch die Instrumente, um das
globale Sicherheitsrisiko der Kriegsbedrohung zu verstehen, in der
internationalen Politik zu kontrollieren und die Chancen einer Prävention
und Friedensstrategie zu eröffnen.
Genau an diesem Punkt setzt das moralische Anliegen von Martin van
Crevelds Buch an. Weit von einem unrealistischen Pazifismus und
platten Militarismus entfernt betont er einerseits die sozialen
und anthropologischen Antriebskräfte von Kriegen. Diese machen es
unwahrscheinlich, dass Kriege ein für allemal aus
zwischenstaatlichem Verkehr und innerstaatlichen Konflikten
verbannt werden können. Auf der anderen Seite legt er die
Mechanismen und Regeln zukünftiger kriegerischer
Auseinandersetzungen frei - die Voraussetzung für die Politik und
ihre Steuerungsfähigkeit angesichts der Bedrohung.
"Martin
van Creveld ist einer der führenden Militärhistoriker der
Gegenwart. Seine Gedanken zur Zukunft von Krieg und strategischer
Kriegsführung sind brillant, umstritten, zuweilen voreilig und
immer provokativ. Sie werden eine breite Diskussion auslösen."
(Walter Laqueur)
Zum Autor
Martin van
Creveld, einer der führenden Militärhistoriker der Gegenwart,
wurde 1946 in Holland geboren. Seit 1950 lebt er in Israel.
Studium an der London School of Economics und an der Hebrew
University in Jerusalem, wo er seit 1971 als Professor für
Geschichte lehrt. Darüber hinaus ist er als militärischer
Berater und Referent in der gesamten westlichen Welt tätig.
Verlagsinformation
|
|
|
Michael
Howard: Die Erfindung des Friedens. Über den Krieg und die
Ordnung der Welt. Zu Klampen Verlag 2001. ISBN: 3-924245-98-3. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Seit Krieg für Deutschland wieder führbar geworden ist, haben
sich Buchmarkt und Feuilletons seiner als Thema bemächtigt und
berichten mit wohligem Schaudern über den möglichen Ernstfall.
Um das Thema Frieden hingegen ist es erstaunlich ruhig geworden,
seit die Bundesrepublik wieder zu einem souveränen Staat geworden
und die Friedenspflicht der "Nation von
Kriegsverbrechern" vergessen ist.
Michael Howard, der bedeutendste lebende Kriegshistoriker aus
England, wirft in seinem von der Friedrich-Ebert-Stiftung
preisgekrönten Essay einen nüchternen Blick auf die Geschichte
des Krieges - gerade um die große aufklärerische Idee eines
"ewigen Friedens" nicht preiszugeben.
"Krieg", so lautet Howards Grundthese, "scheint so
alt zu sein wie die Menschheit, Frieden aber ist eine moderne
Erfindung". In der ganzen menschlichen Geschichte war Krieg
für die überwältigende Mehrzahl der Gesellschaften eine
selbstverständliche Angelegenheit, durch die Rechts- und
Sozialstruktur entscheidend geprägt wurden.
Erst seit der Aufklärung gilt Krieg als das Übel schlechthin,
das durch eine rationale soziale Organisationsform abgeschafft
werden soll, eine Vorstellung, die nach den Weltkriegen zum
Daseinsgrund von Völkerbund und Vereinten Nationen geworden ist.
Dennoch scheinen seit einigen Jahren Anzahl und Intensität
kriegerischer Konflikte wieder zuzunehmen. Ist Krieg also nach wie
vor ein unvermeidlicher Bestandteil der internationalen Ordnung?
Sind Krieg und Frieden immer noch zwei Seiten einer Medaille?
Verändert die aktuelle Schwächung der Nationalstaaten nur die
Art der Kriegsführung oder läutet sie ein Ende des Krieges ein?
Im Anschluss an die Betrachtung der großen historischen
Veränderungen im Verhältnis von Gesellschaft und Krieg kommt
Howard in seinem brillanten Essay, der als eine Bilanz seiner
lebenslangen Studien gelten kann, auf die Bedingungen zu sprechen,
unter denen die Idee eines ewigen Friedens nach den Veränderungen
von 1989 realisiert werden könnte.
"In seinem brillanten Buch entfaltet der Militärhistoriker
Michael Howard die seltsame und prekäre Natur des Friedens, sowie
die drängenden Fragen, die sich daraus für unsere Zeit ergeben.
Zwar konzentriert er sich auf einen besonders blutigen Kontinent:
das Europa der letzten 1200 Jahre. Doch seine Schlussfolgerungen
sind von globaler Bedeutung." (The Financial Times)
"Das Buch ist so voller Ideen, dass es jeden begeistern wird,
der sich auch nur im geringsten für die Frage interessiert, wie
die Welt an ihren derzeitigen Entwicklungspunkt gelangt ist."
(The Irish Times)
"Manchmal sind kleine Schriften lohnender zu lesen als dicke
Bücher. Dazu gehört ohne Zweifel Michael Howards Essay
'Erfindung des Friedens'". (Stuttgarter Zeitung)
"Ein historischer Essay im besten Sinne: thesenfreudig,
kenntnisreich und in einer klaren Sprache; frei von der
schwerfälligen Last der Anmerkungen." (NDR 4 / Politische
Bücher)
Zum Autor
Michael Howard, Jahrgang 1922, lehrte an einigen der
renommiertesten Universitäten des angelsächsischen Sprachraums
und ist Mitbegründer des International Institute for Strategic
Studies. Die Jury würdigt den großen Essay des englischen
Historikers als "ein Fanal gegen die Resignation, die viele
angesichts der augenblicklichen Weltlage zu befallen droht. In
klarer, konzentrierter Sprache gelingt es Howard, die Hoffnung zu
vermitteln, dass die Idee des Friedens nicht nur gedacht, sondern
Friede tatsächlich verwirklicht werden kann."
Verlagsinformation
|
|
|
Bob
Woodward: Bush at War.
Amerika im Krieg. Deutsche Verlagsanstalt/Spiegel-Verlag 2003.
ISBN: 3-421-05698-6. |
|
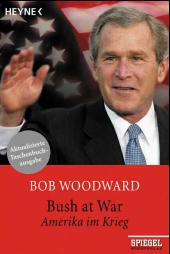
mehr Infos
bestellen
|
Am
11.09. lenken Terroristen Flugzeuge in das World Trade Center und
das Pentagon. Dieser Anschlag trifft die Regierung Bush weitgehend
unvorbereitet. Noch am selben Abend tritt der Nationale
Sicherheitsrat, ein kleiner Kreis von Regierungs-, CIA- und
Militärangehörigen, im Bunker des Weißen Hauses zusammen, um
über das weitere Vorgehen zu beraten. Bush sieht das Land im
Krieg gegen den Terror, der außergewöhnliche Maßnahmen
erfordert.
Wenig später gibt er den Befehl, in Afghanistan gegen Bin Laden,
al-Qaida und die Taliban vorzugehen, und auch ein Angriff auf
Saddam Hussein wird im Kriegskabinett immer wieder erwogen. Aus
den Protokollen des Nationalen Sicherheitsrats, Aufzeichnungen und
zahlreichen Gesprächen mit Beteiligten, darunter Präsident Bush,
rekonstruiert Bob Woodward die dramatischen Ereignisse seit dem
11. September. Dabei zeichnet der Star-Reporter ein ungewöhnlich
intimes Bild der prominenten Berater und Mitarbeiter des
Präsidenten und zeigt, wie die Mächtigen in Washington in der
Krise zu Entscheidungen über den Krieg finden.
Bob Woodward, einer der beiden Watergate-Journalisten und
Pulitzer-Preisträger, zeichnet ein dramatisches Bild der
Krisenstäbe, der Entscheidungen über internationale Allianzen,
Waffeneinsätze und Bombardierungen. Die Öffentlichkeit erfährt
hier zum ersten Mal von den persönlichen Eitelkeiten, Antipathien
und Grabenkämpfen der amerikanischen Entscheidungsträger.
"Wer Woodward gelesen hat, wird glauben, bei Bush und den
Seinen dabei gewesen zu sein." (DIE ZEIT)
"Woodward gelang ein Coup: Er konnte die Sitzungsprotokolle
des Nationalen Sicherheitsrates an Land ziehen. Aus ihnen ergab
sich die einzigartige Perspektive seines Buchs." (DER SPIEGEL)
Klappentext |
|
|
Werner
Biermann/Arno Klönne:
Ein
Kreuzzug für die Zivilisation? Internationaler Terrorismus,
Afghanistan und die Kriege der Zukunft.
Papyrossa-Verlagsgesellschaft 2002. ISBN: 3-89438-239-2.
|
|
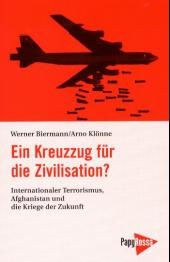
mehr
Infos
bestellen
|
Seit
dem 11. September sei, so heißt es, nichts mehr wie es war.
Demgegenüber legen die Autoren dar, dass für die Politik der USA
von einem "Paradigmenwechsel" als Reaktion auf die
Terroranschläge nicht die Rede sein kann. Vielmehr stellen sich
unbequeme Fragen: Was hat speziell die US-amerikanische Strategie
mit dem Terrorismus zu tun? Kamen im Afghanistankrieg
geopolitische Ambitionen zum Zuge, die längst vorbereitet waren?
Hätte bin Laden als "Stargegner" nicht womöglich
erfunden werden müssen, um von der realen Konfliktlage
abzulenken? Um welche Ziele ging es somit in diesem Krieg? Wie
weiter in Afghanistan und in der Region? Und wer ist als nächster
dran? Sodann: Welche Rolle spielt eigentlich Deutschland dabei?
Ist es wirklich der Musterschüler, als der es sich so
demonstrativ geriert? Was verbirgt sich hinter seiner
"uneingeschränkten Solidarität mit Amerika" an eigenen
Interessen? Und wo sind Ansätze wirksamer Antikriegsopposition?
Verlagsinformation |
|
|
Karl
Grobe-Hagel: Krieg gegen Terror? Al Qaeda, Afghanistan und der
"Kreuzzug" der USA. Neuer ISP-Verlag 2002. ISBN:
3-89900-105-2.
|
|
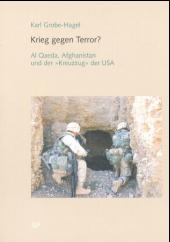
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Karl Grobe-Hagel legt mit seinem Buch
"Krieg gegen Terror?" eine umfassende Bilanz des
Afghanistankriegs und dessen Ausweitung durch die USA vor.
Ausführlich wird dargestellt, wie aus dem "Kampf gegen den Terror"
erst der Afghanistankrieg, dann die Errichtung eines weltweiten
neuen Militärstützpunkt-Systems der USA und schließlich die
Ausweitung der Kriegsdrohungen auf andere Länder durch die
Proklamation der "Achse des Bösen" erwuchsen. Dass dies keine
leeren Worte sind, zeigt die Vorbereitung eines Krieges gegen den
Irak durch die Bush-Administration.
Zum Autor
Karl
Grobe-Hagel ist seit über 30 Jahren im außenpolitischen Ressort der
FR (Frankfurter Rundschau)
tätig.
Verlagsinformation |
|
|
Wolf
Wetzel: Krieg ist Frieden. Über Bagdad, Srebrenica, Genua,
nach Kabul ... Unrast-Verlag 2002. ISBN: 3-89771-419-1.
|
|
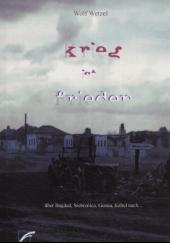
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Weder die
terroristische Logik noch die Zahl ziviler Opfer unterscheiden
die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon vom
11. September 2001 von anderen kriegerischen Akten. Das Besondere
an ihnen ist die Tatsache, dass sie auf dem Territorium der USA
stattfanden. Nicht die friedliebende und Freiheit spendende Verfasstheit
der USA wurden dabei erschüttert, sondern der feste Glaube an die
eigene militärische Unverwundbarkeit.
Der als Antwort auf die
Anschläge vom 11.9.2001 ausgerufene Weltkrieg hat nicht das
geringste mit einem "Kampf gegen den Terror" zu tun.
Weder die USA noch die Alliierten haben in den letzten 50 Jahren
Krieg geführt, um Terror und Gewalt zu bekämpfen, sondern das
Monopol darauf zu behaupten. Ein Monopol auf Terror und Zerstörung,
das Voraussetzung dafür ist, imperiale und kapitalistische
Interessen auch ganz "friedlich" durchzusetzen.
Neben der Analyse des real existierenden Imperialismus widmet sich
Wetzel in seinem brillanten Buch mit dem treffenden Untertitel "...über
Bagdad, Srebenica, Genua, Kabul nach..." auch kritisch den "linken" deutschen
Bellizisten, welche die rot-grüne Beteiligung an den
Angriffskriegen der letzten Jahre überhaupt erst möglich gemacht
haben. Wetzel zeichnet dabei die wichtigen Stationen seit dem 2. Golfkrieg bis
zum
Vorfeld des angekündigten Irakkriegs nach.
In seinen kurzen, pointierten Stellungnahmen
zeigt der Autor vor allem die Fehler und Mängel der deutschen Linken
auf. Ein wichtiger Aspekt ist die Auseinandersetzung
mit den Bellizisten, die sich immer offensichtlicher auf die Seite
der Herrschenden stellen und imperialistische Kriege von einer
angeblich linken Position gutheißen - seien es nun ehemalige '68er
oder die um 1989 zur Zeit des deutschen Vereinigungsprozesses
entstandene linksradikale Sekte der "Antideutschen". Der
Autor weist dabei nach, wie insbesondere regierungsnahe
"linke" Bellizisten den
notwendigen politisch-ethischen Flankenschutz und damit die
Voraussetzung für rot-grüne Kriegsbeteiligungen geliefert haben.
Mit seiner konsequenten Antikriegshaltung, die ausgesprochen keine
pazifistische ist, nimmt er vor allem die deutsche
Propagandamaschine auseinander. Nur einmal driftet er in
Spekulation ab, als er beschreibt, wie die rot/grüne Regierung
1999 im Zuge des Kosovokrieges auseinandergefallen wäre, wenn man
es geschafft hätte, 1999 den Sonderparteitag der Grünen in
Bielefeld zu erstürmen. So war dieser Termin eine traurige Zäsur,
den ein Großteil der Linken in Deutschland leider gar nicht
wahrgenommen hat. Eine weitere verpasste Gelegenheit.
Wetzel gibt mit seinem Buch Futter für die kommenden
Auseinandersetzungen im Zuge des "Krieges gegen den
Terror". Sein Überblick rückt die Dimensionen zurecht, die
man leicht verliert, wenn man nur die Tagespolitik betrachtet. Ein Buch, das
sehr zu empfehlen ist und den Blick auf die
wichtigen Punkte in der Kriegsdebatte lenkt, gerade im Hinblick
auf die seit 1990 desorientierte deutsche Linke.
Zum Autor
Wolf Wetzel war Autor der legendären undogmatischen L.U.P.U.S. Gruppe, die Ende der 80er und in den 90ern des öfteren
mit ihren Büchern und Texten ihre Finger in offene Wunden der
radikalen Linken steckte und damit wichtige Diskussionen anregte.
Texte, die durchaus auch heute noch lesenswert sind. Nach dem Buch
"Die Hunde bellen... Von A bis (R)Z. Eine Zeitreise durch die
68er Revolte und die militanten Kämpfe der 70er bis 90er Jahre"
setzt Wolf Wetzel die Zeitreise durch die deutsche Geschichte und
radikale Linke der letzten zehn Jahre mit dem Werk "Krieg ist
Frieden" fort.
Quellen:
www.terz.org/Verlagsinformation |
|
|
Jürgen
Elsässer (Hrsg.): Deutschland führt Krieg: Seit dem 11.
September wird zurückgeschossen. Konkret-Literatur-Verlag 2002.
ISBN: 3-930786-37-0.
|
|
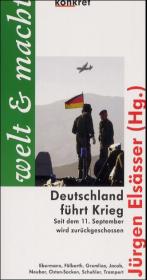
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Die
Anschläge vom 11. September 2001 und der "Krieg gegen den
Terror" werden in der deutschen Linken kontrovers diskutiert.
Das Buch beschäftigt sich mit den wichtigsten Streitpunkten und
skizziert die politischen Konsequenzen, die sich aus den
unterschiedlichen Positionen ergeben.
Es enthält darüber hinaus Informationen über die Geschichte der
deutschen Beziehungen zur islamischen Welt. Erst diese Geschichte
macht das merkwürdige Lavieren der Deutschen im gegenwärtigen
"Krieg gegen den Terror" begreiflich.
Der
Band beinhaltet die Vorträge der Referenten Thomas Ebermann,
Rainer Trampert, Jürgen Elsässer, Georg Fülberth, Hermann L.
Gremliza u.a. beim KONKRET-Kongreß 2002.
Zum Autor
Jürgen Elsässer (Jahrgang 1957) ist Verfasser zahlreicher
Bücher über die deutsche Außenpolitik. "Wenn Joschka
Fischer zurücktreten muss, dann hoffentlich deswegen",
urteilte die Wiener Tageszeitung "Die Presse" über
"Kriegsverbrechen", sein Standardwerk zum
Jugoslawienkrieg. Im Deutschlandfunk wurde bemerkt, dass "seine
Thesen den Raum für eine grundlegende, spannende und notwendige
Debatte" eröffnen. Dem "Spiegel" galt er hingegen
als "professionelle(r) Zyniker mit altlinken Klischees".
Elsässer war bis Juni 1997 leitender Redakteur der Berliner
Tageszeitung "junge Welt" und von April 1999 bis
Dezember 2002 Redakteur der KONKRET. Daneben arbeitet er unter
anderem für die "Allgemeine Jüdische Wochenzeitung",
die "Süddeutsche Zeitung", den WDR und das
"Kursbuch". Seit Anfang 2003 schreibt er wieder für die
"junge Welt".
Verlagsinformation |
|
|
Karl
Otto
Hondrich: Wieder Krieg. Suhrkamp-Verlag 2002. ISBN:
3-518-12297-5.
|
|

mehr
Infos
bestellen
|
"Wie
konnte aus dem 'Nie wieder Krieg!', das doch ein halbes
Jahrhundert lang intuitiv und argumentativ das moralische Leben in
Deutschland prägte, so plötzlich wieder Beteiligung am Krieg
herauswachsen? Der Weg dahin führte, in weniger als einem
Jahrzehnt, über drei Stationen: vom Golfkrieg über die Kriege
auf dem Balkan zum Anti-Terror-Krieg in Afghanistan. Er wird in
diesem Buch nachgezeichnet. Es ging mir dabei nicht so sehr um äußere
Ereignisse und Entscheidungen, sondern um die dadurch
hervorgerufenen geteilten moralischen Gefühle."
Verlagsinformation |
|
|
Jürgen
Todenhöfer: Wer weint schon um Abdul und Tanaya? Die Irrtümer
des Kreuzzugs gegen den Terror. Herder-Verlag 2003 (Überarbeitete
und erweiterte Ausgabe). ISBN: 3-451-05420-5. |
|
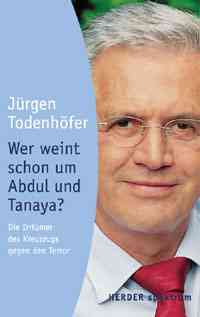
mehr Infos
bestellen
|
Jürgen
Todenhöfer, als entwicklungspolitischer Sprecher der
Unionsfraktion von 1972 bis 1990 bekannt als
"Rechtsausleger", erzählt Geschichten vom Elend der
Menschen in Afghanistan und im Irak - als leidenschaftliches
Plädoyer für eine moralische Außenpolitik und gegen den
westlichen "Anti-Terror-Kreuzzug".
Wer
über der Rache die Gerechtigkeit aus dem Blick verliert, wer den
einzelnen Menschen nicht mehr sieht, meint Todenhöfer, "der
verspielt unsere Zukunft". Jürgen Todenhöfers Buch ist die brillante politische Analyse verfehlter,
gefährlicher Strategien in einer Schlacht der Lügen. Ein
spannendes, ein farbig erzähltes, ein menschliches Dokument. Und
ein leidenschaftliches Plädoyer gegen sinnlose Kriege.
Der Autor war selbst etliche Male vor Ort und hat über Jahrzehnte
lang den Menschen in Afghanistan geholfen. Er hat viele
Geschichten voller Hoffnungslosigkeit gehört und klärt jetzt die
Welt darüber auf, was er gesehen hat. Er gibt den schwächsten
und unschuldigen Opfern eine Stimme: den Kindern von Bagdad und
Kabul.
Erweiterte Taschenbuchausgabe mit einem Geleitwort von
Hans-Dietrich Genscher und einem Bericht über die Reise Jürgen
Todenhöfers mit seiner Tochter nach Bagdad im Januar 2003.
Verlagsinformation
|
|
|
Tiziano
Terzani: Briefe gegen den Krieg. Goldmann-Taschenbuch-Verlag
2003. ISBN: 3-442-15266-6. |
|
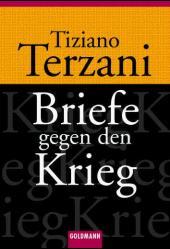
mehr
Infos
bestellen
|
Die
Diskussion um die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus ist heute
primär geprägt vom Machbarkeitsdenken. Verfügen die USA und
ihre Verbündeten über die militärischen Mittel, um den
Terrorismus niederzuringen, um die "Achse des Bösen" zu
besiegen? Der langjährige Fernost-Korrespondent des
"Spiegel", Tiziano Terzani, bringt eine in Vergessenheit
geratene Dimension in die Diskussion.
Mit seinen Briefen aus
Indien, Pakistan und Afghanistan, die er in den Monaten nach dem
11. September schrieb, spricht er eine Ebene jenseits
kurzsichtiger Tagespolitik an. Terzanis Plädoyer weist
eindringlich darauf hin, dass der Westen letztendlich verlieren
wird, wenn er für einen Sieg über den Terrorismus und die
"Achse des Bösen" seine moralischen Prinzipien aufgibt.
Jetzt ist der Augenblick gekommen, für die Werte einzutreten, an
die wir glauben.
"Die Idee, man könne das Böse mit einem Krieg beseitigen,
ist genauso absurd wie der Gedanken des Mannes, der versuchte,
seinen Schatten zu begraben." (Tiziano Terzani)
"Ein eindrückliches Plädoyer wider die Politik blinder
Vergeltung" (Berliner Zeitung)
Klappentext |
|
|
Gilles
Kepel: Zwischen Kairo und Kabul. Eine Orient-Reise in den
Zeiten des Dschihad. Piper-Verlag 2002. ISBN: 3-492-27301-7.
|
|
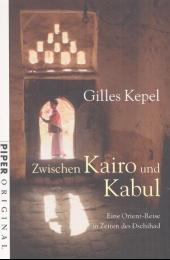
mehr
Infos
bestellen
|
Gilles
Kepel, ausgewiesener Kenner des Islam und Autor des
"Schwarzbuch des Dschihad", reist nach dem 11. September
2001 durch Länder der islamischen Welt. Es ist eine Rückkehr zu
den Orten und Menschen, die er in den Jahren seines Aufenthalts im
Orient kennen gelernt hat. Er befragt Imame und junge Frauen,
militante Islamisten und Politiker. Im ständigen Rekurs auf die
jüngste Geschichte versucht er die Popularität Bin Ladens zu
verstehen, aber auch die Faszination des Abendlandes und die
Hoffnungslosigkeit angesichts fehlender Perspektiven im eigenen
Land. Dabei gelingt es ihm meisterhaft, Analyse und Erzählkunst
zu verbinden – zu politisch-literarischen Impressionen von einer
sehr persönlichen Reise.
Verlagsinformation |
|
|
Peter
Scholl-Latour: Kampf dem Terror – Kampf dem Islam? Chronik
eines unbegrenzten Krieges. Propyläen-Verlag 2002. ISBN:
3-549-07162-0. |
|
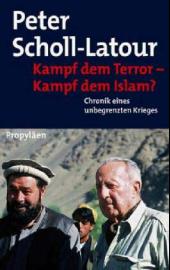
mehr
Infos
bestellen
|
Peter
Scholl-Latour beschäftigt sich mit dem Krieg, den die USA gegen
den islamistischen Terrorismus führen. Im Blickpunkt steht der
zentralasiatische Raum, den er seit Jahrzehnten sehr gut kennt. Er
analysiert die bedrohlichen Szenarien, die auf diesem
"Schlachtfeld der Zukunft" erkennbar werden und setzt
sich kritisch mit der Rolle der USA auseinander.
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben nicht die Welt
verändert, wohl aber die Massenpsychologie der Amerikaner. Präsident
George W. Bush fühlt sich berufen, einen weltweiten "Kampf
gegen das Böse" zu führen. Auf beklemmende Weise gerät
dabei der revolutionäre Islam ins Visier dieser globalen Kriegführung.
Niemand hat die Herausforderung, die vom "Schwert des
Islam" ausgeht, früher erkannt und nachdrücklicher
beschworen als Peter Scholl-Latour. Zugleich hat er stets auf die
Zersplitterung der muslimischen Glaubensgemeinschaft von 1,3
Milliarden Menschen verwiesen. In offener Feldschlacht wären
deren militante "Fundamentalisten" der geballten Macht
der USA hoffnungslos unterlegen. Aber die US-Führung verstrickt
sich zusehends in unberechenbare Regionalkonflikte - von
Afghanistan bis Irak, von Pakistan bis zu den Philippinen.
Alle diese Regionen kennt Scholl-Latour aus langer, unmittelbarer
Erfahrung. Er weiß um die strategischen und psychologischen Fährnisse,
die einer dauerhaften "Pax Americana" entgegenwirken,
ganz zu schweigen von der Gefahr einer letztlich unvermeidlichen
Proliferation von Massenvernichtungswaffen. Schon werden Einwände
gegen den exklusiven Herrschaftsanspruch der USA laut - nicht nur
in Russland, sondern mehr noch in der Volksrepublik China, dem
wieder erstarkenden Reich der Mitte, und sogar bei den europäischen
Verbündeten. Wir stehen erst am Anfang eines historischen Dramas,
das Peter Scholl-Latour mit der ihm eigenen visionären Kraft zu
deuten sucht.
Verlagsinformation |
|
|
Tom
Holert/Mark Terkessidis: Entsichert. Krieg als Massenkultur im
21. Jahrhundert. Kiepenheuer & Witsch-Verlag 2002. ISBN:
3-462-03163-5. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Wenn überall
auf der Welt Krieg herrscht, leben wir dann wirklich noch im
Frieden?
Seit einiger Zeit hat der Krieg auch unseren scheinbar so
friedlichen Alltag erobert, zumindest was die Sprache und die
Medien betrifft: Tag für Tag hören wir von
"Scheidungskriegen" und "Tennis-Kriegen", von
"Terror-Pollen", "Horror-Kids",
"Killer-Viren", "Bomben",
"Produktoffensiven" und "feindlichen Übernahmen".
Und seit die USA nach dem 11. September den "war on terrorism"
erklärt haben, befinden sich die
Staaten des Westens auch real auf einem Feldzug ohne Grenze in
Zeit und Raum. Wie sollen wir dieses symbolische und reale
Eindringen des Krieges in die Eingeweide der Gesellschaft nennen?
Im Übergang zum 21. Jahrhundert ist eine völlig neue Form des
Krieges entstanden. Die Autoren nennen das Phänomen den
"massenkulturellen Krieg". In "Entsichert"
befassen sie sich zum einen mit der immer kriegerischer anmutenden
Konsumkultur im Westen, einer Art mentaler Aufrüstung. Zum
anderen haben sie in
den letzten
Jahren ehemalige und aktuelle Kriegsschauplätze wie Vietnam, die
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und auch das New York nach dem
11. September besucht. In einer Mischung aus Reportage und
Kulturkritik durchleuchten sie sowohl unseren Alltag, in dem der
Krieg als Spektakel erscheint, als auch das Leben in jenen
Gebieten, wo der Krieg buchstäblich Alltag geworden ist.
Zu den Autoren
Tom Holert,
geboren 1962, freier Kulturwissenschaftler und Journalist in Köln,
war Redakteur bei "Texte zur Kunst" und Mitherausgeber
von Spex. Heute ist er Autor u.a. für die
Tageszeitung,
Jungle World, Süddeutsche Zeitung, Literaturen, Artforum. 2000
gab er den Band "Imagineering. Visuelle Kultur und Politik
der Sichtbarkeit" heraus.
Mark
Terkessidis, geboren 1966, Diplom-Psychologe, war von 1992 bis
1994 Redakteur der Zeitschrift Spex und arbeitet seitdem als
freier Autor zu den Themen Populärkultur, Identitätsbildung und
Rassismus. Zahlreiche
Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation
|
|
|
Michael
Walzer: Erklärte Kriege – Kriegserklärungen. Essays.
Europäische Verlagsanstalt 2003. ISBN: 3-434-50562-8. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Ist der Westen nach dem 11. September hilflos? Nein, aber der
Zweck der Freiheit heiligt nicht alle Mittel. Müssen die
Demokratien jetzt aufrüsten? Michael Walzer formuliert eine linke
Antwort im Herzen der einzig verbliebenen Weltmacht.
Zum Autor
Michael
Walzer, geboren 1937 in New York, gilt heute als einer der
wichtigsten Theoretiker einer liberalen Linken in den USA. Nach
seiner Tätigkeit als Professor für Sozialwissenschaften an den
Universitäten Princeton und Harvard, lehrt er seit 1980 am
Institute of Advanced Study in Princeton, New Jersey. Er ist
Herausgeber der Zeitschrift "Dissident".
Verlagsinformation |
|
|
Edgar
Wolfrum: Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen
Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg. Kontroversen um die Geschichte.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003. ISBN: 3-534-15832-6. |
|
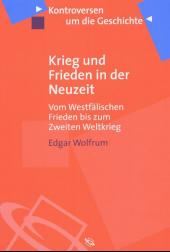
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Die historische Forschung zu Krieg und Frieden hat in den letzten
Jahren eine Ausweitung und Differenzierung erfahren: Sie hat sich
politik-, sozial-, kultur-, geschlechter- und mentalitätsgeschichtlichen
sowie neuen methodischen Ansätzen geöffnet. Edgar Wolfrum gibt
einen ausgezeichneten Überblick über ihre wesentlichen Erträge
und zentralen Kontroversen.
Im Mittelpunkt seiner Darstellung stehen: Theorien über Krieg und
Frieden, Friedensschlüsse und Probleme der Friedenssicherung seit
dem Westfälischen Frieden, Umbrüche im Zeitalter der Französischen
Revolution, Kriegsursachenforschung, Verhältnis von Militär und
Gesellschaft, die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts unter der
Perspektive der Totalisierung des Krieges. Angesichts der
komplexen Thematik und nahezu unüberschaubaren
Forschungsliteratur bietet der Band eine unentbehrliche
Orientierungshilfe.
Zum Autor
Edgar Wolfrum, geb. 1960, Privatdozent für Neuere und Neueste
Geschichte und DFG-Stipendiat an der TU Darmstadt. 2002/03 hat er
eine Vertretungsprofessur an der Universität Mannheim inne.
Verlagsinformation |
|
|
Herfried
Münkler: Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im
Spiegel ihrer theoretischen Reflexion. Velbrück-Verlag 2002. ISBN:
3-934730-54-X. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Der Autor untersucht in diesem Buch historische Wandlungsformen
des Krieges im Spiegel klassischer und aktueller Kriegstheoretiker
– von Thukydides und Niccoló Machiavelli über Carl von
Clausewitz, Friedrich Engels, Carl Schmitt und Mao Tse-tung bis
hin zu Samuel Huntington und Hans Magnus Enzensberger.
Zum Autor
Herfried Münkler, geboren 1951 in Friedberg, ist Professor für
Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und
Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Er ist mit zahlreichen Studien zur politischen Ideengeschichte und
zur Theorie des Krieges hervorgetreten.
Nicht wenige davon
sind mittlerweile Standardwerke, so etwa "Machiavelli" (1982),
"Gewalt und Ordnung" (1992), "Über
den Krieg" (2002) und "Die
neuen Kriege" (2004).
Verlagsinformation |
|
|
Andreas
Herberg-Rothe: Der Krieg. Geschichte und Gegenwart.
Campus-Verlag 2003. ISBN: 3-593-37236-3. |
|
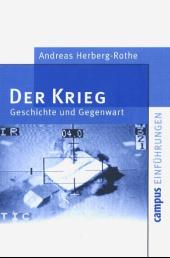
mehr
Infos
bestellen
|
Der
Krieg hat sich zuletzt mit dem Golfkrieg 1991 und den
Terroranschlägen der jüngsten Zeit grundlegend gewandelt.
Andreas Herberg-Rothe schildert, wie sich der Krieg im Laufe der
Jahrhunderte verändert hat: von der Theorie bis zu den
Kriegsursachen, vom Aspekt des Tötens im Krieg bis zur Frage, was
den Staaten vom Bürgerkrieg unterscheidet. Immer wieder nimmt er
dabei Bezug auf die neuen Kriege, die uns im 21. Jahrhundert
drohen.
Verlagsinformation
Leseprobe |
|
|
Mary
Kaldor:
Neue und alte Kriege.
Edition Zweite Moderne. Suhrkamp-Verlag
2001. ISBN: 3-518-41131-4. |
|
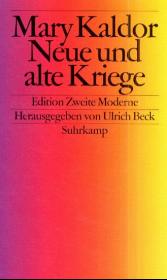
mehr
Infos
bestellen
|
Ich
entfalte in diesem Buch die These, dass sich im Verlauf der
achtziger und neunziger Jahre vor allem in Afrika und Osteuropa
ein neuer Typus organisierter Gewalt herausgebildet hat, der als
ein Bestandteil unseres gegenwärtigen, globalisierten Zeitalters
gelten muss. Diese Form von Gewalt hat die Gestalt eines "neuen
Krieges" angenommen.
Mary Kaldor |
|
|
Michael
Ignatieff: Virtueller Krieg.
Kosovo und die Folgen. Rotbuch-Verlag 2001. ISBN: 3-434-53085-1. |
|
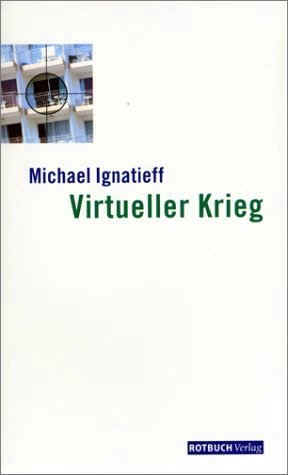
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der
Band "Virtueller Krieg" handelt von den Folgen eines
Engagements. In Essays beschreibt der britische Historiker und Publizist Michael
Ignatieff die internationale Gemeinschaft im Kosovo am Werk, wobei
er exemplarisch fünf Personen mit fünf großen Themen in
Beziehung setzt. Der Leiter der US-Delegation Holbrooke und seine
diplomatischen Bemühungen auf schwierigem Terrain,
Nato-Oberbefehlshaber Wesley Clarke, der einen Krieg neuen Typs
dirigiert. Man begleitet Anne Arbour, die dem internationalen
Kriegsverbrechertribunal vorsteht, auf einer Visite zu den Überlebenden
eines Massakers, und schließlich hört man einige serbische und
kosovo-albanische Stimmen.
Den Abschluss der sorgfältig
recherchierten und emphatisch formulierten Essays bildet eine
Analyse des modernen virtuellen Krieges, der mit immer weniger
Kombattanten und immer mehr Zuschauern für die tatsächlichen
Opfer dramatische Folgen hat. Aus diesen berührenden Begegnungen
sind plastische Bilder, anschauliche Porträts und interessante
Beobachtungen entstanden, die den Krieg selbst jedoch nicht
erklären können. Erst im letzten Teil
des Buches kommt Ignatieff zum eigentlichen Thema, dem
"Virtuellen Krieg".
Ignatieff hat eine scharfsinnige Analyse verfasst, in der er die
Besonderheit des Kosovokrieges als "humanitären Krieg"
und die starke Manipulation der Journalisten
hervorhebt. Nicht ganz unbeeinflusst davon scheint auch der Autor
selbst zu sein, denn sprachlich identifiziert er sich mit militärischen
und politischen Entscheidungsträgern durch die wiederholte
Verwendung der Wörter "wir"
und "unsere".
Zum Autor
Michael
Ignatieff, 1947 in Kanada geboren, ist Historiker und Philosoph.
Nach einigen Jahren Forschungstätigkeit am King's College,
Cambridge schrieb er Romane und politische Reportagen, arbeitete für
die BBC und unterhielt eine eigene Talkshow. Ignatieff ist ein
international gefragter Publizist und politischer Kommentator.
Seit 2000 ist er Professor für Menschenrechtspolitik in Harvard.
Verlagsinformation |
|
|
Britta
Lange: Einen Krieg ausstellen. Verbrecher-Verlag 2003. ISBN:
3-935843-20-8. |
|
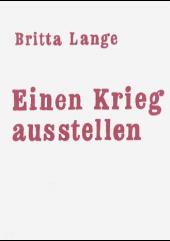
mehr
Infos
bestellen
|
Während
die "Feldfront" den Ersten Weltkrieg hautnah erlebte,
erfuhren die "Heimatfront" und besonders die weibliche
Zivilbevölkerung über den militärischen Krieg hauptsächlich
durch Medien. Dass die unterschiedlichen Kriegserfahrungen an
Front und Heimatfront eine Gefahr bedeuteten, die mögliche
Spaltung der beiden Fronten, erkannten manche Autoren sehr
deutlich: "Es darf sich keine Kluft auftun zwischen dem Volk
in Waffen und dem Volk in der Heimat."
Diese Kluft bemühten sich das Kriegsministerium, das Rote Kreuz
und die deutschen Gemeinden durch die Einrichtung von
Nagelungsritualen, Schauschützengräben und Kriegsausstellungen
zu schließen. Britta Lange beschreibt hier die "Deutsche
Kriegsaustellung", die 1916 unweit der Gedächtniskirche
stattfand und untersucht, wie das geht: einen Krieg ausstellen.
Verlagsinformation
Textprobe |
|
|
Stavros
Mentzos: Der Krieg und seine psychosozialen Funktionen.
Vandenhoeck&Ruprecht-Verlag 2002 (2. Auflage). ISBN:
3-525-01469-4. |
|
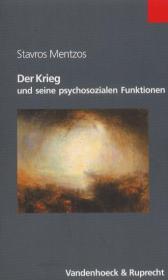
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Bekanntlich
sind Kriege Ausdruck von machtpolitischen, ideologischen und
ökonomischen Interessenskonflikten. Dahinter lagern jedoch
bestimmte Funktionen, die einer scharfsichtigen Analyse bedürfen.
Denn Kriegswirren finden nicht nur in der Außenwelt statt.
Mentzos zeigt deshalb die psychischen Wirren, die Kriege möglich
machen und versucht damit die Frage zu beantworten,
warum
Menschen Krieg führen.
Der Psychoanalytiker Stavros Mentzos entwickelt
die These, dass in kriegerischen Auseinandersetzungen
narzisstische Bedürfnisse und Defizite kompensiert werden und
innere Konflikte, Identitätskrisen, Depressionen,
Sinnlosigkeitsgefühle dabei nach außen verlagert werden. Laut
Mentzos ist nicht der menschliche Aggressionstrieb das zentrale
Movens von Krieg, wenn er auch unterstützend für die
kriegerische Handlung gebraucht wird. Richtet man den Blick auf
die psychosoziale Dimensionen, so liegt genau hier auch eine
Hoffnung auf eine Bewusstseinsveränderung, die zur
Kriegsprävention beitragen kann. Die Neufassung von Mentzos' Werk
setzt sich mit der erschreckenden Aktualität des Themas
auseinander.
Zum Autor
Prof. Dr.
med. Stavros Mentzos, Psychiater und Psychoanalytiker, leitete bis
1995 die Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik im
Klinikum der Universität Frankfurt a. M.
Verlagsinformation
|
|
|