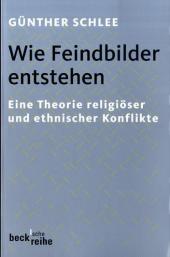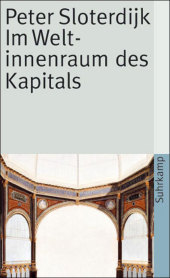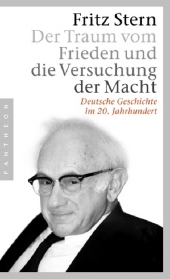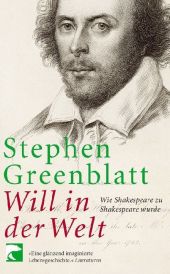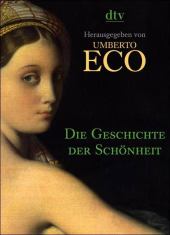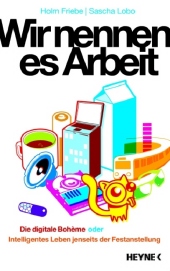|
Günther Schlee: Wie Feindbilder
entstehen. Eine Theorie religiöser und ethnischer Konflikte.
C.H. Beck-Verlag 2006. ISBN: 3-406-54743-5. |
|
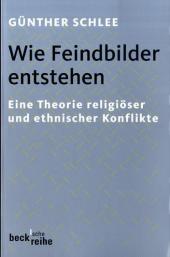
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Als Hauptursachen von Konflikten zwischen Gesellschaften oder
gesellschaftlichen Gruppen gelten religiöse Unterschiede und
ethnische Zugehörigkeit. Dieses Buch zeigt anhand von Beispielen,
die von Ex-Jugoslawien bis Somalia reichen, dass die wirklichen
Ursachen in der Regel ganz anders gelagert sind. Nutznießer von
kriegerischen Auseinandersetzungen sind meistens wenige, die
jedoch einflussreich genug sind, einen Konflikt auch gegen das
Interesse der großen Mehrheit eskalieren zu lassen.
Dahinter
verbergen sich allzu oft handfeste Auseinandersetzungen um
Bodenschätze, Erwerbsnischen, Ämter und Gehälter. Darüber hinaus
stellt sich die Frage sozialer Identifikation. Nach welchen
Merkmalen bilden Menschen Gruppen, unterscheiden sie zwischen
Freund und Feind, schließen sie Bündnisse oder bilden sie
Koalitionen? Erst die Beantwortung dieser Fragen erlaubt auch die
Entwicklung Erfolg versprechender Strategien der
Konfliktschlichtung.
Zum Autor
Günther Schlee, geboren 1951, ist Direktor des
Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle.
Verlagsinformation
|
|
|
Jahrbuch Menschenrechte 2007.
Privat oder Staat? Menschenrechte verwirklichen! Herausgegeben von
Volkmar Deile, Franz-Josef Hutter, Sabine Kurtenbach u. a.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-45817-5. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Im Mittelpunkt dieser Ausgabe des "Jahrbuchs Menschenrechte" steht
die Diskussion über das staatliche Gewaltmonopol und die
Menschenrechtsverantwortung von Unternehmen. Darf ein Staat seine
Macht, seine Exekutive an private Gesellschaften abgeben? Welche
Rolle spielen Söldnerheere oder private Sicherheitsfirmen in
Gewaltkonflikten? Welche Auswirkungen hat diese Form des
Outsourcings auf die Verwirklichung der Menschenrechte? Namhafte
Wissenschaftler, Journalisten und Menschenrechtsverteidiger
diskutieren im Jahrbuch Konzeptionen, wie Menschenrechte weltweit
zu verwirklichen sind.
Zum Herausgeber
Dr. phil. M. A. Franz-Josef Hutter, geboren 1963 in
Griesbach/Niederbayern. Kaufmännische Lehre, danach Studium der
Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie in Duisburg,
Heidelberg und Mannheim. Langjährige wissenschaftliche und
ehrenamtliche politische Tätigkeit in der Menschenrechtsbewegung.
Seit 1998 Mitherausgeber des "Jahrbuchs Menschenrechte".
Zahlreiche Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation
|
|
|
Peter Sloterdijk: Im
Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophische Theorie
der Globalisierung. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-45814-0. |
|
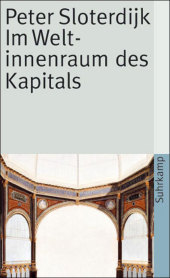
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Unangefochten umspannt der Kapitalismus den Globus, doch geht er
mit seinen Bewohnern unterschiedlich um: Während anderthalb
Milliarden Globalisierungsgewinner eine Komfortzone bewohnen,
einen "Weltinnenraum", dessen Grenzen unsichtbar, aber hart und
abweisend sind wie die Wände des Londoner Kristallpalastes, dem
Ort der ersten Weltausstellung 1851, steht die doppelte Zahl von
Menschen ausgeschlossen vor der Tür. Peter Sloterdijk
philosophiert darüber, und er erzählt davon, und dank seiner
"Unerschrockenheit in Stil und Inhalt" (Der Bund) gelingt es ihm,
auch im 21. Jahrhundert noch etwas Grundstürzendes über
Globalisierung zu sagen.
Zum Autor
Peter Sloterdijk, 1947 in Karlsruhe geboren, ist dort seit 1992
Professor für Philosophie und Medientheorie an der Hochschule für
Gestaltung und seit 2001 deren Direktor. Seit 2002 leitet er
zusammen mit Rüdiger Safranski die ZDF-Sendung "Im Glashaus – Das
Philosophische Quartett". 2005 erhielt er den Sigmund-Freud-Preis,
2001 den Christian-Kellerer-Preis für die Zukunft philosophischer
Gedanken und 1993 den Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik.
Verlagsinformation
|
|
|
Josef Joffe: Die Hypermacht.
Warum die USA die Welt beherrschen. Hanser-Verlag 2006. ISBN:
3-446-20744-9. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Josef Joffe, Mitherausgeber der ZEIT und einer der besten Kenner
der USA, schildert den Weg der USA zur Alleinherrschaft: in der
Politik, in der Wirtschaft und in der Kultur. Mit dem
Zusammenbruch der UdSSR im Dezember 1991 stiegen die USA zur
einzigen Supermacht der Erde auf. Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für die USA, welche für den Rest der Welt? Dieses Buch
mutet beiden Seiten unangenehme Wahrheiten zu.
Leseprobe
Am ersten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1991, also gut zwei Jahre
nach dem Fall der Berliner Mauer, zerbrach das größte Imperium,
das die Welt jemals gekannt hat. Die historische Bedeutung dieses
Augenblicks wurde damals kaum verstanden, denn der Selbstmord der
Sowjetunion zog weit mehr als eine weitere Leiche auf dem Friedhof
der untergegangenen Imperien nach sich, wo schon so viele
Großmachtträume längst zu Staub zerfallen waren – von Rom bis
Byzanz, vom Habsburger bis zum "Tausendjährigen" Reich. Die
Selbstauflösung der Sowjetunion markierte einen äußerst seltenen
Augenblick in der Geschichte der Staatensysteme. Zusammengebrochen
war nicht nur ein einzelner Staat, sondern die gesamte Bühne, auf
der sich die Weltpolitik fünfzig Jahre lang abgespielt hatte. Die
Konsequenzen waren vor allem für die amerikanische Außenpolitik
von größter Tragweite, und der Widerhall dieses weltpolitischen
Großereignisses dürfte noch während des gesamten 21. Jahrhunderts
zu spüren sein.
Der Untergang der UdSSR bildet den Ausgangspunkt für dieses Buch.
Es will zum einen zeigen, welche Folgen der revolutionäre Wandel
der Weltpolitik von der "Bipolarität" zur "Unipolarität", von der
Dominanz à deux zur Vorherrschaft einer einzigen Weltmacht
gezeitigt hat. Wie wirkte sich diese Zäsur auf die Politik der
Vereinigten Staaten und die der restlichen Welt aus? Zum zweiten
versucht dieses Buch auszuloten, welche Rolle Amerika auf der neu
gestalteten Bühne übernehmen sollte – nun, da mit der bipolaren
Ordnung auch die simplen, aber starren Regeln des Kalten Krieges
verschwunden sind. Diese Regeln bestimmten – oder genauer:
diktierten ein halbes Jahrhundert lang die grand strategy, die
Große Strategie Amerikas, und niemand hat diese Regeln so prägnant
formuliert wie der große amerikanische Historiker und Diplomat
George F. Kennan, der im Februar 2005 im Alter von 101 Jahren
gestorben ist, aber bereits 1947 in einem bahnbrechenden Aufsatz
schrieb: "Das wichtigste Element jeder amerikanischen Politik
gegenüber der Sowjetunion muss eine langfristige, geduldige und
zugleich feste und wachsame Eindämmung der russischen
Expansionsbestrebungen sein."
Dieser eine Satz formulierte vorausschauend den Kern der
amerikanischen Außenpolitik in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Es ging, in Kennans unsterblichen Worten, um den
"Zerfall" oder um die "Mäßigung" sowjetischer Macht. Tatsächlich
erfolgte beides: erst die Mäßigung, dann der Zerfall. Die "Bühne"
der Bipolarität ist heute ebenso verschwunden wie Amerikas
einziger wirklich gefährlicher Gegner. Die Welt wird nunmehr von
einer einzigen Übermacht, der amerikanischen, beherrscht. Wie aber
sieht das neue Drehbuch für das neue Drama aus, wie sollte es
aussehen eingedenk der Warnung der Geschichte, wonach
Alleinherrschaft erst die Versuchung, dann die Vergeltung gebiert?
Wie kann Amerika seine beispiellose Macht weise nutzen? Vor dieser
Frage steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nur Amerika
selber, sondern auch der Rest der Welt, der auf diesen rastlosen
Riesen blickt – einen Giganten, der zum Guten wie zum Schlechten
die weltpolitische Bühne bis weit in 21. Jahrhundert hinein
beherrschen wird.
"Bühne" steht hier metaphorisch für den Begriff der "Struktur",
wie ihn die Theorie der internationalen Politik verwendet.
"Struktur" bezeichnet die Machtverteilung unter den Akteuren: Wer
führt Regie, wer folgt ihr, wer ist Statist. Die Bühne des
modernen Staatensystems entstand im 15. Jahrhundert, als sich aus
den Trümmern des Römischen Reiches die Vorläufer der heutigen
Nationalstaaten bildeten: Frankreich, England und Spanien –
Staaten, deren Grenzen sich mehr oder minder mit denen von
Sprache, Ethnie, Religion und Kultur deckten. Ein halbes
Jahrtausend lang entfalteten sich auf dieser Bühne Aufstieg und
Fall der Staaten. Jedoch blieb die Struktur des Staatensystems
stets die gleiche. Die Großmächte kamen und gingen, aber die Bühne
blieb bestehen.
Die klassische Struktur wurde von mehreren Großmächten beherrscht,
üblicherweise fünf in wechselnder Gestalt, die miteinander um
Sicherheit, Macht und Vorteil wetteiferten. Nach unserem heutigen
Sprachgebrauch handelte es sich bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs um ein "multipolares" System, das plötzlich von zwei
alle anderen überragenden Mächten abgelöst wurde – den Vereinigten
Staaten und der Sowjetunion. Diese Entwicklung hatte, wenn auch
nur schemenhaft, schon Alexis de Tocqueville vorausgesehen, der
1835 sinnierte: "In unserer heutigen Zeit gibt es zwei große
Völker auf Erden, die von verschiedenen Punkten aufbrechen und
dennoch dem gleichen Ziele zuzustreben scheinen; ich meine die
Russen und die Amerikaner. […] Ihr Ausgangspunkt ist verschieden,
ihre Wege sind nicht die gleichen; dennoch scheinen beide durch
himmlische Vorsehung berufen, eines Tages die Geschicke der halben
Welt zu bestimmen."
Verlagsinformation
|
|
|
Fritz Stern: Der Traum vom Frieden
und die Versuchung der Macht.
Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Erweiterte Ausgabe.
Pantheon-Verlag 2006. ISBN: 3-570-55013-3. |
|
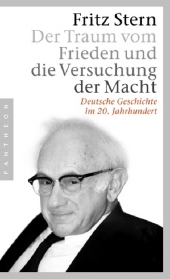
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der Historiker Fritz Stern erforscht die schwierige Geschichte
Deutschlands, der Heimat, aus der er vertrieben wurde: "Die
Deutschen lehrten uns die Geschichte, wie sie sie gelebt haben:
sublim und grausam." Im Mittelpunkt seiner Essays steht die Frage,
warum so viele Deutsche Hitlers Einfluss erlagen. Mit großem
Scharfsinn macht der Autor die Versuchung des Nationalsozialismus
begreiflich.
"Ein glänzender Kenner der jüngeren deutschen Geschichte und ein
Mann von faszinierender Darstellungskraft." (Helmut Schmidt)
Zum Autor
Fritz Stern, am 2. Februar 1926 in Breslau geboren, wuchs in ein
stark assimiliertes jüdisches Bildungsbürgertum hinein, das
zunehmend naturwissenschaftlich geprägt war. So wurde Stern, um
seine Zukunftschancen zu erhöhen, getauft. Da dies kein einfaches
Erbe ist, wurde die Geschichte und das Schicksal des deutschen
Judentums für Stern zum Lebensthema. 1938 flüchtete er mit seinen
Eltern in die Vereinigten Staaten und studierte deutsche
Geschichte an der Columbia Universität, wo er Professor für
Geschichte wurde. Er gilt als einer der besten Deutschlandkenner
in den USA. Neben zahlreichen Essays über bedeutende deutsche
Juden zählt dazu vor allem die zum Standardwerk avancierte
Doppelbiographie von Bismarck und dessen jüdischen Bankier Gerson
Bleichröder zu den großen wissenschaftlichen Leistungen Sterns.
1999 wurde er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
ausgezeichnet. Er lebt in Princeton und Washington.
Verlagsinformation
|
|
|
Stephen Greenblatt: Will in der
Welt.
Wie Shakespeare zu Shakespeare wurde. Aus dem Amerikanischen von
Martin Pfeiffer. BVT Berliner Taschenbuch Verlag 2006. ISBN:
3-8333-0386-7. |
|
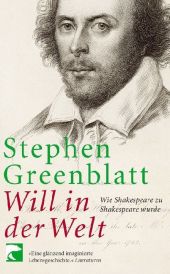
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Eine Lebensbeschreibung des berühmtesten Dichters der
abendländischen Literatur aus der Feder eines der besten
Shakespeare-Kenner der Gegenwart. Mit enormer Geschichtskenntnis
und großem Scharfsinn entwirft Stephen Greenblatt ein
überzeugendes Bild des großen Shakespeare in seiner Zeit.
Rezension
"Dies ist, endlich, das Buch, das Shakespeare verdient hat: ein
brillantes Buch, geschrieben von einem virtuellen Augenzeugen, der
versteht, wie ein Dramatiker den Stoff seines Lebens in Theater
verwandelt." (Charles Mee, Dramatiker)
Verlagsinformation
|
|
|
Umberto Eco (Hrsg.): Die Geschichte
der Schönheit.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2006. ISBN: 3-423-34369-9. |
|
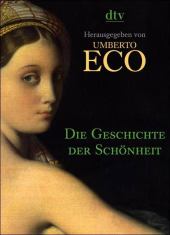
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was ist Schönheit? Umberto Eco erzählt in seinem großen, reich
illustrierten Buch, dass Schönheit nie etwas Absolutes und
Unveränderliches ist, sondern je nach Zeiten und Kulturen ganz
verschiedene Gesichter hat. Von der Antike bis zu den abstrakten
Formen der Gegenwartskunst, von Licht und Farbe im Mittelalter bis
zur Malerei der Romantik: ein umfassendes Kompendium über die
Kunst der Welt.
Zum Autor
Umberto Eco wurde 1932 in Alessandria geboren und lebt heute in
Mailand. Er studierte Pädagogik und Philosophie und promovierte
1954 an der Universität Turin. Anschließend arbeitete er beim
Italienischen Fernsehen und war als freier Dozent für Ästhetik und
visuelle Kommunikation in Turin, Mailand und Florenz tätig. Seit
1971 unterrichtet er Semiotik in Bologna. Eco erhielt neben
zahlreichen Auszeichnungen den Premio Strega (1981) und wurde 1988
zum Ehrendoktor der Pariser Sorbonne ernannt.
Er verfasste zahlreiche Schriften zur Theorie und Praxis der
Zeichen, der Literatur, der Kunst und nicht zuletzt der Ästhetik
des Mittelalters. Seine Romane 'Der Name der Rose' und 'Das
Foucaultsche Pendel' sind Welterfolge geworden.
Verlagsinformation
|
|
|
Holm Friebe/Sascha Lobo: Wir nennen
es Arbeit.
Die digitale Bohème oder: Intelligentes Leben jenseits der
Festanstellung. Heyne-Verlag 2006. ISBN: 3-453-12092-2. |
|
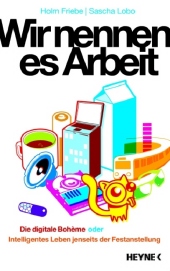
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Sie verzichten dankend auf einen Arbeitsvertrag und verwirklichen
den alten Traum vom selbstbestimmten Leben. Mittels neuer
Technologien kreieren sie ihre eigenen Projekte, Labels und
Betätigungsfelder. Das Internet ist für sie nicht nur Werkzeug und
Spielwiese, sondern Einkommens- und Lebensader: die digitale
Boheme. Ihre Ideen erreichen anders als bei der früheren Boheme
vor allem über das Web ein großes Publikum und finanzieren sich
damit. Ein zeitgemäßer Lebensstil, der sich zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor entwickelt.
Auf Angestellten-Frust kann man mit der Entdeckung der Faulheit
reagieren, wie es Corinne Maier in ihrem Bestseller fordert:
Arbeitszeit absitzen, sicheres Gehalt einstreichen. Die digitale
Boheme repräsentiert die mutigere Alternative: Immer mehr junge
Kreative entscheiden sich für das Leben in Freiheit. Ihr Hauptziel
ist nicht das Geldverdienen, sondern ein selbst bestimmter
Arbeitsstil, der den eigenen Motiven folgt in unsicheren Zeiten
vielleicht die überlegene Strategie. Denn ihre enge Einbindung in
soziale, künstlerische und digitale Netzwerke bringt ständig neue,
teilweise überraschende Erwerbsmöglichkeiten mit sich. Sie
schalten Werbebanner auf ihren Websites, handeln mit virtuellen
Immobilien, lassen sich Projekte sponsern oder verkaufen eine Idee
an einen Konzern. Ihre Produkte und ihre Arbeitsweise verändern
den Charakter der Medien und des Internets, bald auch den der
Gesellschaft.
Holm Friebe und Sascha Lobo porträtieren die digitale Boheme: Sie
stellen erfolgreiche Konzepte und innovative Ansätze vor und
erklären wirtschaftliche, technische und soziale Entwicklungen und
Hintergründe. Ihre spannende Analyse einer zukunftsgewandten
Daseinsform inspiriert dazu, so zu arbeiten, wie man leben will.
Rezension
"Das Buch 'Wir nennen es Arbeit' von Holm Friebe und Sascha Lobo
[...] berichtet von intelligenten Versuchen 'jenseits der
Festanstellung' zu leben. Die beeindruckenden Geschichten aus der
'digitalen Bohème' erzählen von neuen Formen der Arbeitswelt, von
denen, die weder ALG II noch ein festes Gehalt beziehen,
selbstbewusst und ideenreich darauf reagieren, dass es dramatisch
weniger feste Stellen gibt. [...] Als Bericht über die
Bloggerszene und die Welt der Computerspiele ist das Buch hoch
willkommen. Es enthält glänzende Beobachtungen." (Süddeutsche
Zeitung)
Verlagsinformation
|
|
|