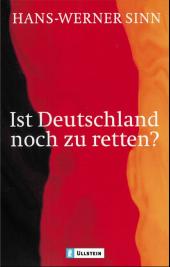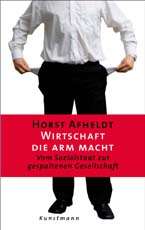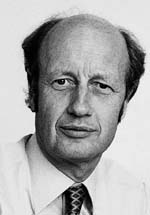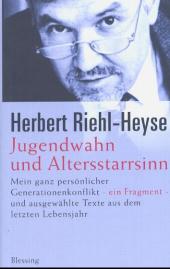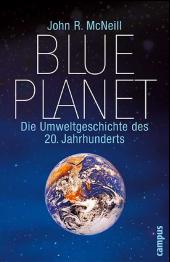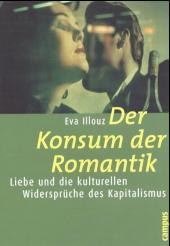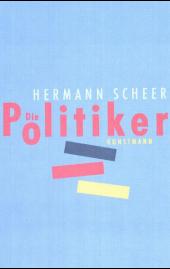|
Moishe Postone: Zeit, Arbeit und
gesellschaftliche Herrschaft. Eine neue Interpretation der
Kritischen Theorie von Marx. Aus dem Amerikanischen von Manfred
Dahlmann, Christoph Seidler u.a. Ça Ira-Verlag 2003. ISBN:
3-924627-58-4. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
In diesem Buch interpretiert Postone die von Marx in seinem
Spätwerk entwickelte kritische Theorie grundlegend neu, um die
Natur der kapitalistischen Gesellschaft in neuartiger Weise
theoretisch erfassen zu können. Seine Interpretation der von Marx
analysierten gesellschaftlichen Verhältnisse und Herrschaftsformen
der kapitalistischen Gesellschaft macht es erforderlich, die
zentralen Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie zu
überdenken.
Karl Marx identifiziert den Kern des kapitalistischen Systems als
unpersönliche Form abstrakter Herrschaft. Dies hat ihren Grund
nicht in Marktmechanismen und Privateigentum, sondern wird von der
dem Kapitalismus eigentümlichen Arbeit selbst hervorgebracht.
Proletarische Arbeit oder industrieller Produktionsprozess können
somit nicht – wie in den traditionellen marxistischen
Interpretationen – als Subjekt beziehungsweise Mittel menschlicher
Emanzipation aufgefasst werden, sondern sind als Ausdruck eben
dieser Herrschaft zu begreifen.
Zur Analyse werden Begriffe entwickelt, die zwei Kriterien
genügen: Zum einen sollen sie das Wesen und die geschichtliche
Entwicklung der modernen Gesellschaft erfassen, zum anderen soll
in ihnen die in den Sozialwissenschaften gängige Dichotomie von
Struktur und Handlung bzw. objektiven Lebensumständen und
subjektivem Sinn überwunden werden. Im Bezug der Marxschen Theorie
auf die aktuellen theoretischen Debatten wird nicht nur zu zeigen
sein, inwieweit die Reformulierung dieser Theorie für die
Gegenwart relevant ist, sondern dass in ihr
auch eine grundsätzliche Kritik an traditionellen marxistischen
Theorien und am ehemals "real existierenden
Sozialismus" formuliert werden kann.
Postone bietet somit die Grundlage für eine kritische Analyse der
kapitalistischen Gesellschaftsformation, die im Vergleich zu den
bisherigen Analysen überzeugender und der heutigen Zeit
angemessener ist.
Zum Autor
Moishe Postone, geboren 1942, Dr. phil.,
lehrt Soziologie an der Universität in Chicago und hat
"Time, Labour and Social Domination: A
Reinterpretation of Marx’ Critical Theory"
1993 bei Cambridge University Press veröffentlicht. Zwischen 1972
und 1982 lebte der Autor in Frankfurt am Main und war Mitarbeiter
des Instituts für Sozialforschung. In der Bundesrepublik ist
Moishe Postone bekannt geworden durch einen "Offenen
Brief" an die Deutsche Linke sowie durch
seinen Aufsatz "Antisemitismus und
Nationalsozialismus", der 1979 zum ersten
Mal in deutscher Übersetzung in der Frankfurter Studentenzeitung
"Diskus" erschien.
Dieser Aufsatz reflektiert die Aufnahme des Filmes
"Holocaust" in der BRD und
diskutiert den Antisemitismus in der BRD. Der zweite Teil des
Beitrages erschien in überarbeiteter Form im "Merkur" (1982) und
wurde in dem von Dan Diner herausgegebenen Band "Zivilisationsbruch.
Denken nach Auschwitz" sowie in der
Zeitschrift "Kritik und Krise",
herausgegeben vom Ça ira-Verlag, übernommen.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
-
Inhaltsverzeichnis und Leseprobe
-
Vorwort zur deutschen Ausgabe
-
8. Kapitel: Die Dialektik von Arbeit und Zeit (Leseprobe)
-
10. Kapitel: Abschließende Bemerkungen (Leseprobe) |
|
|
Robert Kurz: Die antideutsche Ideologie. Vom Antifaschismus
zum Krisenimperialismus. Kritik des neuesten linksdeutschen
Sektenwesens in seinen theoretischen Propheten. Unrast-Verlag
2003. ISBN: 3-89771-426-4. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Nicht erst der 11. September und der Irakkrieg haben die
Ratlosigkeit der radikalen Linken enthüllt. Das Ende von
traditioneller Arbeiterbewegung, Staatssozialismus und nationalen
Befreiungsbewegungen ist noch lange nicht aufgearbeitet.
Unter den Verwesungsprodukten des deutschen Traditionsmarxismus gehört
die antideutsche Strömung zu den unappetitlichsten. Bestimmte
Teile der ehemals radikalen Linken und der antifaschistischen
Szene wollen sich angesichts der globalen Krise gewissermaßen
historisch aus dem Staub machen.
Die kategorial an das warenproduzierende
System und dessen Modernisierungsgeschichte gebundene bisherige
Kritik droht in Apologetik der kapitalistischen Subjektform und
ihrer globalen Krisendiktatur umzuschlagen.
Das Eingedenken an Auschwitz wird dafür missbraucht, ideologisch bei der
imperialen Macht des Krisenkapitalismus anzuheuern, deren
perspektivlose Weltordnungskriege abzusegnen und jegliche soziale
Bewegung als völkisch und antisemitisch zu denunzieren. Die
radikale Kapitalismuskritik wird so nicht zeitgemäß transformiert,
sondern liquidiert, um die bürgerliche
Vernunft zu retten.
In drei Aufsätzen unterzieht Robert Kurz das assoziative theoretische
Blendwerk dieses Denkens einer grundsätzlichen Kritik.
Nachgewiesen wird die Fixierung der Antideutschen auf längst
gegenstandslos gewordene innerkapitalistische Alternativen, ihre
Befangenheit in der repressiven bürgerlichen Aufklärungsideologie
und im Idealismus der Zirkulationssphäre. Daraus resultiert eine
geradezu fanatische Affirmation der kapitalistischen abstrakten
Individualität und der männlich-weißen westlichen Subjektform.
Diese im Kern rassistische, frauenfeindliche und
zwangsheterosexuelle Ideologie mystifiziert das Kapital und pflegt
einen Kult falscher Unmittelbarkeit in der Tradition sehr
deutscher Ideologie von Nietzsche bis Heidegger. Die Antideutschen
sind genau das, was sie anderen vorwerfen zu sein.
Dagegen plädiert der Autor für eine Neuformulierung
emanzipatorischer Kritik, die den Nationalsozialismus als
integralen Bestandteil innerkapitalistischer Entwicklung begreift
und mit der fetischistischen Konstitution der Moderne bricht.
Zum Autor
Robert Kurz, 1943 geboren, lebt als freier Publizist, Journalist und
Referent im Kultur- und Wirtschaftsbereich in Nürnberg. Er ist
Mitherausgeber der gesellschaftskritischen Theoriezeitschrift
'Krisis' und Autor des Buches "Weltordnungskrieg.
Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im
Zeitalter der Globalisierung" (2003).
Verlagsinformation |
|
|
Hans-Werner Sinn: Ist
Deutschland noch zu retten? Ausgezeichnet mit dem Corine –
Internationaler Buchpreis, Kategorie
HypoVereinsbank-Wirtschaftsbuch 2004. Econ-Verlag 2004 (6.,
aktualisierte Auflage). ISBN: 3-430-18533-5. |
|
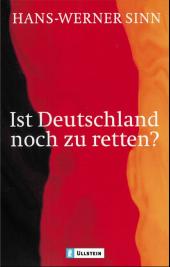
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Deutschland ist zum kranken Mann Europas geworden. Das Bildungssystem
ist miserabel, die Wettbewerbsfähigkeit katastrophal. Die
demografische Entwicklung lässt uns einknicken, die sozialen
Sicherungssysteme sind marode und produzieren noch mehr
Arbeitslosigkeit. Politiker, Wirtschaft und Gewerkschaften
schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Wie konnte es so
weit kommen? Hans-Werner Sinn gibt aufrüttelnde Antworten und
zeigt in einem wegweisenden "Zehn-Punkte-Programm für die
Erneuerung der Wirtschaft", was sofort getan werden muss, um
Deutschland zu retten.
Verlagsinformation
Hans-Werner Sinns Buch präsentiert die Sicht der
neoliberalen Eliten in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Medien zur "Reformdebatte" und ist von daher
empfehlenswert. Aus wissenschaftlicher Betrachtung erscheint das
Werk hingegen sehr dürftig.
Michael Kraus
Rezensionen
"Deutschland braucht Aufbruchstimmung. In einer Zeit, in der über
das Ob und Wie von Reformen heftig gestritten wird, liegt
Professor Sinn mit seinem Buch goldrichtig. Mit seiner
messerscharfen Analyse des Krisenbefunds und einer klaren
Handlungsanleitung gibt er den Weg vor. Pflichtlektüre." (Heinrich
von Pierer, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG)
"Hier redet ein Fachmann Klartext. Deutschland hat keine Wahl. Die
Wahrheit ist unangenehm und ohne Alternativen. Deutschland kann
reformiert werden. Hans-Werner Sinn zeigt den Weg auf. Ob ihn die
politische Klasse geht?" (Lothar Späth, Ministerpräsident a.D.,
Vorstandsvorsitzender von Carl Zeiss Jena)
"Was Deutschland braucht: unkonventionelle Ideen, Kreativität,
Offenheit und den Mut, unbequeme Themen schnell und offensiv
anzugehen. Hans-Werner Sinn liefert all das. Lesenswert." (Dieter
Rampl, Vorstandsvorsitzender der HypoVereinsbank-Gruppe)
"Endlich einmal ein Wirtschaftswissenschaftler, der Tacheles
redet. Dieses Buch gehört auf den Schreibtisch aller Mitglieder
des Bundeskabinetts und aller Mitglieder des Deutschen
Bundestags." (Hans-Olaf Henkel, ehemaliger BDI-Präsident)
Zum Autor
Hans-Werner Sinn, geboren 1948, ist seit 1984 Professor für
Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war von 1997 bis 2000
Vorsitzender des Fachverbandes deutscher
Volkswirte (Verein für Socialpolitik), gründete das Center for Economic Studies und wurde 1999 Präsident
des unternehmensnahen ifo-Instituts für
Wirtschaftsforschung. Sinn ist Autor einer größeren Zahl
von Fachbüchern und von mehr als 200 Fachartikeln. Seine Arbeiten
wurden im In- und Ausland preisgekrönt.
Zusammen mit seiner Familie lebt er in München.
Verlagsinformation
Weitere Informationen
|
|
|
Horst Afheldt: Wirtschaft, die arm macht. Vom Sozialstaat zur
gespaltenen Gesellschaft. Kunstmann-Verlag 2003. ISBN:
3-88897-344-9. |
|
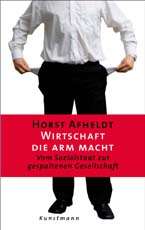
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Wirtschaften wir uns arm? Von dem einst selbstverständlichen Ziel,
"Wohlstand für alle" zu schaffen, ist schon lange nicht mehr die
Rede. Im Gegenteil: Wo immer über dringend nötige Reformen
diskutiert wird, heißt es: Löhne senken, Wachstum steigern,
Beseitigung aller Handelshemmnisse und Entlastung der
"eigentlichen Leistungsträger", der Unternehmen, von Steuern und
Abgaben.
Obwohl Wirtschaftsexperten wie Joseph Stiglitz oder George Soros
längst die verheerenden Folgen einer ungehemmten
Liberalisierungspolitik für Wirtschaft wie Gesellschaft
beschrieben haben, werden diese Patentrezepte unverdrossen
angeboten. "Die Politik" soll nur noch konsequenter, radikaler
deregulieren als bisher, dann werde der "Konjunktur-Motor" schon
wieder anspringen.
Einen Arzt, der seinem Patienten jahrelang dieselben Pillen
verschreibt, obwohl sich die Symptome verschlechtern, sollte man
wechseln. Sollte man nicht auch bei der krankenden Wirtschaft eine
neue Diagnose erstellen, bevor man mit der Therapie fortfährt?
Horst Afheldt unterzieht die "harten Fakten" aus 25 Jahren
Wirtschaftsliberalismus einer schneidenden Analyse. Sie zeigt,
dass vom wachsenden "Sozial-Produkt" immer weniger bei den Bürgern
ankommt, dass die derzeitige Wirtschaftsordnung zu einer
gespaltenen Gesellschaft führt – und damit für alle zunehmend
unwirtschaftlich wird.
Brauchen wir eine neue Wirtschaftsordnung, die nicht auf Kosten
der Gesellschaft geht, und gibt es dafür erfolgsversprechende
Modelle? Horst Afheldts faktenreiche Analyse zeigt, dass wir uns
die Verarmung des ökonomischen Denkens nicht länger leisten
können, dass es an der Zeit ist, Wirtschaft "gesellschaftsfähig"
zu machen.
Zum Autor
Horst Afheldt, geb. 1924, war von 1960-70 Geschäftsführer der
Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Danach Studienprojekte über
friedenspolitische, ökologische und ökonomische Grundfragen am
"Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der
wissenschaftlich-technischen Welt" in Starnberg. Zahlreiche
Veröffentlichungen zu den Themen Sozialstaat, Sicherheits- und
Friedenspolitik. 1994 erschien sein viel beachtetes Buch "Wohlstand
für niemand? Die Marktwirtschaft entlässt ihre Kinder". Horst
Afheldt lebt in Hamburg.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
Globaler
Standortwettbewerb: Weltwirtschaft auf Crashkurs? (junge Welt,
02.03.2004) |
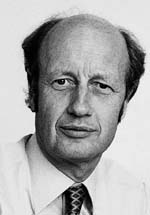
Horst Afheldt |
|
|
Karl Grobe-Hagel: Irakistan. Der Krieg gegen den Irak und
der "Kreuzzug" der USA. Neuer ISP-Verlag 2003.
ISBN: 3-89900-109-5. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Karl Grobe-Hagel, seit über 30 Jahren im außenpolitischen Ressort
der Frankfurter Rundschau tätig, legt eine umfassende Bilanz des
letzten Krieges vor, den die Weltmacht Nr. 1 unter Berufung auf
den "Kampf gegen Terrorismus“ seit dem 11. September 2001 geführt
hat: den Krieg gegen das Regime von Saddam Hussein.
Wie bei dem Krieg in Afghanistan hieß es, das Regime stehe mit dem
"Terrorismus“ in Verbindung, überdies besitze es
Massenvernichtungswaffen. Das verhasste Regime wurde zwar
entmachtet, es wurden jedoch keineswegs demokratische Verhältnisse
hergestellt – ebenfalls eine Parallele zu Afghanistan. Während in
Afghanistan unterschiedliche Warlords um die Vormachtstellung in
einzelnen Regionen des Landes kämpfen und die von den USA
ausgehaltene Karzai-Regierung sich mit Unterstützung der
ISAF-Truppen gerade noch in der Region Kabul halten kann, wird im
Irak die Militärverwaltung durch die USA, Großbritannien und Polen
zunehmend als Besatzungsregime begriffen. Die USA stützen sich nur
auf wenige, randständige, aus dem Exil zurückgekehrte irakische
Politiker. Die soziale Lage der Bevölkerung hat sich weiter
dramatisch verschlechtert. Wie ernst die Lage ist, belegt die
Tatsache, dass die Zahl der getöteten US-Amerikaner seit dem
offiziell postulierten Kriegsende höher ist als während des
Krieges.
Die offiziellen Begründungen z. B. im Falle des Irak-Kriegs wurden
durch Paul Wolfowitz selbst als Propagandalüge entlarvt. Nunmehr
treten die wahren Beweggründe der USA deutlich zutage: die
Erringung einer noch nie da gewesenen Hegemonialstellung, deren
Kernstück der nunmehr direkte Zugriff der USA auf Teile des Nahen
Ostens darstellt, ein Zugriff, der weit über das rein ökonomische
Interesse an der Sicherung der Ölressourcen hinausgeht. Damit sind
die Interessen der USA in der Region jedoch keineswegs erschöpft,
wie die Drohungen gegen den Iran zeigen. Die Weltstrategie Bushs
und die dahinter stehende Ideologie werden von Karl Grobe-Hagel
ausführlich analysiert. Er zeigt auf, welche weiteren
US-Interessen im Kampf gegen die "Achse des Bösen“ im Spiel sind
und in welchen Ländern mit künftigen US-Operationen gerechnet
werden kann; detailliert wird das Szenario für den Iran und
Nordkorea dargestellt.
Quelle: http://www.gegenbuchmasse.de/ |
|
|
Ulrich Beck/Natan Sznaider/Rainer Winter (Hrsg.): Globales
Amerika? Die kulturellen Folgen der Globalisierung. Cultural
Studies Vol. 4. Transcript-Verlag 2003. ISBN: 3-89942-172-8.
|
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Seit einigen Jahren wird in den Sozial- und Kulturwissenschaften
international kaum ein Phänomen so lebhaft diskutiert wie das der
Globalisierung. Nachdem die zu Anfang vorherrschende Sichtweise
von Globalisierung als Entwicklung einer homogenen Weltkultur
zunehmend an Evidenz verlor, rücken die lokal unterschiedlichen
kulturellen Praktiken und Perspektiven als Teil von Globalisierung
ins Zentrum des Interesses. Diese Neujustierung des Fokus erlaubt
auch längst überfällige neue Lesarten des vermeintlich einfachen
Verhältnisses von "Amerikanisierung" und Globalisierung.
Dabei wird deutlich, dass die oft als "Amerikanisierung"
wahrgenommene Globalisierung weltweit heterogene Resonanzen
erzeugt, hybride Kulturen, Fluchtlinien und Gegenbewegungen treten
gleichermaßen hervor. Der Band "Globales Amerika?", in dem sich
einige der prominentesten Denker der Globalisierung zu Wort
melden, präsentiert anregende Lektüren dieser bislang wenig
beleuchteten Seite der Globalisierung und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zum Verständnis des Problems insgesamt. Für das
21. Jahrhundert erweist sich die Perspektive eines
"methodologischen Kosmopolitismus" (Ulrich Beck) als
richtungweisend.
Zu den Herausgebern
Ulrich Beck ist Professor für Soziologie an der Universität
München und Visiting Centennial Professor an der London School of
Economics and Political Science.
Natan Sznaider lehrt Soziologie am Academic College in Tel-Aviv.
Rainer Winter ist Professor für Medientheorie und Cultural Studies
sowie Direktor des Instituts für Medien und Kommunikationsstudien
an der Universität Klagenfurt.
Verlagsinformation |
|
|
Herbert Riehl-Heyse: Jugendwahn und Altersstarrsinn. Mein ganz
persönlicher Generationenkonflikt – ein Fragment – und ausgewählte
Texte aus dem letzten Lebensjahr. Blessing-Verlag 2003. ISBN:
3-89667-193-6.
|
|
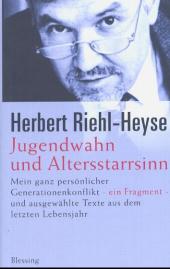
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Das Älterwerden fiel Herbert Riehl-Heyse in den letzten Monaten seines
Lebens zunehmend schwerer, auch bedingt durch die lebensbedrohende
Krankheit. Und doch hat er sich in seiner unnachahmlichen Art der
ironischen Bewertung eigener Befindlichkeiten mit dem Thema seines
Buches beschäftigt.
"Manche üben sich im Grabenkrieg", so der Autor, "so verhärtet
sind die Fronten zwischen Jung und Alt. Manche haben sich einfach
nichts zu sagen oder reden bedeutungsschwer aneinander vorbei,
sind starrsinnig und besserwisserisch (so der Vorwurf der Jungen),
sind uneinsichtig und undankbar (so der Vorwurf an die Jungen)."
Die Texte des Autors zeigen, dass es schwierig ist, in Würde älter
zu werden und es nicht zu merken beziehungsweise dem
Jugendkultigen zu verfallen und es auch nicht zu merken.
Unbestreitbar ist, dass wir es hier mit einem Thema des
beginnenden 3. Jahrtausends zu tun haben. Auch der Autor schien
verunsichert, denn er schrieb: "Komisch – gerade war ich doch noch
jung. Und jetzt lese ich nur noch Zeitungsartikel und Bücher, aus
denen hervorgeht, dass ich den wirklich Jungen im Wege stehe.
Schon habe ich ein schlechtes Gewissen, gleich darauf aber fühle
ich einen gewissen Zorn in mir hochsteigen: Ist es in Wahrheit
nicht so, dass die undankbare Generation Golf ein schlechtes
Gewissen haben müsste? Wenn die in Jugendwahn ausbricht, dann
reagiere ich jedenfalls schnell mit dem mir zustehenden
Altersstarrsinn. Führt aber auch nicht weiter."
Das hier vorliegende Fragment seines letzten Buches zeigt, was
geschieht, wenn Welten aufeinander prallen. Es ist geschrieben in
einem eleganten Stil, teils satirisch, oft selbstironisch,
durchaus nachdenklich, auf keinen Fall wehleidig.
Zum Autor
Herbert Riehl-Heyse, 1940 in Oberbayern geboren, studierter Jurist, war
ab 1968 Journalist und arbeitete zuletzt als Leitender Redakteur der
Süddeutschen Zeitung in München. Er hat diverse journalistische
Auszeichnungen für seine Arbeiten erhalten, u. a. den
Theodor-Wolff-Preis, den Kisch-Preis und den Medienpreis des
Deutschen Bundestages. Mehrere Buchveröffentlichungen.
Verlagsinformation |
|
|
John McNeill: Blue Planet. Die Umweltgeschichte des 20.
Jahrhunderts. Campus-Verlag 2003. ISBN: 3-593-37320-3.
|
|
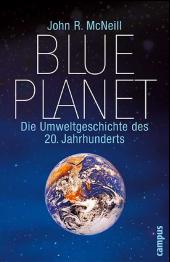
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die
nachhaltigste Veränderung, die das 20. Jahrhundert dem Menschen
gebracht hat, ist die von ihm selbst herbeigeführte Umgestaltung
seiner natürlichen Umgebung. In den letzten 100 Jahren haben die
Menschen weltweit 10-mal so viel Energie verbraucht wie in den
1000 Jahren davor. Massive Veränderungen von Luft, Wasser, Boden
und der gesamten Biosphäre haben eine neue Welt entstehen lassen.
John McNeill rekonstruiert diesen atemberaubenden Wandel
faktenreich, mit einem scharfen Blick für das Wesen des Menschen
und erfrischendem Respekt gegenüber dem historisch
Unvorhersehbaren. Er ruft ökologische Katastrophen in Erinnerung,
zeigt aber auch Erfolge der Umweltpolitik. Anstatt den Umgang des
Menschen mit der Natur zu verurteilen und apokalyptische Prognosen
aufzustellen, beschreibt McNeill die Beziehung zwischen Mensch und
Natur als evolutionäres Glücksspiel - dessen Ausgang in unserer
Hand liegt.
Rezension
"Ein wichtiges Buch, und noch dazu schön geschrieben ... sehr
empfehlenswert." (Paul Crutzen, Nature)
"Bewundernswert sachlich. ... Anstelle apokalyptischer Warnungen
vermittelt McNeill klaren Verstand." (The Economist)
Zum Autor
John McNeill ist Professor für Geschichte an der School of Foreign
Service der Georgetown University. Er hat bereits mehrere
Sachbücher veröffentlicht. Mit Something New Under the Sun (so der
Titel der Originalausgabe) gewann er im Jahr 2000 den "World
History Association Book Award".
Verlagsinformation |
|
|
Gilles Deleuze: Die einsame Insel. Texte und Gespräche 1953 bis
1974. Hrsg. von David Lapoujade. Suhrkamp-Verlag 2003. ISBN:
3-518-58374-3.
|
|

mehr Infos
bestellen
|
Gilles
Deleuze (1925-1995) gehört zu den großen französischen
Philosophen. Neben seinen Monographien über Denker wie Hume,
Leibniz oder Kant, seinen Beiträgen zur Logik des Sinns, zum
Verhältnis von Differenz und Wiederholung und seinen beiden
Büchern über das Kino hat er immer auch die kleine Form gesucht,
in der er oftmals konziser und direkter über seine philosophischen
Projekte und ihre Implikationen Auskunft gibt. Der erste Band der
Sammlung dieser "Kleinen Schriften" liegt nun vor.
Er vereinigt eine Vielzahl von Texten, die verstreut publiziert
worden sind und hier nun zusammengefasst und zum größten Teil
erstmals auf deutsch erscheinen: von den frühen
Auseinandersetzungen mit Rousseau, Kant, Bergson, Hyppolite über
brillante Essays zu Schriftstellern wie Jarry, Roussel, Cixous zum
Kriminalroman der "serie noire", über Malerei bis hin zu Texten
aus dem Umkreis der zahllosen Debatten über Psychiatrie und
Politik, die sein gemeinsam mit Felix Guattari verfasstes Buch
Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie ausgelöst hat - und
natürlich immer wieder Nietzsche.
In diesen kleinen Texten kommt ein anderer Deleuze zum Vorschein,
ein witziger, pointierter Autor, der über einsame Inseln ebenso zu
schreiben weiß wie über nomadisches Denken und die Psychoanalyse
und in dessen Texten ein "philosophischer Humor" herrscht, "der
auch den Texten seiner heute schreibenden akademischen Kollegen
gut anstünde", wie die Frankfurter Rundschau anlässlich des
Erscheinens der französischen Ausgabe geschrieben hat.
Verlagsinformation |
|
|
Eva Illouz: Der Konsum der Romantik. Liebe und die
kulturellen Widersprüche des Kapitalismus. Frankfurter Beiträge
zur Soziologie und Sozialphilosophie, Band 4. Campus-Verlag 2003.
ISBN: 3-593-37201-0.
|
|
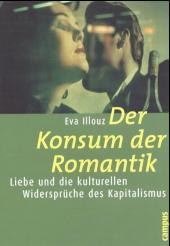
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Romantische
Liebe gilt als letztes Refugium in einer kommerzialisierten Welt.
Dieses Buch dagegen beleuchtet, wie sich die Paarbeziehung unter
dem Einfluss des totalen Konsums verändert hat.
Zu den
kulturellen Widersprüchen, die den Kapitalismus kennzeichnen
sollen, gehört der Gegensatz von romantischem Liebesideal und der
kalten Welt der Ökonomie. Das in den USA preisgekrönte Buch zeigt
dagegen auf, inwiefern die beiden Sphären sich längst
wechselseitig beeinflussen und ineinander übergehen: So, wie die
Konsumsphäre in wachsendem Maße auf die Erzeugung romantischer
Gefühlszustände abzielt, so geraten die Intimbeziehungen immer
stärker in Abhängigkeit von der Inszenierung und dem Erlebnis des
Konsums. Die kollektive Utopie der Liebe, einst als
Transzendierung des Marktes idealisiert, ist im Prozess ihrer
Verwirklichung zum bevorzugten Ort des kapitalistischen Konsums
geworden.
Rezension
"Was mich an diesem Buch am stärksten beeindruckt, ja fasziniert hat,
ist die Souveränität, mit der hier kühle Beobachtungsgabe und
soziologisches Ethos wieder miteinander verknüpft worden sind:
Gestützt auf Interviews, Werbekampagnen, Frauenmagazine und
Ratgeberliteratur gelingt es Eva Illouz, detailliert die wachsende
Kolonialisierung der Liebe durch Kommerz und Konsum aufzuzeigen,
ohne dabei die hartnäckigen Bemühungen der Subjekte um die
Verwirklichung der romantischen Utopie zu verraten." (Axel Honneth)
Zur Autorin
Eva Illouz ist Dozentin am Fachbereich für Soziologie und
Anthropologie der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zu ihren
Forschungsschwerpunkten gehören die Soziologie der Emotionen, der
Konsumgesellschaft und der Medienkultur. Zuletzt erschien von ihr
"Oprah Winfrey and the Glamour of Misery: An Essay on Popular
Culture" (Columbia University Press, 2003).
Verlagsinformation |
|
|
Hermann Scheer: Die Politiker. Kunstmann-Verlag 2003. ISBN:
3-88897-343-0.
|
|
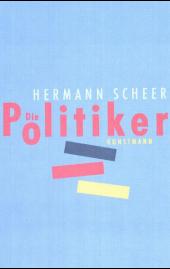
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Politik, im
richtigen Sinne des Begriffs, ist gesellschaftliche
Existenzbedingung. Ohne Politiker keine Politik. Es ist ein
Alarmsignal für Gesellschaften, wenn Politik zum Unwort geworden
ist und Politiker zum Schimpfwort. Die Erfahrung oder zumindest
Wahrnehmung, dass das gesellschaftliche Mandat der "Politik" von
den "Politikern" nicht mehr konstruktiv praktiziert wird, hat zu
einem dramatischen Vertrauensverlust in beide geführt. Wenn sich
soziale und wirtschaftliche Existenzgefahren zuspitzen und Wähler
den gewählten Volksvertretern und Parteien deren Lösung nicht mehr
zutrauen, droht ein Verfall demokratischer Verfassungsstaaten.
Hermann Scheer, aktiver Politiker, Wissenschaftler und
"praktischer Visionär" (Bundespräsident Rau), untersucht in diesem
Buch die Grundbedingungen politischen Handelns, die derzeitige
Verfassung unserer politischen Institutionen und ihrer Akteure
–
und die Vorstellungen, die wir uns von ihnen machen.
Zum Autor
Hermann Scheer, geboren 1944, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftler, ist seit 1988 Präsident von Eurosolar, der
Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien. Er leitete
zahlreiche wissenschaftliche Konferenzen über erneuerbare
Energien, u.a. die Welt-Biomassekonferenz und die Europäische
Photovoltaik-Konferenz. Er ist seit 1980 Mitglied des Deutschen
Bundestages. 1998 erhielt Hermann Scheer den Weltsolarpreis, 1999
wurde er mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet, 2000 mit
dem Weltbiomassepreis.
Verlagsinformation
|
|
|
Gentry Lee/Michael White: Eine Geschichte der Zukunft. Was
das 21. Jahrhundert bringt. Heyne-Verlag 2003. ISBN: 3-453-87442-0.
|
|

mehr Infos
bestellen
|
Wie könnte unsere Zukunft aussehen? Die Autoren Gentry Lee und
Michael White zeichnen in der Form eines Geschichtsbuches ein
packendes Bild der Welt im 21. Jahrhundert. Neben den politischen
und wirtschaftlichen Veränderungen stehen die großen biologischen
und technischen Errungenschaften im Zentrum: China steigt nach
einer globalen Wirtschaftskrise zur Weltmacht Nummer eins auf.
Genmanipulation ist gang und gäbe, bald bevölkern Klone die Welt.
Fast alle Erbkrankheiten lassen sich beseitigen.
Die Computertechnik wird immer weiter verfeinert, jeder Mensch ist
mit einem persönlichen kleinen Rechner ausgestattet, der über
seine Gesundheit wacht und den Alltag regelt. Anti-Aging-Pillen
bringen den Alterungsprozess völlig zum Stillstand. 2037 wird das
erste komplett genmanipulierte Wunschkind geboren. Computer
schrumpfen auf die Größe von Armbanduhren und können Signale
direkt vom Gehirn des Nutzers verarbeiten. Nach dem
Indien-Pakistan-Krieg von 2016 herrscht weltweit Friede.
In ihrem "Geschichtsbuch des 21. Jahrhunderts" entwerfen der
Zukunftsforscher und Science-Fiction-Bestsellerautor Gentry Lee
und der preisgekrönte Wissenschaftsjournalist Michael White ein
faszinierendes Szenario unserer Zukunft. Neben den großen Heroen
des 21. Jahrhunderts widmet sich das Buch auch ausführlich den
Veränderungen im Alltagsleben des Durchschnittsbürgers. Ein
anregendes Geschichtsbuch über ein vermutlich spannendes
Jahrhundert.
Verlagsinformation |
|
|