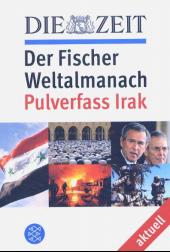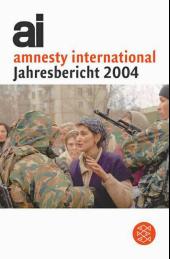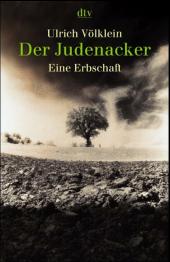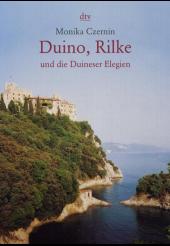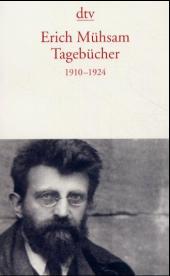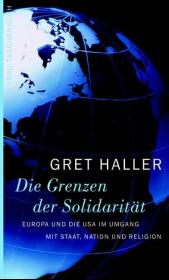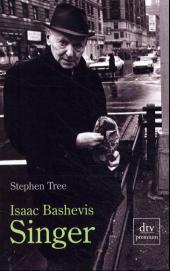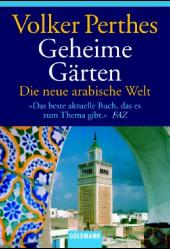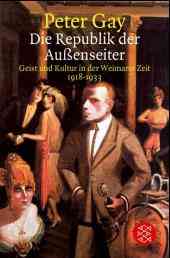|
Volker Ullrich/Felix Rudloff: Der Fischer Weltalmanach aktuell:
Pulverfass Irak. Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN:
3-596-72302-7. |
|
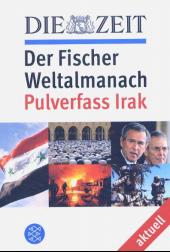
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
In einer einzigartigen Zusammenstellung präsentieren DIE ZEIT und
Der Fischer Weltalmanach Reportagen, Analysen und Fakten zum Irak.
Der Inhalt:
- Der Weg in den Krieg
- Der Irak-Krieg und das Völkerrecht
- Neue Kriegführung und die Rolle der Medien
- Kriegstage in Bagdad
- Streit innerhalb des Bündnisses über den Irak-Krieg
- Kampf um die Nachkriegsordnung
- Terror und Widerstand im besetzten Land
- Wie Bush die Weltöffentlichkeit täuschte
- Saddams Verbrechen und ihre juristische Verfolgung
- Scheitern die USA im Irak?
- Zahlen und Daten zu Politik, Bevölkerung und Wirtschaft
- Chronik der wichtigsten Ereignisse seit 1990
- Biografien aller wichtigen Akteure der Nachkriegsära
Mit Beiträgen von Richard Rorty, Walter Laqueur, Martin van
Creveld, Michael Walzer, Josef Joffe, Michael Naumann, Matthias
Naß, Thomas Kleine-Brockhoff, Ulrich Ladurner und anderen
bekannten ZEIT-Autoren.
Zu einem der Autoren
Dr. phil. Volker Ullrich, geboren 1943, ist Leiter des Ressorts
"Politisches Buch" bei der ZEIT.
Verlagsinformation |
|
|
Amnesty International: Jahresbericht 2004.
Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-596-16185-1. |
|
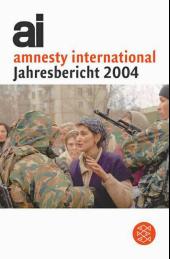
mehr Infos
bestellen
|
Der
Jahresbericht von amnesty international ist eine Dokumentation
über Menschenrechtsverletzungen in aller Welt. Er gibt Auskunft
über die weltweiten Bemühungen dieser Organisation um Freilassung
gewaltloser politischer Gefangener und um Abschaffung von Folter
und Todesstrafe.
Verlagsinformation |
|
|
Ulrich Völklein: Der Judenacker. Eine Erbschaft. Deutscher
Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-423-34110-6. |
|
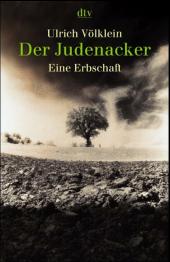
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Dieses Buch ist keine Fiktion. Es beschreibt wahrheitsgemäß das
Schicksal einer jüdischen Gemeinde in einem Dorf mitten in
Deutschland.
Die Erbschaft eines Grundstücks wirft Fragen auf, denen Ulrich
Völklein in seinem Tatsachenroman nachgeht. Er hat den Judenacker
seines Heimatortes Geroldshausen geerbt. Wie kommt seine Familie
in diesen Besitz? Im Ort gibt es keine Juden mehr, was ist aus
ihnen und ihrem Besitz geworden? Solche Fragen stoßen bei den
Dorfbewohnern auf Ablehnung und Schweigen. Doch Völklein folgt der
Spur in die Vergangenheit, die er exemplarisch an drei Personen
beschreibt: Sein Vater, Untersturmführer der Waffen-SS, schlägt
sich im Mai 1945 in sein Heimatdorf durch, setzt sich dann in den
Norden ab. Erst Monate später kehrt er zurück und stellt sich der
Entnazifizierung. Auch Eduard Wirths versucht unterzutauchen. Er
war verantwortlicher Arzt im KZ Auschwitz. Seiner Verhaftung durch
die Briten entkommt er jedoch nicht, schließlich begeht er
Selbstmord und entzieht sich dadurch einem öffentlichen
Gerichtsurteil. Der Geroldshauser Jude Heinz Maier wurde
entrechtet und vertrieben. Nun kehrt er mit der US-Armee zurück.
Vor der Flucht hatte er mit seinem Vater die Unterlagen der seit
Jahrhunderten im Ort angesiedelten jüdischen Gemeinde versteckt.
Sie sind erhalten geblieben und belegen die lange, großteils
leidvolle Geschichte der Juden in der Region. Jahrzehnte später
deckt der Autor in den USA auf, dass das Unrecht nicht mit der
Naziherrschaft endet. Maiers Rückkehr war nicht erwünscht und er
wurde nur geringfügig entschädigt. Er wurde ein weiteres Mal
vertrieben und ausgegrenzt.
Zum Autor
Ulrich Völklein, Jahrgang 1949, war nach dem Geschichtsstudium bis
1995 Mitglied der politischen Redaktion der ZEIT und Ressortleiter
Politik und Zeitgeschichte des STERN. Völklein hat zahlreiche
Sachbücher zur NS-Zeit veröffentlicht. Heute lebt er als freier
Autor in Hamburg.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
- "Nix mehr wiss!"
Wie ein Dorf in Franken mit seinem "Judenacker" lebt
(DIE ZEIT Nr. 51/2002)
-
Lesung von Ulrich Völklein im Buchladen Neuer Weg am 07.05.2002 |
|
|
Monika Czernin: Duino, Rilke und die Duineser Elegien.
Originalausgabe. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN:
3-423-34108-4. |
|
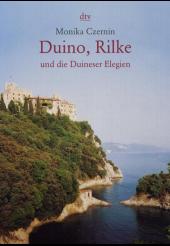
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Monika Czernin verbindet in diesem Bildband die Geschichte der
Elegien mit ihrem Entstehungsort, den sie mit dem Werk zu einem
Klang werden lässt. Sie berichtet über die Historie des Schlosses,
das bis heute im Besitz der Fürstenfamilie Thurn und Taxis ist,
und den Salon der Fürstin Marie von Thurn und Taxis, der großen
Freundin und Gönnerin Rilkes. Bilder von damals und heute und
natürlich die Elegien selbst vervollständigen diesen sinnlichen
Blick auf eine Welt der Schönheit, Archaik und Poesie.
Zur Autorin
Monika Czernin studierte Pädagogik, Politikwissenschaft,
Publizistik und Philosophie in Wien und arbeitete für Radio und
Fernsehen, anschließend als Kulturredakteurin für die Tageszeitung
"Die Presse". Seit der Geburt ihrer Tochter lebt sie als freie
Autorin und Journalistin in München, wo sie für "Focus" und andere
Zeitschriften tätig ist. Von ihr erschien unter anderem "Picassos
Friseur" (mit Melissa Müller).
Verlagsinformation |
|
|
Götz Großklaus: Medien-Bilder. Inszenierung der
Sichtbarkeit. Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12319-X. |
|

mehr Infos
bestellen |
Nach seinem viel
beachteten Buch "Medien-Zeit,
Medien-Raum" (2. Auflage 1997) widmet Götz Großklaus sein neues Buch in
Fortsetzung des Gedankengangs Bildern und Bildfolgen, in denen
sich medienspezifische Sichtbarkeiten herstellen.
Die mediale Bild-Inszenierung des Massen-Körpers im Fernsehen
exponiert den Körper als Schnittstelle des Biologischen und des
Politischen. Das mediale Bild traumatischer und auratischer Orte
thematisiert Brüche, Zäsuren und Schwellen im historischen Prozeß
und archiviert Szenen des Übergangs im externen kollektiven
Gedächtnis.
Die mediale Inszenierung von Sichtbarkeit (Körper, Raum,
Katastrophe, Natur, Zeit) ist somit immer mit der Thematisierung
von Gedächtnis und Erinnerung verbunden. Das trifft auch für den
persönlichsten Raum, den der fernen Kindheit, zu. In Bildarchiven
werden Zeit-Bilder aufbewahrt, Bilder der angehaltenen und der
verfließenden Zeit, des Augenblicks etc. Götz Großklaus
beschreitet mit seinem Medienprojekt immer wieder neue Areale der
Mediengeschichte und besticht durch seine assoziative Intelligenz.
Verlagsinformation |
|
|
Erich Mühsam: Tagebücher 1910-1924. Herausgegeben und mit
einem Nachwort von Chris Hirte. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2004.
ISBN: 3-423-13219-1. |
|
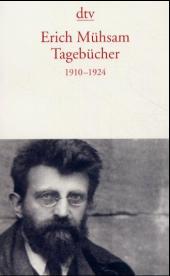
mehr Infos
bestellen
|
In den Tagebüchern hält Mühsam die kulturellen und politischen
Umbrüche einer bewegten Zeit fest, die er in vielfältiger Weise
mitgestaltete. Seine Aufzeichnungen sind eine illustre Chronik der
Münchner Boheme, sie schildern seine Affären, Begegnungen,
Aktionen, seine Erfolge und Niederlagen, sein Wirken als Dichter
und Agitator, seine Konflikte mit der Staatsgewalt.
Die Tagebücher begleiten Mühsam durch den ersten Weltkrieg und
dokumentieren seine Wandlung vom aktiven Kriegsgegner zum
Revolutionär, seine Verhaftung und Verurteilung als Leitfigur der
Münchner Rätebewegung, den Kampf ums Überleben in der bayerischen
Festungshaft.
Verlagsinformation
|
|
|
Gret Haller: Die Grenzen der Solidarität. Europa und die USA im
Umgang mit Staat, Nation und Religion. Aufbau-Taschenbuch-Verlag
2004. ISBN: 3-7466-8108-1.
|
|
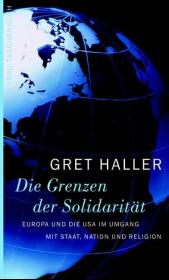
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
"Die
Grenzen der Solidarität" diskutiert die historischen Wurzeln der
großen, eklatanten Unterschiede im Rechts-, Staats- und
Politikverständnis von Westeuropäern und US-Amerikanern. Sie
stellt damit auch die seit dem 11. September erneut viel
beschworene westliche Wertegemeinschaft in Frage. Gret Haller
ermutigt mit ihrem Buch die Europäer, die Tradition der Aufklärung
und damit ihre eigene Identität nicht preiszugeben.
Rezension
Sein Lob für dieses Buch von Gret Haller, die bis zum Jahr 2000
als Ombudsfrau für Menschenrechte tätig war, fasst Rezensent Claus
Leggewie in eine teilweise verwirrende Besprechung. Nicht immer
lässt sich klar unterscheiden, wo Hallers Analyse aufhört und
Leggewies Argumentation beginnt. Klar wird jedoch, dass Haller mit
"Die Grenzen der Solidarität" eine ausgesprochen kritische
Bestandsaufnahme der Wiederaufbaupolitik in Bosnien-Herzegowina
liefert, die Leggewie durchaus überzeugend findet. Ihre zentrale
These fasst er so, "dass die Vorherrschaft der USA im
Friedensprozess einen dauerhaften Frieden in Bosnien und
Herzegowina unmöglich gemacht hat". Schuld daran trägt, wie
Leggewie Hallers Gedankengang paraphrasiert, ein amerikanisches
Verständnis von Staat und Politik, das – im Unterschied zum
europäischen – ethnischen und religiösen Partikularismen zu viel
Raum gebe und damit eine Institutionalisierung von universalen
Normen und Werten verhindert habe. (Zusammenfassung der Rezension
von Klaus Leggewie in der taz vom 29.04.2003 auf Perlentaucher.de)
Zur Autorin
Gret Haller, geb. 1947 in Zürich, zunächst als Anwältin tätig.
1984-1988 Mitglied der Regierung der Stadt Bern. 1987-1994
Mitglied des Schweizerischen Parlamentes sowie der
Parlamentarischen Versammlungen des Europarates und der OSZE,
1993/94 Präsidentin des Schweizerischen Parlamentes. 1994-1996
Botschafterin der Schweiz beim Europarat in Straßburg, 1996-2000
Ombudsfrau für Menschenrechte des Staates Bosnien und Herzegowina
in Sarajevo, gewählt durch die OSZE. Zahlreiche Buch- und
Zeitschriftenpublikationen zur Gleichstellung von Mann und Frau,
zu Menschenrechten und Menschenrechtskultur.
Verlagsinformation
Weitere Informationen:
-
Interview mit Gret Haller über Europa und die USA (Senior-Web,
Schweiz)
-
Zusammenfassung von Rezensionen (Perlentaucher.de) |
|
|
Stephen Tree: Isaac Bashevis Singer. Originalausgabe.
Deutscher Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN: 3-423-24415-1. |
|
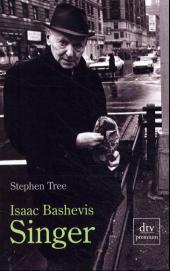
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Er schrieb in einer Sprache, die als aussterbend galt. Im
US-amerikanischen Exil, wo entsprechende Buchladenbesitzer –
jedenfalls in einer seiner Geschichten – weniger das
Bestohlenwerden als das Einschmuggeln weiterer unverkäuflicher
Werke fürchteten: Isaac Bashevis Singer, Nobelpreisträger für
Literatur 1978. Dieser aktuelle Band erscheint am 14. Juli 2004
zum 100. Geburtstag eines der Meisters der jiddischen Literatur.
Singer war ein Mann der Widersprüche, von Anfang an. Dass er
einmal einer der meistgelesenen Schriftsteller der USA sein würde,
war Isaac Bashevis Singer nicht in die Wiege gelegt. 1904
(eventuell auch 1902) als Sohn des frommen chassidischen Rabbiners
Pinchos Menachem Zynger im polnischen Leoncin geboren, sind die
frühen Jahre von Armut und der eng begrenzten, religiös geprägten
Welt des jiddischsprachigen Ostjudentums bestimmt. Diese Sphäre
wurde später zum nahezu ausschließlichen Stoff seines
literarischen Schaffens, eines Werks von Weltrang.
Über Warschau, wo er das Rabbinerseminar besuchte und zum
Schriftsteller reifte, kam Singer 1935 nach New York, jene Stadt,
in der bereits sein älterer Bruder Israel Joshua als Journalist
und Autor lebte.Den rabbinischen Familienauftrag künstlerisch
weiterführend, erweiterte er die Eindeutigkeit des religiösen
Gerichtshofs um die Einsicht in die Fehlbarkeit des modernen
Menschen, dem keine Leidenschaft und Schwäche fremd ist,
wenngleich er um die Scheidung von Gut und Böse weiß.
Es dauerte bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg, bis sich für Isaac
B. Singer neben dem Erfolg bei jiddischsprachigen US-Amerikanern
langsam auch die Anerkennung durch das englischsprachige Publikum
einstellt. Sie gipfelt im Literaturnobelpreis 1978. Ein Leben lang
in komplizierte Liebesbeziehungen verwickelt, war er 50 Jahre
glücklich verheiratet, litt am eigenen Hang zur Zeitvergeudung und
wurde Schöpfer eines belletristischen Werks, das an Vielfalt und
Umfang seinesgleichen sucht. Isaac B. Singer stirbt am 24.
Juli 1991.
"Es wird nach Singer kaum einen ähnlich bedeutenden Dichter der
jiddischen Sprache und Geisteswelt geben. Sein Werk ist ein
unheimlicher und großartiger Abgesang der untergegangenen
ostjüdischen Kulturwelt." (Die Welt)
Zum Autor
Stephen Tree, geboren 1949 in der Schweiz, absolvierte die
Regieklasse der Staatlichen Schauspielakademie Zürich. Tree hatte
Engagements in Bielefeld und an der Schaubühne Berlin, danach war
er tätig als freier Regisseur, Dramaturg, Übersetzer und
Funk-Autor. Er lebt seit 1976 mit seiner Frau in Berlin.
Verlagsinformation |
|
|
Volker Perthes: Geheime Gärten. Die neue
arabische Welt. Goldmann-Verlag 2004 (Erweiterte Ausgabe). ISBN:
3-442-15274-7. |
|
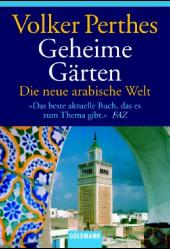
mehr Infos
bestellen |
Von
außen erscheint die arabische Welt einerseits bedrohlich,
andererseits eigentümlich statisch. Doch die Staaten des Nahen und
Mittleren Ostens wie Nordafrikas befinden sich in einer
historischen Umbruchphase, auch wenn der arabisch-israelische
Friedensprozess zu stagnieren scheint. Der Krieg um Kuwait, der
Friedensprozess im Nahen Osten haben die Beziehungen der Länder
zueinander in Bewegung gebracht; es gibt neue weltwirtschaftliche
Herausforderungen und Integrationsversuche, die die Region vor
völlig neue Fragen stellen. Der Tod langjähriger Herrscher wie
König Hussein von Jordanien, König Hassan von Marokko und
Präsident Assad von Syrien hat in der arabischen Welt einen
Generationenwechsel eingeleitet, der innerhalb eines Jahrzehnts zu
einem vollständigen Austausch der politischen Führungseliten
–
nicht nur der Könige und Präsidenten
–
führen wird.
Perthes untersucht die Faktoren des Wandels in den wichtigsten
Staaten dieser Region. Er fragt dabei nach den Chancen der
wirtschaftlichen wie der politischen Erneuerung. Der Nahe und
Mittlere Osten entwickelt sich mittelfristig sicher nicht zu einer
europäischen Demokratie. Er wird aber pluralistischer, und die
neuen Führungen sind daran interessiert, ihre Länder
wirtschaftlich stärker zu öffnen, besonders Europa gegenüber.
Fraglich bleibt, ob diese Generation
in der Lage sein wird, innergesellschaftliche und
zwischenstaatliche Konflikte erfolgreicher zu bewältigen als
vorangegangene Generationen. Die Frage von Krieg und Frieden
bleibt nicht nur nach außen hin virulent.
Der Nahostexperte Volker Perthes widmet der Region eine
tiefgehende Analyse – eines der besten aktuellen Bücher, das es
zum Thema gibt. Er beschreibt die Reformbemühungen der Regierungen
und ordnet sie ein. Seine Prognosen sind vorsichtig optimistisch,
so hofft er etwa für die Zukunft auf einen "autoritären
Pluralismus“. Im Irak werde bald eine "Wachablösung" stattfinden,
in der die Söhne ihre Väter ersetzen. Doch das werde nur gelingen,
wenn sich die neuen Herrscher wenigstens ein Stück von ihren
Vätern entfernt haben.
"Das beste aktuelle Buch, das es zum Thema gibt." (FAZ)
Verlagsinformation |
|
|
Peter Gay: Die Republik der Außenseiter. Geist und Kultur in der
Weimarer Zeit 1918-1933. Fischer-Taschenbuch-Verlag 2004
(Neuausgabe). ISBN: 3-596-15950-4. |
|
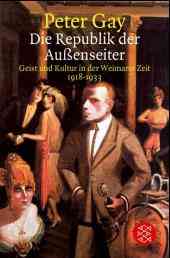
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
"Es ist Peter Gay gelungen, ein ebenso lebendiges und buntes wie
vielseitiges Bild... der Weimarer Epoche zu entwerfen." (FAZ)
Zum Autor
Peter Gay ist emeritierter Sterling-Professor für Geschichte der
Yale University und Direktor des Dorothy and Lewis B. Calman-Centers
für Wissenschaftler und Schriftsteller an der New York Public
Library. Werkauswahl: "Erziehung der Sinne. Sexualität im
bürgerlichen Zeitalter", "Die Zarte Leidenschaft. Liebe im
bürgerlichen Zeitalter", "Der Kult der Gewalt. Aggression im
bürgerlichen Zeitalter", "Die Macht des Herzens. Das 19.
Jahrhundert und die Erforschung des Lichts".
Verlagsinformation |
|
|