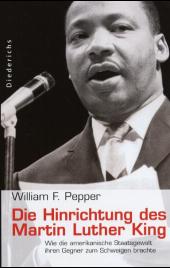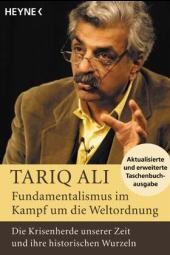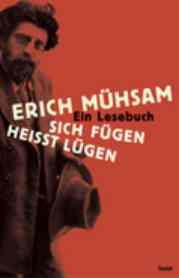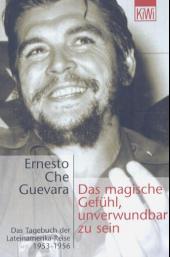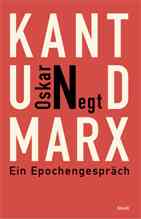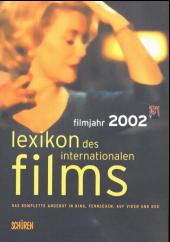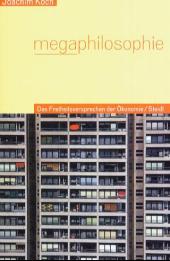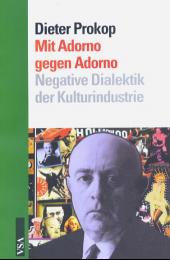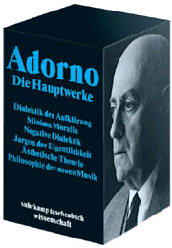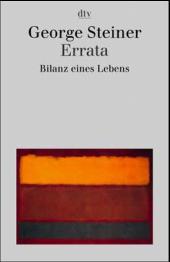|
William
F. Pepper: Die Hinrichtung des Martin Luther King. Wie die
amerikanische Staatsgewalt ihren Gegner zum Schweigen brachte.
Diederichs-Verlag 2003. ISBN: 3-7205-2405-1. |
|
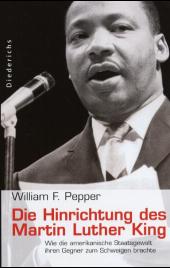
mehr Infos
bestellen
|
Bis
heute hat Amerika den charismatischen und wortgewaltigen Südstaatenprediger
nicht vergessen, dessen Name in einem Atemzug mit Mahatma Gandhi
genannt wird. Alljährlich am dritten Montag im Januar wird Martin
Luther King mit einem nationalen Gedenktag gefeiert – eine Ehre,
die ansonsten nur noch den einstigen Präsidenten Washington und
Lincoln zuteil wird. Zu Lebzeiten war der Friedensnobelpreisträger
allerdings den Mächtigen des Landes ein Dorn im Auge. Das FBI
unter Edgar Hoover lancierte umfängliche Abhör- und
Verleumdungskampagnen gegen King, der sich fortan einer Flut von
Prozessen ausgesetzt sah.
An der Spitze der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung kämpfte
Martin Luther King, 1929 in Atlanta geboren, ab Mitte der 50er
Jahre entschlossen mit den Mitteln des gewaltlosen Widerstands
gegen den Skandal der Rassentrennung im demokratischen Amerika und
für die Gleichstellung der Schwarzen: dafür, dass sie ihren
Sitzplatz im Bus nicht einem Weißen freimachen mussten, dass sie
in denselben Hotels ein Zimmer bekommen, dieselben öffentlichen
Toiletten benutzen und eine gemeinsame Erziehung an öffentlichen
Schulen erhalten durften. Unvergessen ist seine Rede "I Have
A Dream", die er am 28. August 1963 vor dem Lincoln Memorial
hielt: "Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder
eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach
ihrer Hautfarbe, sondern nach dem Wert ihres Charakters beurteilt
werden." Mehr als 200.000 Menschen lauschten damals den
Worten Kings. Beim "Marsch auf Washington" hatten sie
sich zu der bis dahin größten Demonstration versammelt, die die
Hauptstadt je erlebt hatte.
Doch King kämpfte nicht nur für ein Ende der
Rassendiskriminierung. Er exponierte sich auch als entschiedener
Gegner des Vietnamkriegs und attackierte die wachsende Kluft
zwischen Arm und Reich in Amerika. Ab Mitte 1967 engagierte er
sich in der "Poor People's Campaign", die im Frühjahr
1968 in einem Protestcamp von hunderttausenden Armen in Washington
gipfeln sollte. Im März 1968 unterstützte Martin Luther King in
Memphis, Tennessee einen Streik von nicht gewerkschaftlich
organisierten, überwiegend schwarzen Arbeitern. Am 5. April
wollte er ihren Protestmarsch anführen. Dazu kam es nicht mehr.
Am Abend des 4. April wurde Martin Luther King auf dem Balkon
seines Zimmers im "Lorraine"-Motel durch einen gezielten
Kopfschuss niedergestreckt. Der berühmte Vorkämpfer der amerikanischen Bürgerrechts- und
Friedensbewegung wurde in einem Komplott von
US-Regierung, Militär, FBI und CIA beseitigt. Dass ein US-Gericht
dies bestätigt hat, ist das Verdienst des Rechtsanwalts William
F. Pepper, der den angeblichen Mörder seines Freundes King
vertrat. Er deckt auf: King musste sterben, weil er für die
US-Regierung zu einer Bedrohung wurde.
Verlagsinformation/Kulturweltspiegel
Weitere Informationen:
Opfer eines Mordkomplotts: Warum Martin Luther King sterben musste
(WDR, 23.02.2003) |
|
|
Tariq
Ali: Fundamentalismus im Kampf um die Weltordnung. Die
Krisenherde unserer Zeit und ihre historischen Wurzeln. Heyne-Verlag
2003 (Aktualisierte und erweiterte Ausgabe). ISBN: 3-453-86910-9. |
|
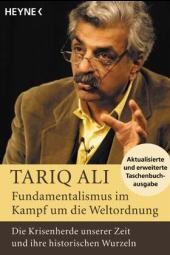
mehr Infos
bestellen
|
Der in London lebende pakistanische
Publizist Tariq Ali ist ein Grenzgänger zwischen der westlichen und der arabischen Welt. Er kennt wie kein anderer die auf beiden Seiten bestehenden Konflikte und ihre historischen Wurzeln. Gestützt auf seine eigenen Erlebnisse und auf seine persönlichen Begegnungen mit den Machthabern in
Afghanistan, Pakistan, Indien und Kaschmir gelingt dem überzeugten Atheisten eine ideologisch ungefärbte und dabei sehr persönliche Bewertung der politisch-religiösen Machtkämpfe. Dabei sieht er den Aufstieg des islamischen Fundamentalismus ebenso wie die neu erwachten Formen des westlichen Kolonialismus und entlarvt den "Kampf der Kulturen" als einen Kampf der Fundamentalisten, gleich welcher ideologischen oder religiösen Gesinnung.
Verlagsinformation
|
|
|
Erich
Mühsam: Sich fügen heißt lügen. Steidl-Verlag 2003. ISBN:
3-88243-886-X. |
|
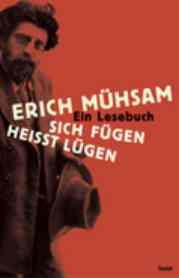
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Erich Mühsam wird von jeder Generation neu entdeckt und gelesen.
Der Schriftsteller, Anarchist und Bohemien war ein Querdenker,
dessen gelebte Subkultur, gedankliche Radikalität und
Unmittelbarkeit im poetischen Ausdruck immer wieder provozieren
und faszinieren. Der "Gefühlsanarchist" Mühsam war geprägt von
einem Hass auf Autoritäten und einer tief
empfundenen Verbundenheit mit den sozial Benachteiligten. Dies
spiegelte sich in seiner "privaten" Lyrik, in Streitschriften,
tagespolitischer Satire und seiner Autobiographie.
Auf zwei Wegen ist Erich Mühsam hier neu zu entdecken: über ein
Lesebuch mit seinen interessantesten Texten und einen Bildband,
der Leben und Werk anschaulich dokumentiert in Briefen und
Manuskripten, Plakaten und Karikaturen, Fotografien und
bildnerischen Werken. Die Jahre der Schwabinger Boheme werden
nachgezeichnet, die Zeit des ersten Weltkriegs, der Münchner
Räterepublik, die Festungshaft in Bayern und die politische Arbeit
in der Weimarer Republik, schließlich die Inhaftierung und
Ermordung des politisch missliebigen
"Revoluzzers".
Zum
Autor
Erich
Mühsam, geboren 1878 in Berlin, verbrachte Kindheit und
Jugend in Lübeck, war ab 1901 freier Schriftsteller und
anarchistischer Agitator. 1919 Mitglied der Münchner Räterepublik,
1926 gründete er in Berlin die Monatszeitschrift
"Fanal". 1933 wurde er von den Nazis verhaftet, in
verschiedenen Gefängnissen misshandelt und 1934 im
Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Er schrieb Gedichte und
Dramen, Rezensionen, Essays und die zeitgeschichtlich bedeutende
Autobiographie "Unpolitische Erinnerungen".
Verlagsinformation |
|
|
Ernesto
Ché Guevara: Das magische Gefühl, unverwundbar zu sein. Das Tagebuch der Lateinamerika-Reise 1953-1956.
Kiepenheuer & Witsch-Verlag 2003. ISBN: 3-462-03235-6. |
|
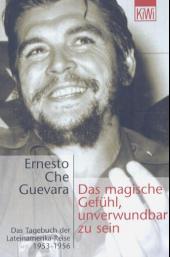
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
1953 begibt sich Ernesto
"Ché" Guevara mit seinem Freund Calica auf eine zweite
Reise durch Lateinamerika. Die Eindrücke, die Ché in drei Jahren
sammelt, prägen nicht nur seine politischen Überzeugungen. Sie
verstärken auch das innere Gefühl der Zugehörigkeit und
Zuneigung zu land und Leuten.
Zum Autor
Ernesto "Ché" Guevara Serna, geboren am 14. Juni 1928
in Rosario (Argentinien). Er war Arzt, beteiligte sich als
Guerillaführer zusammen mit Fidel Castro Ruz an der Befreiung
Kubas von der Batista-Herrschaft, hatte als Präsident der
kubanischen Nationalbank und Industrieminister maßgeblichen
Anteil an der Umgestaltung Kubas. 1964 ging er in den Kongo und
1965 nach Bolivien, um die Revolution weiterzutragen.
Verlagsinformation
|
|
|
Oskar
Negt: Kant und Marx. Ein Epochengespräch. Eine produktive
Aktualisierung von Kant und Marx.
Steidl-Verlag 2003. ISBN: 3-88243-897-5. |
|
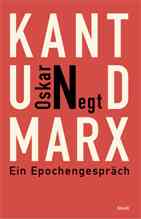
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Nach dem triumphalen Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus –
was kann uns Marx noch sagen? In einer Zeit hilfloser
Ethikkommissionen und übermächtiger Wirtschaftsinteressen – was
kann uns Kants kategorischer Imperativ bedeuten?
Niemand hat sich in der Geschichte der politischen Philosophie so
intensiv mit den Bedingungen unseres Wissens und Handelns, mit dem
gesellschaftlichen Sein beschäftigt wie Karl Marx. Niemand hat so
intensiv über moralische Gesetzgebung, über die Frage "Was soll
ich tun?" nachgedacht wie Immanuel Kant.
Die Auseinandersetzung mit Marx und Kant, mit der Dialektik von
Sein und Sollen steht seit vierzig Jahren im Mittelpunkt der
philosophischen Überlegungen von Oskar Negt. So nutzte er seine
Abschiedsvorlesung im Juli 2002, die er hier in ausgearbeiteter
Form vorlegt, zu einem Plädoyer für eine Renaissance ihres
Denkens. Das Epochengespräch von Kant und Marx verdeutlicht, wie
sehr Kritik und Selbstkritik ein produktives Medium der
Weltbetrachtung und der Friedenssicherung sein können, wie
viel wir gewinnen, wenn wir Kant und Marx zu unseren
Zeitgenossen machen.
Zum Autor
Oskar Negt, geboren 1934, Studium der
Rechtswissenschaft, Philosophie und Soziologie in Göttingen
und Frankfurt/Main, vor allem bei Max Horkheimer und
Theodor W. Adorno, und war Assistent bei Jürgen Habermas.
Er war von 1970 bis 2002 Professor für Sozialwissenschaften an der Universität
Hannover.
Zahlreiche Veröffentlichungen.
Verlagsinformation |
|
|
Sebastian
Haffner: Historische Variationen. Mit einem Vorwort von Klaus
Harpprecht. Deutscher Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN: 3-423-34010-X. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Erst Geschichtsschreibung schafft Geschichte. Geschichte ist keine
Realität, sie ist ein Zweig der Literatur. Mit dem vorausgegangenen Motto verleiht Sebastian Haffner den Historischen
Variationen einen Grundton, der durch alle Texte schwingt: Präzise,
kurz, scharf zugespitzt, mit überraschenden Gedankenwendungen
–
ein großer Meister der Geschichtsschreibung ergreift das Wort. Zweihundert Jahre deutscher Geschichte
lässt Haffner
–
kurzweilig
und eindringlich, analytisch scharf und mit dem Blick für
weitgespannte historische Entwicklungslinien
–
Revue passieren.
Zum Autor
Sebastian Haffner, geboren 1907 in Berlin, emigrierte 1938 nach England, wo
er mit "Germany: Jekyll & Hyde" eine scharfsinnige Analyse zum
zeitgenössischen Deutschland schrieb. 1954 kehrte er nach
Deutschland zurück. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die
"Anmerkungen zu Hitler",
"Von Bismarck zu Hitler"
und
"Der
Verrat – Deutschland 1918/1919". Sebastian Haffner starb sechs Tage
nach seinem 91. Geburtstag 1999 in Berlin.
Verlagsinformation
|
|
|
Horst P. Koll/Hans
Messias (Hrsg.): Lexikon des Internationalen Films, Filmjahr 2002:
Das komplette Angebot in Kino, Fernsehen, auf Video und DVD. Schüren-Presseverlag
2003. ISBN: 3-89472-346-7.
|
|
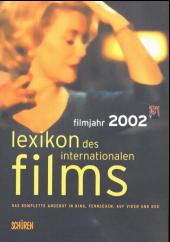
mehr
Infos
bestellen
|
Film war das Leitmotiv des 20. Jahrhunderts
und hat bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Im
Kosmos Kino spiegelt sich die Welt um uns und in uns –
faszinierend, erschreckend, banal. Ob Film
im Kino, auf Video im Fernsehen – das Jahrbuch 2002 des Lexikon
des Internationalen Films hilft auf dem Weg durchs überbordende
Filmangebot, wobei auch die Neuerscheinungen auf DVD
berücksichtigt werden.
Filmjahr 2002 fasst in einer Jahreschronik die wichtigsten
Filmereignisse zusammen, hebt die herausragenden Ereignisse
übersichtlich hervor, beschreibt alle neu aufgeführten Filme und
schlüsselt sie im Register nach Originaltiteln und Regisseuren
auf. Verzeichnet sind ferner die Preisträger wichtiger Festivals
und Schlüsseladressen aus dem Medienbereich.
Neu in dieser Ausgabe: Die "Top
Ten" der deutschen Filmkritiker -
das muss man gesehen haben.
"Ein guter Überblick über das Filmjahr" (Cinema)
“Routiniert und zuverlässig.” (Salzburger
Nachrichten)
“Fortführung des wichtigsten deutschen Filmlexikons.”
(epd Film)
Verlagsinformation |
|
|
Joachim
Koch: Megaphilosophie. Philosophie im Zeitalter der Ökonomie.
Steidl-Taschenbuch-Verlag
2003. ISBN: 3-88243-895-9. |
|
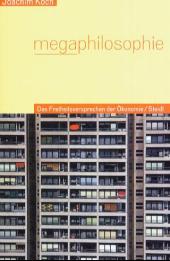
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Buch
"Was heißt, was kann, was soll Philosophie in einer Zeit, in der
sich die großen und universalen Erklärungen der Welt als haltlos,
als am Interesse des einzelnen vorbeigehend und nicht zuletzt als
Voraussetzung politischer Katastrophen herausgestellt haben? Was
heißt Philosophie in einer Zeit, in der das wirtschaftliche
Geschehen mehr als alles andere das Leben bestimmt?"
Megaphilosophie ist mehr als ein Gedankenentwurf zur Deutung der
Welt – sie definiert die Welt und diktiert ihr, wie sie zu sein
hat. Sie verändert die Gesellschaft grundlegend. Im Mittelalter
prägte die Kirche Denken und Verhalten, seit der Aufklärung galt
die Vernunft als Maßstab allen Handelns. Heute spielt diese alles
beherrschende Rolle die Ökonomie: Sie prägt unsere
Vorstellungen von Glück, Liebe und Lebenssinn.
Die Ökonomie stellt einen Absolutheitsanspruch. Nur den Nutzen im
Visier, gibt sie vor, Träume zu verwirklichen. Sie verspricht
viel, doch uneingelöste Versprechen schreibt sie stets dem
persönlichen Versagen und der Schuld eines jeden einzelnen zu. Ihr
Freiheitsbegriff lässt sich auf einen Satz
reduzieren: Wenn du reich bist, bist du frei.
Um den zugleich subtilen und fundamentalen Wirkungen des
Ökonomischen auf die Spur zu kommen, entfaltet Joachim Koch ein
Tableau der Sozial-, Wirtschafts- und Geistesgeschichte der
Moderne. Er erzählt auf fundierte und zugleich spannende Weise,
wie Megaphilosophien entstehen und funktionieren, was die
Megaphilosophie des Ökonomischen verspricht, welche Folgen dies
für die Formen des Zusammenlebens und die Künste hat.
Zum Autor
Dr. Joachim Koch, geboren 1954, studierte Philosophie und
Sozialwissenschaften. Er war unter anderem wissenschaftlicher
Angestellter in Regensburg, Geschäftsführer einer GmbH für
Philosophie und Marketing in Hamburg und Lehrer für Deutsch als
Fremdsprache in Rom. Er lebt in Rom, wo er an einer Internetseite
über Philosophinnen und Philosophen der Gegenwart arbeitet
(http://www.philosophers.com).
Verlagsinformation |
|
|
Ute
Frevert: Eurovisionen. Ansichten guter Europäer im 19. und 20. Jahrhundert. Fischer-Taschenbuch-Verlag
2003. ISBN: 3-596-60146-0. |
|

mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Was ist ein "guter Europäer" im Zeitalter der Globalisierung? Manche beschwören Europa als Mutterland, andere das Europa der Vaterländer. Die einen träumen von der "Festung Europa", die anderen von der Kraft der Multikulturalität. Kaum jemand sehnt sich zurück nach dem "Nationalitätswahn" von einst, nach Erbfeindschaft und Zivilisationsdünkel. Die alten Feindbilder haben sich aufgelöst. Neue Grenzen werden gezogen, innere und äußere, und es bilden sich europäische Gemeinsamkeiten und Identifikationen heraus
–
damals wie heute.
Zur Autorin
Ute Frevert, geboren 1954, Dr. phil., ist
Professorin für Allgemeine Geschichte an der Universität Bielefeld.
Wolfgang Benz, 1941 in Ellwangen/Jagst geboren, Dr. phil.,
Historiker, war bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Instituts für Zeitgeschichte. Seitdem ist er Professor und Leiter
des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin.
Verlagsinformation |
|
|
Dieter
Prokop: Mit Adorno gegen Adorno. Negative Dialektik der Kulturindustrie.
VSA-Verlag 2003. ISBN: 3-89965-000-X. |
|
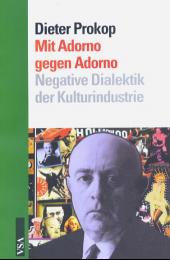
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Dieter Prokops Interesse gilt der Erneuerung der Kulturindustrie-Thesen der Frankfurter Schule. Er wirft ihr vor, dass sie ihr eigenes Programm nicht eingelöst hat und entwickelt die Grundzüge einer Negativen Dialektik der Kulturindustrie: Mit Adorno gegen Adorno.
Im September 2003 jährt sich der hundertste Geburtstag von Theodor W. Adorno. Adorno verkörperte den Typus eines "nonkonformistischen Intellektuellen" im Nachkriegsdeutschland. Im Zentrum seiner Arbeiten aus dieser Zeit standen immer wieder die Motive einer Kritik der Kulturindustrie, wie er sie schon in den 40er Jahren im amerikanischen Exil in der »Dialektik der Aufklärung« zusammen mit Max Horkheimer formuliert hatte. Seine Diagnose: eine jeglicher Kreativität enteignete standardisierte Subjektivität.
Dieter Prokop unternimmt den Versuch, die Warensprache der Kulturindustrie unvoreingenommen zu analysieren und wirft der kritischen Theorie der Kulturindustrie vor, dass sie ihr eigenes Programm nicht eingelöst hat. Die wichtigsten Dimensionen einer neuen Kritik der Kulturindustrie sind für ihn gerade nicht in den Veröffentlichungen Horkheimers und Adornos zu finden, die sich explizit mit Kulturindustrie befassen.
Prokop baut auf den entscheidenden Feldern der kritischen Theorie auf: Identisches und Nichtidentisches, Tauschabstraktion und Produktivkräfte, Positivismuskritik und Theorie kritischer Erfahrung. Er will über der Kritik am "Denken in abstrakter Allgemeinheit" die kreativen Kräfte nicht vergessen, die es in der Kulturindustrie gibt, und nicht nur den "Kult des Faktischen" kritisieren. Doch: "Wenn wir die Kulturindustrie-Kritik kritisieren, folgt daraus kein Lob der Kulturindustrie. Unsere Negation der Negation endet nicht im Positiven. Die Negation muss weitergehen. Sie geht weiter, indem man genau beobachtet" – mit Adorno gegen Adorno!
Zum Autor
Dieter Prokop ist Professor für kritische Medienforschung am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften – Schwerpunkt Kulturindustrie – der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Verlagsinformation |
|
|
Theodor
W. Adorno: Die Hauptwerke, 5 Bände. Dialektik der Aufklärung; Minima Moralia; Negative Dialektik; Ästhetische Theorie; Philosophie.
Suhrkamp-Taschenbuch-Verlag 2003. ISBN: 3-518-06699-4. |
|
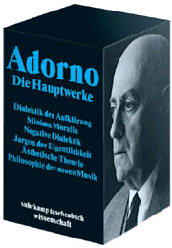
mehr
Infos
bestellen
|
Theodor W. Adorno (1903–1969) ist einer der bedeutendsten
Philosophen des 20. Jahrhunderts. Als Vertreter der Kritischen
Theorie und der Frankfurter Schule, als Vordenker der
Studentenbewegung, als Essayist, Musikkritiker, Komponist und
Hochschullehrer hat er die Geistesgeschichte nicht nur der
Bundesrepublik entscheidend geprägt. Sein pointierter Stil und die
Vielfalt seiner Themen haben ihn über die engen Fachgrenzen der
Philosophie hinaus bekannt und zu einem der führenden
Intellektuellen gemacht, dessen Schriften, Aphorismen und Gedanken
derart Teil der Kultur geworden sind, dass
sie sich nicht mehr daraus wegdenken lassen.
Zum 100. Geburtstag von Theodor W. Adorno am 11. September 2003
versammelt diese Kassette seine Hauptwerke und bietet somit eine
preisgünstige Ausgabe der großen Monographien.
Zudem sind nun erstmals alle Bücher der zwanzigbändigen
Taschenbuchausgabe der Gesammelten Schriften auch einzeln
lieferbar.
Verlagsinformation |
|
|
George
Steiner: Errata. Bilanz eines Lebens. Deutscher
Taschenbuch-Verlag 2002. ISBN: 3-423-30855-9. |
|
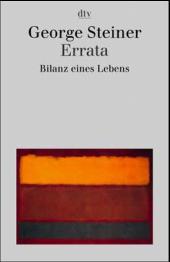
mehr
Infos
bestellen
|
Zum Autor
Die Autobiographie eines der letzten intellektuellen Kosmopoliten.
Aufgewachsen in Paris und Wien, studierte und lehrte George
Steiner an den renommiertesten amerikanischen und europäischen
Universitäten. Ein Leben lang hat er sich dem Druck der
Spezialisierung entzogen. Dieser konsequenten Haltung verdanken
wir ein eindrucksvolles Oeuvre, das sich mit zentralen Fragen von
Sprache und Literatur, Philosophie und Religion, Musik und
bildender Kunst auseinandersetzt. Dies persönliche Buch George
Steiners macht den inneren Zusammenhang seines Werks anschaulich.
"George Steiner ist nicht nur ein Meister der
Kunstbetrachtung und Muster der Gelehrsamkeit, er ist ein
Schriftsteller von hohen Graden. Ein Buch, das kein Leser
unbelehrt wieder zuschlagen wird." (DIE ZEIT)
Zum Buch
George Steiner, geboren 1929 in Paris, hat seit 1994 den
Lord-Weidenfeld-Lehrstuhl für Komparatistik an der Universität
Oxford inne. Von ihm sind
u.a. erschienen: "Martin
Heidegger" (1989), "Von realer Gegenwart" (1990) und
"Der Garten des Archimedes" (1997).
Verlagsinformation |
|
|