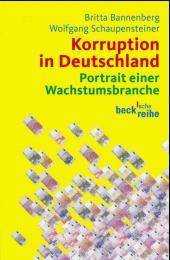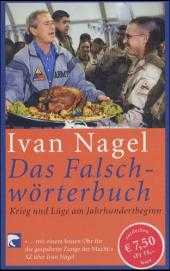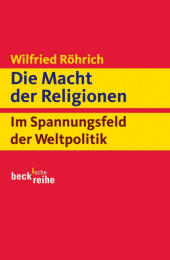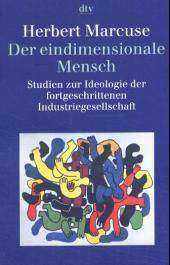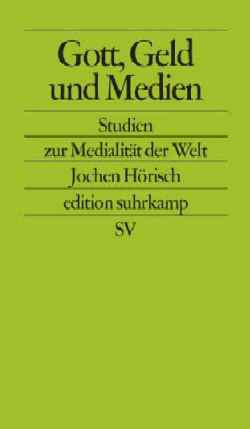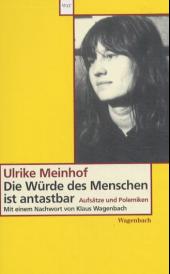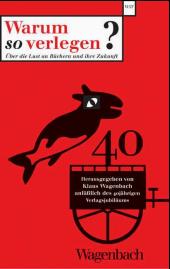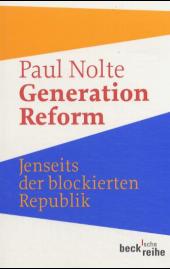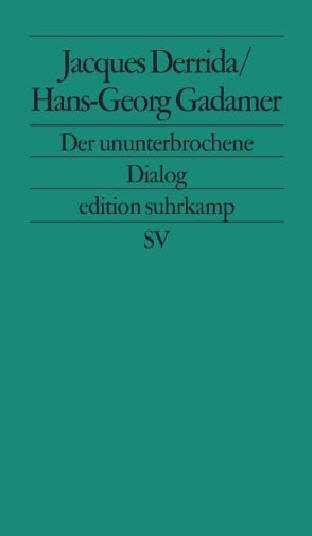|
Britta Bannenberg/Wolfgang J. Schaupensteiner: Korruption in
Deutschland. Portrait einer Wachstumsbranche. C.H. Beck-Verlag
2004. ISBN: 3-406-51066-3. |
|
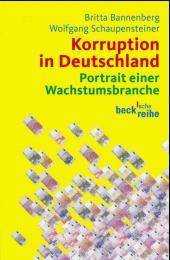
mehr
Infos
bestellen
|
Korruption ist effektiv, attraktiv und lukrativ. Das haben auch
Entscheidungsträger in unserer staatlichen Verwaltung und Politik
erkannt. Nicht nur in Abu Dhabi oder Sizilien, sondern längst auch
in Deutschland bestechen Verbandsfunktionäre und Bauunternehmer
Beamte und Politiker. Schmiergeldzahlungen sind in vielen Branchen
bereits Teil der Geschäftspolitik und fügen dem Fiskus jährlich
Schäden in Milliardenhöhe zu. Unbemerkt von Justiz und
Öffentlichkeit konnten weit verzweigte Beziehungsgeflechte
heranwachsen, weil Korruption in deutschen Amtsstuben
jahrzehntelang tabuisiert wurde. Anhand zahlreicher Originalfälle
stellen die Autoren die schillernden Facetten von Bestechung und
Bestechlichkeit anschaulich dar. Sie machen deutlich, dass es sich
hier nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein flächendeckendes
Kriminalitätsphänomen, das die Grundfesten staatlicher Autorität
und das Prinzip des freien Wettbewerbs erschüttert.
Verlagsinformation
|
|
|
Ivan Nagel: Das Falschwörterbuch. Krieg und Lüge am
Jahrhundertbeginn. Berliner Taschenbuch-Verlag 2004. ISBN:
3-8333-0105-8. |
|
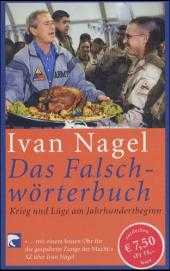
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
George W. Bushs Truppenbesuch im Irak zum Erntedankfest ("Thanksgiving
Day") am 29. November 2003 steigerte die Zahl der Parteigänger
unter den Wählern von 56% auf 61%. Die wirkungsvollste Fotografie
(d8ie die Nöte der Besatzungsarmee in einer herzerwärmenden
US-amerikanischen Familienszene auflöst) hatte einen Fehler: Der
prächtige Truthahn, den der Präsident seinen Soldaten darbrachte,
war nur zur Kantinendekoration, nicht zum Verzehr hergestellt.
In einer Reihe von Einsprüchen und Analysen versucht Ivan Nagel,
einer der gewichtigsten Kulturkritiker unserer Zeit, alte und neue
Formen des Krieges nach dem 11. September 2001 zu begreifen.
Werden sich künftig Herrschaft und Terror (die weltweite
US-Hegemonie und der Widerstand ihrer erbitterten Gegner)
ausschließen oder gegenseitig steigern? Ist eine Reihe von Kriegen
gegen die "Achse des Bösen" unvermeidlich – oder kann eine
Minderung der globalen Ungleichheit auch die Kriegsgefahr
vermindern? Ivan Nagel zeigt auf, wie der Beginn dieses
Jahrhunderts gespickt ist mit "Falschwörtern" – und wie die Lügen
der internationalen und der deutschen Politik uns eine Zukunft von
Konflikten, Aggressionen, Kriegen aufzwingen.
"Die Sprache ist so poetisch, dass Ivan Nagels Sätze zugleich
besänftigend wirken, wo sie dennoch Wut artikulieren ... Sie
weisen immer wieder darauf hin, dass enthemmte Spießigkeit im
Denken zu politischen Katastrophen führt." (Christina Weiss in
LITERATUREN über "Streitschriften")
"Ivan Nagel hat widersprochen und ist selbst ein Widerspruch,
bestechlich nur in der Liebe für die Sache, die er zu der seinen
gemacht hat. Er ist wohl der außenseiterischste Insider der
Kultur, ein Einzeldoppelgänger mit einem feinen Ohr für die
gespaltene Zunge der Macht." (Christopher Schmidt, Süddeutsche
Zeitung)
Zum Autor
Ivan Nagel, geboren 1931 in Budapest, emigrierte nach der
Verfolgung in der Nazizeit siebzehnjährig aus Ungarn. Er studierte
Philosophie, Soziologie und Germanistik in Paris, Heidelberg,
Durham und Zürich sowie ab 1953 Philosophie bei Adorno in
Frankfurt am Main. Nagel war Chefdramaturg der Münchner
Kammerspiele 1961-69, Intendant des Deutschen Schauspielhauses in
Hamburg 1971-79, Begründer und Leiter der internationalen
Festspiele "Theater der Welt" sowie Theater- und Musikkritiker.
1989-96 übte er eine Professur für "Geschichte und Ästhetik der
Darstellenden Künste" an der Hochschule der Künste in Berlin aus.
Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören "Autonomie und
Gnade - Über Mozarts Opern" (1985) und "Streitschriften"
(2001).
Verlagsinformation |
|
|
Wilfried Röhrich: Die Macht der Religionen. Glaubenskonflikte in der
Weltpolitik. C.H. Beck-Verlag 2004. ISBN: 3-406-51090-6. |
|
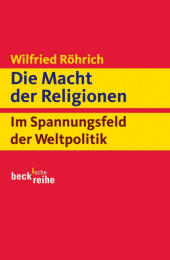
mehr Infos
bestellen
|
Die Weltreligionen haben eine Macht erlangt, die in ihrer
Tragweite der der Zeit der Kreuzzüge oder der islamischen
Expansion nahe kommt. Diese Macht nimmt in den Glaubenskonflikten
der Weltpolitik konkrete Gestalt an. Das vorliegende Buch
untersucht nicht nur den Konflikt zwischen dem Islam und dem
(amerikanischen) Christentum; neben der bekannten
Auseinandersetzung zwischen dem israelischen Judentum und dem
Islam bestehen z.B. massive Probleme zwischen dem Islam und dem
Hinduismus im Kaschmirkonflikt und der nicht weniger
grundsätzliche Streit zwischen den buddhistischen Singhalesen und
den hinduistischen Tamilen auf Sri Lanka. Das Buch bietet einen
eindrucksvollen Überblick über die religiösen Konfliktherde und
zeigt die Prämissen und Perspektiven für einen interreligiösen
Dialog auf.
Verlagsinformation |
|
|
Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie
der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Dt.
Taschenbuch-Verlag 2004 (4. Auflage). ISBN: 3-423-34084-3.
|
|
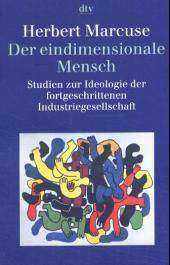
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Herbert Marcuse bezeichnet die hoch industrialisierte Gesellschaft
und den in ihr lebenden Menschen als "eindimensional", weil er
einen lückenlosen Zusammenhang von Manipulation und Konformismus
sieht, der das in sich widersprüchliche kapitalistische System
stabilisiert, die Menschen durch Konsum korrumpiert und alle
Kritik absorbiert.
Um diese Eindimensionalität aufzubrechen, eine neue, weniger
herrschaftlich strukturierte Gesellschaft zu bilden, bedarf es der
Einsicht der scheinbar Freien in ihre Unfreiheit, in ihre
Manipuliertheit durch Werbung, Ökonomie und Massenmedien. Die
scharfsichtige Studie, die erstmals 1964 erschien, hat das
kritische Bewusstsein einer ganzen Generation stark beeinflusst
und ist heute ein Standardwerk.
Verlagsinformation
Zum Autor
Herbert Marcuse, US-amerikanischer Philosoph und Soziologe dt.
Herkunft, geboren 1898 in Berlin, gestorben 1979 in Starnberg
(Bayern). Wichtigstes Werk: "Der eindimensionale Mensch" (1964);
Herbert Marcuse war der Spiritus Rector der
'68er-Studentenrevolte, weil er an eine Übersetzbarkeit der
Vernunft in Geschichte glaubte und zugleich, als Philosoph und
Soziologe, einer der führenden Köpfe der kritischen Theorie war.
1898 als Sohn einer großbürgerlichen jüdischen Familie in Berlin
geboren, studierte Marcuse nach der Schulzeit Philosophie in
Freiburg und Berlin. 1924 gehörte er mit Max Horkheimer und Erich
Fromm zu den Gründungsmitgliedern des renommierten Instituts für
Sozialforschung. Daraus ging die sog. Frankfurter Schule hervor,
zu deren prominentesten Vertretern Marcuse zählte. Marcuse verließ
Deutschland 1932. Über Genf und Paris erreichte er 1934 New York.
Zunächst Mitarbeiter am inzwischen ebenfalls in den USA ansässigen
Institute of Social Research, trat er 1942, als US-amerikanischer
Staatsbürger, in die US-Spionageabwehrbehörde (OSS) ein, in der er
die Europaabteilung übernahm. 1951 kehrte er an die Universität
zurück; 1965 erhielt er einen Lehrstuhl an der Universität von
Kalifornien und eine Honorarprofessur an der FU Berlin. Biografie:
Heinz Jansohn: "Herbert Marcuse" (1982).
Quelle: Harenberg, Das Buch der tausend Bücher |
|
|
Jochen Hörisch: Gott, Geld und Medien. Studien zur Medialität der
Welt. Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN: 3-518-12363-7. |
|
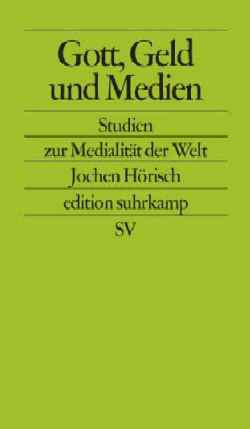
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Am 11. September 2001 wurden mit terroristischer Überdeutlichkeit
drei voneinander weit entfernt scheinende Sphären aufeinander
bezogen: Im Namen Gottes wurde das hochsymbolische Zentrum des
internationalen Geldverkehrs medientauglich in Schutt und Asche
gelegt. Gott, Geld und Medien stehen aber nicht erst seit diesem
Terrorakt in einem intimen Spannungsverhältnis zueinander. Die
Studien von Jochen Hörisch gehen der Geschichte und der
Tiefenstruktur theologischer, monetärer und medialer Grammatiken
nach und vertiefen die Analysen, die in den Bänden "Brot und Wein
– Die Poesie des Abendmahls", "Kopf oder Zahl – Die Poesie des
Geldes" und "Ende der Vorstellung – Die Poesie der Medien"
vorgestellt wurden.
Ihr Befund ist frappant: Gott, Geld und Medien stehen deshalb in
einem so scharfen Konkurrenzverhältnis zueinander, weil sie so
viele Gemeinsamkeiten haben: "Die drei leistungsstarken, weil
paradoxie-sensiblen Leitmedien Religion, Geld und Medien bzw., um
in metonymischer Verdichtung zu formulieren, Hostie, Münze und
CD-ROM sorgen für die elastischen und ineinander konvertierbaren
Integrale, die die abendländisch-christlichen bzw. westlichen
Gesellschaften und Kulturen zusammenhalten." (Jochen Hörisch,
Ausschnitt)
Zum Autor
Jochen Hörisch, geboren 1951 in Bad Oldesloe, ist Professor für
Neuere Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim.
Verlagsinformation |
|
|
Ulrike M. Meinhof: Die Würde des Menschen ist antastbar. Aufsätze und
Polemiken. Mit einem Nachwort von Klaus Wagenbach.
Wagenbach-Verlag 2004. ISBN: 3-8031-2491-3. |
|
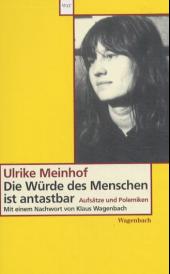
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Diese Ausgabe sammelt alle wichtigen Texte Ulrike Meinhofs aus den
Jahren 1959 bis 1969: Beispiele eines entschiedenen Journalismus,
der nicht von den Höhen der Macht skandiert, sondern den
politischen Widerspruch aufzufinden versteht. Mit Ausnahme der
Aufsätze "Provinz und klein kariert" sowie "Falsches Bewußtsein"
erschienen sie alle in der Zeitschrift KONKRET, in der Ulrike
Marie Meinhof von 1962 bis 1964 Chefredakteurin war.
Diese Auswahl von Kolumnen, Berichten, Reportagen und Polemiken,
deren Schwerpunkt auf den programmatischen Texten liegt, wurde
wenige Jahre nach ihrem Tod zusammengestellt. Die Texte sind
ungekürzt, datiert und (bis auf stillschweigende
Rechtschreibkorrekturen) unverändert. Sie lesen sich heute als ein Abriss
deutscher Nachkriegsgeschichte und ihrer Deformationen: Meinhof
analysiert die Unfähigkeit wirklicher Verarbeitung des Nazismus
und die eilige Rekonstruktion der Macht, sie beschreibt das
Verkümmern der Demokratie am Fall des Einzelnen – seine Würde wird
antastbar.
"Meinhofs Texte sind nicht akrobatisch. Sie überzeugen meist durch
ruhigen Ernst, Gründlichkeit der Überlegung und eine Sprache, in
der jedes Wort auf die Sache passt." (KONKRET)
Zur Autorin
Ulrike Marie Meinhof, 1934 in Oldenburg geboren, war von 1959 bis
1969 Mitarbeiterin der Zeitschrift KONKRET. 1970 ging sie in den
Untergrund, wurde 1972 verhaftet und starb 1976 im Gefängnis
Stuttgart-Stammheim.
Verlagsinformation |
|
|
Giorgio Agamben: Ausnahmezustand. Suhrkamp-Verlag 2004. ISBN:
3-518-12366-1. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Nach "Homo
sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben" (2002) und "Was
von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge" (2003), die
Teil 1 und Teil 3 des "Homo sacer"-Projekts von Giorgio Agamben
darstellen, liegt nun mit "Ausnahmezustand" der in sich
abgeschlossene erste Band von Teil 2 vor.
Der Ausnahmezustand, d.h. jene Suspendierung des Rechtssystems,
die wir als Provisorium zur Aufrechterhaltung der Ordnung in
Krisensituationen zu betrachten gewohnt sind, wird unter unseren
Augen zu einem gängigen Muster staatlicher Praxis, das in
steigendem Maße die Politik bestimmt. Agambens aufrüttelnde Studie
ist der erste Versuch einer bündigen Geschichte und zugleich
Fundamentalanalyse des Ausnahmezustands: Wo liegen seine
historischen Wurzeln, und welche Rolle spielt er – in seiner
Entwicklung von Hitler bis Guantánamo – in der Gegenwart?
Insofern der Ausnahmezustand zur Regel zu werden droht, sind die
Institutionen des demokratischen Rechtsstaats und das
verfassungsgemäße Gleichgewicht der Gewalten gefährdet, und die
Grenze zwischen Demokratie und Diktatur verschwimmt. In
Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Annäherungen an
das Phänomen des Ausnahmezustands – zu nennen sind in erster Linie
Walter Benjamin und Carl Schmitt, aber auch Autoren wie Theodor
Mommsen, Adolphe Nissen und Jacques Derrida – vermisst Agamben das
von den meisten Theoretikern gemiedene Niemandsland zwischen
Politik und Recht, zwischen der Rechtsordnung und dem Leben und
wirft ein neues Licht auf jene verborgene Beziehung, die das Recht
an die Gewalt bindet.
Zum Autor
Giorgio Agamben, geboren 1942, lehrt Philosophie an der
Universität Verona. Bisher auf deutsch erschienene Werke: "Bartleby
oder die Kontingenz gefolgt von Die absolute Immanenz" (1998),
"Homo
sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben" (2002), "Was
von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge" (2003), "Das
Offene. Der Mensch und das Tier" (2003), "Idee
der Prosa" (2003) und "Die
kommende Gemeinschaft" (2003).
Verlagsinformation |
|
|
Klaus Wagenbach (Hrsg.): Warum SO verlegen?: Über die Lust
an Büchern und ihre Zukunft. Herausgegeben anlässlich des
40jährigen Verlagsjubiläums. Wagenbach-Verlag 2004. ISBN:
3-8031-2487-5. |
|
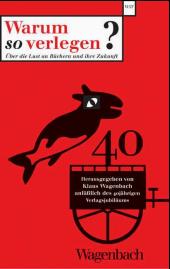
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Warum SO verlegen und nicht anders? Diese Frage versucht der
Almanach ganz praktisch zu beantworten, anhand eines nahe
liegenden Beispiels: Warum und wie überlebt ein Verlag, der Bücher
ausschließlich nach bestem Wissen und Gewissen veröffentlicht, 40
Jahre?
David packt den Stein aus, und Sie dürfen mitlachen: über
gesamtdeutsche Projekte, Träume vom Kollektiv oder den Fredenbeker
Bananenaufstand. Über Polizisten, die den Verlag stürmen, und
Staatsanwälte, die ihm den Bankrott an den Hals wünschen. Oder
mitdenken: über Geschichtsbewusstsein, Anarchie und Hedonismus.
Über Karnickel, Kollegen, Kafka. Oder über den berüchtigten SALTO
zwischen Schwarzer Kunst und Neuer Mitte. Dazwischen können Sie
lesen: die schönsten Texte aus 40 Jahren.
Zum Herausgeber
Klaus Wagenbach, geboren 1930, gründete 1964 den bis heute
unabhängigen Verlag Klaus Wagenbach. Wagenbach ist berüchtigte,
dienstälteste Witwe Kafkas, Autor und Herausgeber von Anthologien
und erhielt zahlreiche, insbesondere italienische Ehrungen.
Verlagsinformation |
|
|
Paul Nolte: Generation Reform. Jenseits der blockierten
Republik. C.H. Beck-Verlag 2004. ISBN: 3-406-51089-2. |
|
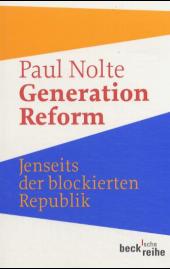
mehr Infos
bestellen |
Zum
Buch
Deutschland braucht dringend grundlegende Reformen - doch wohin
diese Reformen eigentlich führen sollen, das scheint selbst vielen
Politikern nicht recht klar zu sein. Paul Nolte analysiert die
Schieflagen und Sackgassen, in die wir in den letzten Jahr-zehnten
hineingesteuert sind, und plädiert für eine neue
Bürgergesellschaft, in der Individualismus, Initiative und
Verantwortung nicht im Gegensatz zu einer solidarischen
Gemeinschaft stehen. Seine klaren und manchmal provokativen Thesen
über die Zumutungen, die wir uns alle in diesem Reformprozess
gefallen lassen müssen, sorgen für Zündstoff in einer scheinbar
ausgelaugten Debatte. Gegen die ängstliche Verteidigung von
Besitzständen ebenso wie gegen die Leichtigkeit der
Spaßgesellschaft artikuliert sich hier die wache intellektuelle
Stimme einer "Generation Reform".
Zum Autor
Paul Nolte, geboren 1963, studierte Geschichtswissenschaft und
Soziologie in Düsseldorf, Bielefeld und Baltimore. 1993/94 war er
Fellow an der Harvard University, 1998/99 am Wissenschaftskolleg
zu Berlin. Seit 2001 ist er Professor für Geschichte an der
International University Bremen. Er lehrt und forscht im Bereich
der Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte vor allem Deutschlands
und der USA seit dem 18. Jahrhundert. Seine politischen und
sozialkritischen Essays haben in den letzten Jahren breite
Aufmerksamkeit in Öffentlichkeit und Politik gefunden. Von ihm
liegt bei C.H. Beck vor: "Die
Ordnung der deutschen Gesellschaft" (2000).
Verlagsinformation |
|
|
Jacques Derrida/Hans-Georg Gadamer: Der ununterbrochene Dialog.
Herausgegeben und Nachwort von Martin Gessmann. Suhrkamp-Verlag 2004.
ISBN: 3-518-12357-2. |
|
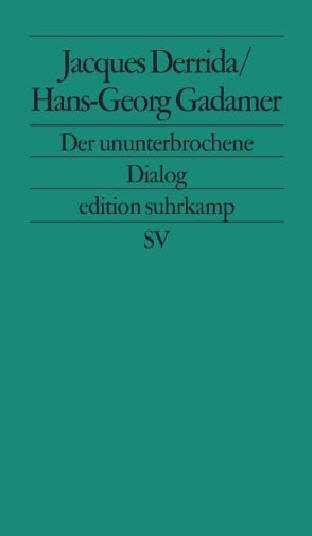
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Jacques Derrida und Hans-Georg Gadamer lernten sich in den frühen
80er Jahren kennen, und seit dieser Zeit entspann sich eine
kontroverse Auseinandersetzung über die Hermeneutik, die Kunst der
Interpretation, insbesondere über die Endlichkeit unseres
Verstehens. Als Gadamer starb, hielt Derrida im Februar 2003 die
Festrede zur Gedenkfeier der Universität Heidelberg. Mit einer
eindringlichen Celanlektüre führt Derrida vor, wie das Gespräch
mit Gadamer über seine letzte Unterbrechung hinaus am Ende zu
einem "ununterbrochenen Dialog" werden könnte. Dem Band beigefügt
sind Kommentare Gadamers zu Celans Gedichtfolge "Atemkristall"
sowie Materialien aus der Zeit der ersten Begegnung. In Derridas
Reflexion über den Abschied und das Abschiednehmen kommt es hier
zu einer letzten, vielleicht entscheidenden Annäherung.
"Damals schon hatte ich eine Vorahnung: Was Gadamer wahrscheinlich
einen 'inneren Dialog' genannt hätte, sollte in jedem von uns
weitergeführt werden, manchmal wortlos, unmittelbar in uns oder
indirekt." (Jacques Derrida, Ausschnitt)
Zu den Autoren
Jacques Derrida, 1930 in El-Biar/Algerien
geboren, ist Professor emeritus für
Philosophiegeschichte an der École
des Hautes Etudes en Sciences Sociales in
Paris. In deutscher Übersetzung erschienen u.a.: "Grammatologie"
(1983/2000/2003),
"Gesetzeskraft"
(1991/1996), "Jacques
Derrida. Ein Porträt" (1994/2001, zusammen mit Geoffrey
Bennington), "Politik
der Freundschaft" (2000/2002), "Die
unbedingte Universität" (2001), "Seelenstände
der Psychoanalyse" (2002), "Marx'
Gespenster" (2004).
Hans-Georg Gadamer (1900-2002) war Professor für Philosophie an
der Universität Heidelberg.
Verlagsinformation |
|
|