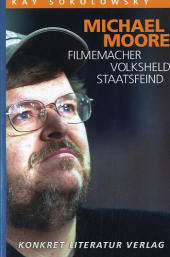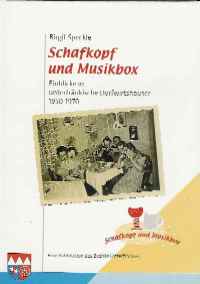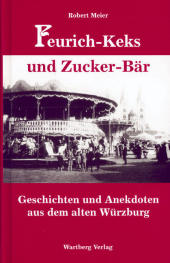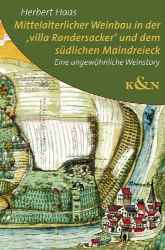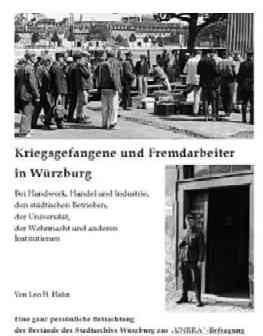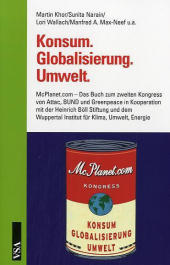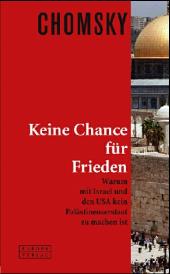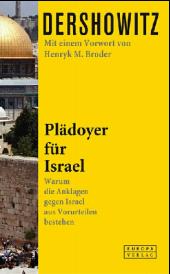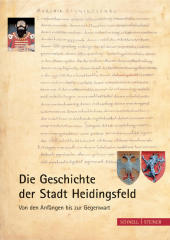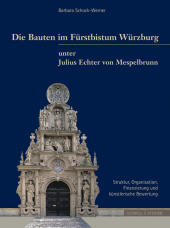|
30.
November 2005 |
|
|
|
Cornelia Boese: Boese Träume.
Mit Radierungen von Dorette Riedel. Buchverlag Peter Hellmund,
Würzburg 2005. ISBN: 3-9808253-7-X. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Um prüfungspanische Pennäler / und Riemenschneiders Rechenfehler /
um Harry Potter in Gemünden, / Herrn Ingo Klünders Gastspielsünden
/ und Wagners Würzburg-Blitzbesuch / geht's in dem neuen Boesen
Buch / das 19 Menschen dieser Stadt / als Hauptpersonen intus hat:
/ Die Frau OB, der Intendant / bis hin zum Mann vom Bratwurststand
/ erzählen hier verschiednerlei / Berufsgeschichten – eines sei /
doch wahrheitshalber eingeräumt / Sie haben alles nur geträumt
...!
Aus den Erzählungen geträumter Schreckgeschichten entstand die
Idee zu diesem Buch, für das Cornelia Boese ausgewählte Würzburger
nach ihren berufsbezogenen Alpträumen befragte. Neunzehn
Stadtbekannte verrieten ihre witzig-skurrilen nächtlichen
Erlebnisse. Cornelia Boese hat sie in Reime gefasst.
Zur Autorin
Aus Würzburg stammt Cornelia Boese / die Künstlerin war als
Souffleuse / dort am Theater engagiert / hat Sprachen und Musik
studiert / und ist Autorin von diversen / Gedichtbändchen in
heitren Versen. / In ihrem ersten Werk, dem Roten / schreibt sie
Theateranekdoten / aus ihrer Sicht der Unterwelt / der blaue
Mozart-Band enthält / Kuriositäten Amadés /
das gelbe Buch ist mit
Portraits / von Würzburgs Künstlern angefüllt /
und schwarz und viertens wird
enthüllt / was Stadtbekannte im Geheimen / so träumen – stets
in lust'gen Reimen. / In ihren Flüsterjahren war / Souffleuse
Boese unsichtbar / kehrt nun jedoch ans Licht zurück / und wagt
als Dichterin ihr Glück.
Verlagsinformation |
|
|
WürzBuch. Der Würzburger
Autorenkreis stellt sich vor.
Von Hans-Jürgen Beck, Cornelia Boese, Raimund Chitwood u. a.
Mankau-Verlag 2005. ISBN: 3-938396-00-8. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Das "WürzBuch" ist die erste gemeinsame Anthologie, mit der sich
der Autorenkreis Würzburg dem Leser vorstellt. Heiteres und
Besinnliches in Form von Gedichten und Erzählungen finden sich in
diesem einmaligen Werk genauso wie Romanausschnitte und lyrische
Prosa. Die thematische Vielfalt ist Konzept. So entsteht ein mehr
oder weniger zufälliges Beziehungsgeflecht, das ein breites
Spektrum der schriftstellerischen Aktivitäten der Region
dokumentiert.
Mit dabei sind Roman Rausch, Autor der preisgekrönten
Kilian-Trilogie, dessen viertes Buch soeben unter dem Titel "Der
Gesang der Hölle" erschienen ist; Günther Huth, der seit 1975 über
40 Bücher veröffentlicht hat, zuletzt "Der Schoppenfetzer" und das
"Riesling-Attentat"; Uwe Dolata, Bestseller-Autor von "Stationen
einer Wiedergeburt - Sucht als Chance", der mit seinem neuesten
Buch "Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland" Furore machte;
Dr. Gunter Schunk, Mitübersetzer der Reihe "Asterix uff
meefränggisch"; Reiner Greubel, der mit "Ihr Kunstbanausen!" seine
Ringbuchreihe eröffnete; die satirisch, aber nicht bissig reimende
Souffleuse Cornelia Boese; aber auch der Filmemacher Christian
Kelle, Würzburgs "Stadtschreiber" Sandra Maus und Hans-Jürgen
Beck, die Dadaistin Anna Cron sowie Barbara Wolf, Raimund Chitwood
und Klaus Fischer.
Verlagsinformation |
|
|
Kay Sokolowsky: Michael
Moore. Filmemacher – Volksheld – Staatsfeind.
Konkret-Literatur-Verlag 2005. ISBN: 3-89458-238-3.
|
|
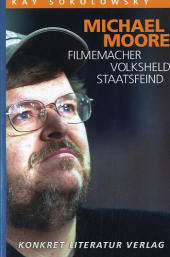
mehr
Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Er hat drei der erfolgreichsten Dokumentarfilme aller Zeiten
gedreht- Seine Bücher erreichen Millionenauflagen. Bei den
US-Präsidentschaftswahlen 2004 galt er vielen als der eigentliche
Herausforderer von George W. Bush. Michael Moore ist zweifellos
der berühmteste und einflussreichste linke Entertainer unserer
Zeit. Doch wie er dazu wurde, wissen die wenigsten. Statt dessen
kursieren die abenteuerlichsten Legenden über den streitbaren Mann
aus Flint in Michigan.
Dieses Buch ist die erste kritische Bestandsaufnahme von Leben und
Werk Michael Moores. Es zeichnet seine beispiellose Karriere nach,
analysiert seine Filme und Bücher und untersucht die Gründe für
seine phänomenale Popularität. Doch trotz der unverhohlenen
Sympathie des Autors für Moore werden die weniger erfreulichen
Seiten dieses neuen Helden der Linken nicht unterschlagen.
Kay Sokolowsky lässt Verehrer und Freunde ebenso wie Kritiker und
Feinde zu Wort kommen. So entsteht das vielschichtige Porträt
eines Mannes, der niemanden kalt lässt – im Guten wie im Bösen.
Zum Autor
Kay Sokolowsky, geboren 1963, studierte Germanistik, Geschichte
und Philosophie. Er lebt und arbeitet als freier Journalist (u.a.
für agenda, junge Welt, Jungle World, konkret) und Schriftsteller
in Hamburg. Letzte Buchveröffentlichung: "Late
Night Solo – Die Methode Harald Schmidt" (2004).
Verlagsinformation |
|
|
23.
November 2005 |
|
|
|
Birgit Speckle: Schafkopf und
Musikbox.
Einblicke in unterfränkische Dorfwirtshäuser 1950-1970. Verlag:
Bezirk Unterfranken 2005. ISBN: 3-9809330-0-8. |
|
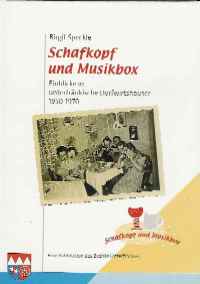
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Im Dorfwirtshaus der 1950er/1960er Jahre herrschte reges Treiben:
Am Sonntagnachmittag füllten die Schafkopf-Runden die ganze
Wirtsstube. Im Wirtshaus saß man nicht nur gemütlich zusammen,
sondern hier wurden Geschäfte gemacht, Aufträge vergeben und
politische Debatten geführt, aber auch Vorträge und
Lehrveranstaltungen abgehalten. Viele Wirtshäuser hatten im
Obergeschoss auch einen Tanzsaal, der als Vorläufer der Mehrzweck-
und Sporthalle bezeichnet werden kann. Hier machte das Wanderkino
Station und hier wurden sämtliche Vereinsfeiern abgehalten.
Gesellschaftliches Großereignis aber war die alljährliche
Kirchweih.
Das Dorfwirtshaus stand häufig auch für Innovationen. Die
Wirtsleute hatten Geräte angeschafft, die sich noch nicht
jedermann im heimischen Haushalt leisten konnte, nämlich Telefon
und Fernseher. Darüber hinaus galten in einer Zeit ohne
Diskotheken oder Spielhallen auch Musikbox, Geldspiel- oder
Unterhaltungsautomaten als echte Attraktionen. Dorfwirtshäuser
waren in den 1950er/1960er Jahren für alle gesellschaftlichen
Schichten und für Jung und Alt der Treffpunkt schlechthin.
Die goldene Zeit der Dorfwirtshäuser ist seit etwa den 1970er
Jahren vorbei und damit auch ihre Funktion als wichtiger Teil
öffentlicher Dorfkultur. Für den Niedergang der Dorfwirtshäuser
gibt es mehrere Gründe: Der Fernseher, den sich in den 1970er
Jahren bald jedermann leisten konnte, förderte den Rückzug ins
heimische Wohnzimmer. Die nach und nach entstehenden Vereinsheime,
Bürgerzentren, Pfarrheime und die aufkommende Mode, viele Feste in
den privaten Bereich zu verlagern, etwa in Form der
"Keller-Partys" an der Hausbar, waren und sind eine ernste
Konkurrenz für die Dorfwirtshäuser.
Darüber hinaus ermöglichte das Auto mehr Mobilität. Das Auto
eröffnete etwa ab den 1970er Jahren auch weiter entfernt liegende
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, für Jugendliche insbesondere
Diskotheken. Damit verlor der Tanzsaal im Dorfwirtshaus nach und
nach seine zentrale Bedeutung. Dazu kamen ausländische
Spiellokale, die einen neuen, exotischen Reiz hatten. Dazu
gehörten Betriebe, in denen zunächst italienische, später auch
griechische und asiatische Spezialitäten angeboten wurden.
Rezension
"Die Beat- und Rockjahre haben leider keinen nachlesbaren Eindruck
in dieser Geschichte der unterfränkischen Dorfwirtshäuser
gefunden, der Band bleibt auch eher im zeitlichen Bereich 1950 bis
Anfang der 60er Jahre, zwischen Schlager, Rock’n’Roll und Twist.
Dafür entschädigt aber eine umfangreiche weiterführende
Literaturangabe zur ländlichen Gasthaus-, Freizeit- und
Jugendkultur, die zur Selbstvertiefung in dieses Thema und in
diese Kultur auffordert. Beim Lesen entwickelt sich neben dem
Hochkommen eigener Jugenderinnerungen an verbrachte Gasthauszeiten
auch die große Lust auf eine Radtour durchs fränkische Land mit
dem Erkundungsmotto 'Kirchen von außen, Wirtschaften von innen'.
Das ca. 70 Seiten umfassende und gut bebilderte Bändchen liefert
den Stoff dazu und das auf eine äußerst kurzweilige Weise." (Pro-Regio-Online,
RegioLine)
Verlagsinformation
|
|
|
Robert Meier: Feurich-Keks und
Zucker-Bär.
Geschichten und Anekdoten aus dem alten Würzburg. Wartberg-Verlag
2005. ISBN: 3-8313-1603-1. |
|
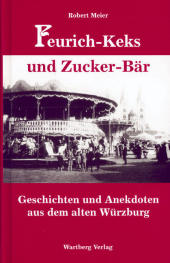
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der Verfasser, dem keine Wengertsarbeit fremd, schildert den
mittelalterlichen Weinbau des südlichen Maindreiecks im
Allgemeinen und die damit verbundenen Randersackerer Begebenheiten
im Besonderen. Der spannende Krimi über die wechselvollen 800
Jahre fränkischen Weinbaues geht von den Anfängen in der Zeit
Karls des Großen bis zur maximalen Ausdehnung der Rebfläche auf
etwa 40.000 Hektar im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, der
Ära Julius Echters von Mespelbrunn.
Die Häcker entblößen sich ihres Grundbesitzes, verarmen und
mutieren vom Eigentümer zum notleidenden Lehensnehmer, das
Weinproletariat entsteht. Eine beginnende, lange währende
Kaltzeit, die den hochgeschätzten Frankenwein zum "Sauerländer"
stigmatisiert, beendet die weitere Verbreitung der Vitis vinifera
und läutet den 400 Jahre währenden Niedergang ein. Rückschlüsse
auf das 20. Jahrhundert und aktuelle Bezüge zur Gegenwart ergänzen
die unterhaltsame, farbige Schilderung der außergewöhnlichen
Wein-Gezeiten.
Aus dem Inhalt
- Die Wanderjahre der Weinrebe und ihre Einbürgerung in
mainfränkischen Gefilden
- Vom Wingarton zum Winperch: Die Rebe klettert den Berg hinauf.
Zeitgleiche Beurkundung von Würzburger und Randersackerer
Weinlagen ab 1050
- Der Weinmotor Randersacker springt an, läuft und läuft ... Wein,
der hochoktanige Kraftstoff zur zügigen Dorfentwicklung
- Die Weinbergsarbeit, ein unaufhörlicher Kampf gegen Unkraut und
Schädlinge. Das Ende der Vielfalt im Lebensraum Weingarten
- Die Häufung der herrschaftlichen Erlasse im 14. Jhd. Randesacker
anno 1350 mit eigener Zehnt- und Leseordnung
- Der mittelalterliche Qualitätsweinbau, Rebsorten, Realteilung
und Kopferziehung
- Klöster saugen den Grundbesitz auf. Die Häcker verarmen.
Würzburger plündern den Randersackerer Edelhof
- Die Rebe als Baum der Erkenntnis? Der Tausendsassa Wein,
wichtigste Arzney des Mittelalters
- Der Bauernkrieg, der Augsburger Religionsfriede und die
Zweiteilung Randersackers
- Die Ära Julius Echter von Mespelbrunn. Wer nicht kommunizieren
kommt, muss gehen
- Franken mit 40.000 Hektar größtes deutsches Weinland. Erblühende
dörfliche Baukultur im 16. Jhd.
- Die 300-jährige Kaltzeit beginnt, mit dem Weinbau geht's bergab.
Der Wein ist stocksauer.
- Quellen und Literaturverzeichnis
Verlagsinformation
|
|
|
Herbert Haas: Mittelalterlicher
Weinanbau in der 'villa Randersacker' und dem südlichen
Maindreieck. Eine ungewöhnliche Weinstory. Verlag Königshausen
& Neumann 2005. ISBN: 3-8260-3169-5. |
|
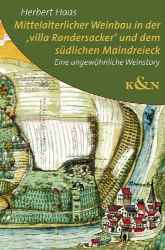
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Der Verfasser, dem keine Wengertsarbeit fremd, schildert den
mittelalterlichen Weinbau des südlichen Maindreiecks im
Allgemeinen und die damit verbundenen Randersackerer Begebenheiten
im Besonderen. Der spannende Krimi über die wechselvollen 800
Jahre fränkischen Weinbaues geht von den Anfängen in der Zeit
Karls des Großen bis zur maximalen Ausdehnung der Rebfläche auf
etwa 40.000 Hektar im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, der
Ära Julius Echters von Mespelbrunn.
Die Häcker entblößen sich ihres Grundbesitzes, verarmen und
mutieren vom Eigentümer zum notleidenden Lehensnehmer, das
Weinproletariat entsteht. Eine beginnende, lange währende
Kaltzeit, die den hochgeschätzten Frankenwein zum "Sauerländer"
stigmatisiert, beendet die weitere Verbreitung der Vitis vinifera
und läutet den 400 Jahre währenden Niedergang ein. Rückschlüsse
auf das 20. Jahrhundert und aktuelle Bezüge zur Gegenwart ergänzen
die unterhaltsame, farbige Schilderung der außergewöhnlichen
Wein-Gezeiten.
Aus dem Inhalt
- Die Wanderjahre der Weinrebe und ihre Einbürgerung in
mainfränkischen Gefilden
- Vom Wingarton zum Winperch: Die Rebe klettert den Berg hinauf.
Zeitgleiche Beurkundung von Würzburger und Randersackerer
Weinlagen ab 1050
- Der Weinmotor Randersacker springt an, läuft und läuft ... Wein,
der hochoktanige Kraftstoff zur zügigen Dorfentwicklung
- Die Weinbergsarbeit, ein unaufhörlicher Kampf gegen Unkraut und
Schädlinge. Das Ende der Vielfalt im Lebensraum Weingarten
- Die Häufung der herrschaftlichen Erlasse im 14. Jhd. Randesacker
anno 1350 mit eigener Zehnt- und Leseordnung
- Der mittelalterliche Qualitätsweinbau, Rebsorten, Realteilung
und Kopferziehung
- Klöster saugen den Grundbesitz auf. Die Häcker verarmen.
Würzburger plündern den Randersackerer Edelhof
- Die Rebe als Baum der Erkenntnis? Der Tausendsassa Wein,
wichtigste Arzney des Mittelalters
- Der Bauernkrieg, der Augsburger Religionsfriede und die
Zweiteilung Randersackers
- Die Ära Julius Echter von Mespelbrunn. Wer nicht kommunizieren
kommt, muss gehen
- Franken mit 40.000 Hektar größtes deutsches Weinland. Erblühende
dörfliche Baukultur im 16. Jhd.
- Die 300-jährige Kaltzeit beginnt, mit dem Weinbau geht's bergab.
Der Wein ist stocksauer.
- Quellen und Literaturverzeichnis
Verlagsinformation
|
|
|
Leo H. Hahn: Kriegsgefangene und
Fremdarbeiter in Würzburg. Bei Handwerk, Handel und Industrie,
bei städtischen Betrieben, der Universität, der Wehrmacht und
anderen Institutionen. Eigenverlag, Dezember 2005. ISBN:
3-00-017731-0. |
|
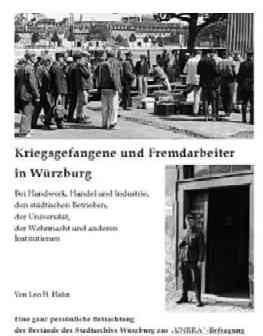
|
Aus dem Inhalt
Ohne Zwangsarbeiter lief in Würzburg nichts: Im Zweiten Weltkrieg
waren in Würzburg ständig zwischen 6.000 und 9.000 Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter beschäftigt. Nach jahrelanger Arbeit hat Leo H.
Hahn nun ein bemerkenswertes, reich bebildertes Buch über jene
Menschen vorgelegt, ohne die das Wirtschaftsleben in der Domstadt
zusammengebrochen wäre. Der Band mit 33 bisher unveröffentlichten
Fotos trägt den Titel "Kriegsgefangene und Fremdarbeiter in
Würzburg. Bei Handwerk, Handel und Industrie, bei städtischen
Betrieben, der Universität, der Wehrmacht und anderen
Institutionen."
Rezension
Ohne Zwangsarbeiter lief in Würzburg nichts
(Main Post, 07.12.2005)
Zum Autor
Leo H. Hahn, 1933 geboren, erlebte das "Dritte Reich" als Kind
mit. Er war über 30 Jahre lang als technischer Angestellter bei
der MAIN-POST tätig. 1995 legte er "Streiflichter zur Geschichte
der Zellerau und der Stadt Würzburg" vor.
Verlagsinformation
Exemplare
des Buchs können für 15,90 Euro über den
Buchladen Neuer Weg
bestellt werden.
Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com
|
|
|
15.
November 2005 |
|
|
|
Martin Khor/Sunita Narrain/Lori
Wallach/Manfred Max-Neef u.a.: Konsum. Globalisierung. Umwelt.
Mc Planet.com – Das Buch zum zweiten Kongress von Attac, BUND und
Greenpeace. Herausgegeben von Marc Engelhardt und Markus
Steigenberger. VSA-Verlag 2005. ISBN: 3-89965-136-7. |
|
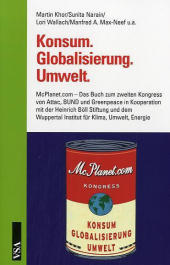
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die Fortsetzung der erfolgreichen Plattform McPlanet.com spannt
das Drahtseil zwischen der (Konsum-)Verantwortung der Einzelnen,
der Macht der Konzerne und den scheinbaren Grenzen der Politik.
Wie hängen Umweltzerstörung und Globalisierung zusammen? Und was
habe ich damit zu tun? Kann ich so leben, wie ich will – und
reicht es, meinen Müll zu trennen? Wie viel kann ich überhaupt
verändern angesichts von Konzernmacht und politischen Blockaden?
Oder steckt der Fehler bereits im System? Was geht verloren in der
globalen Wirtschaftslogik? Was sind die Alternativen und was kann
ich dafür tun?
Der erste Kongress McPlanet.com im Sommer 2003 hat in Berlin mehr
als 1.600 TeilnehmerInnen unter dem Motto "Die Umwelt in der
Globalisierungsfalle" in Debatten um Globalisierungskritik und
Ökologie verwickelt. Die Dokumentation des zweiten Kongresses, der
Anfang Juni 2005 in Hamburg stattgefunden hat, geht diesen Weg
weiter und stellt die Frage nach zukunftsfähigen Lebensstilen in
einer globalisierten Welt.
Aus dem Inhalt
- Der Planet, die globale Konsumentenklasse und ich
- Grenzen des globalen Handels: Ist Lokalisierung die Alternative?
- Zwischen Trittbrett und Verantwortung: Was tun, wenn das Klima
ins Schwitzen kommt?
- Was wäre, wenn alle Chinesen...?
- Gerechtigkeit auf einem begrenzten Planeten
- Vom Konsum zum Handeln
Zu den AutorInnen
Wolfgang Sachs (Wuppertal Institut), Martin Khor (Third World
Network, Malaysia), Jürgen Matthes (Institut der Deutschen
Wirtschaft, Köln), Philipp Hersel (Attac), Ailun Yang (Greenpeace,
China), Oliver Weinmann (Vattenfall), Michael Renner (Worldwatch
Institute), Sara Larrain (Sustainable South Cone Program, Chile),
Meena Raman (BUND/Friends of the Earth International), Manfred
Max-Neef (Center for Development Alternatives, Chile), Barbara
Unmüßig (Heinrich-Böll-Stiftung), Lori Wallach (Public Citizen’s
Watch, USA), Oliver Moldenhauer (Attac), Andy Bichlbaum (Yes-Man),
Sunita Narrain (Centre for Science and Environment, Indien) u.a.
Verlagsinformation |
| |
|
Noam Chomsky: Keine Chance für
Frieden.
Warum mit Israel und den USA kein Palästinenserstaat zu machen
ist. Europa-Verlag, Hamburg 2005. ISBN: 3-203-76005-3. |
|
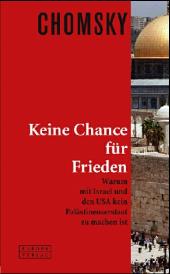
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Israel und die Palästinenser – zwar beherrscht kaum ein Konflikt
die Medien seit Jahren wie dieser, jedoch wird er dabei für
Außenstehende nicht unbedingt verständlicher. Laut Noam Chomsky
ist der Nahostkonflikt ein Thema, das sich bereits Jahre im Voraus
als Vortragsthema anbieten lässt, ohne dass man jemals Gefahr
liefe, inaktuell zu sein. Scheinbar eine Konfrontation ohne Ende.
Aber warum ist das so? "Keine Chance für Frieden" versammelt Noam
Chomskys wichtigste Gedanken zu diesem verstörenden und
kontroversen Thema und zeigt, wie US-amerikanische und israelische
Interessen einen Frieden mit den Palästinensern verhindert haben
und auch in Zukunft verhindern werden.
Bereits vor über zwei Jahrzehnten befasste sich Chomsky mit dem
schon damals lange schwelenden Konflikt. Der erste Teil von "Keine
Chance" für Frieden enthält einige Kapitel dieser
Auseinandersetzung mit den innen- und außenpolitischen
Entwicklungen in den USA und Israel, die zu einer verschworenen
Gemeinschaft geführt haben. Chomsky zeigt die strategischen
Interessen der USA im Nahen Osten, die grundsätzliche Einigkeit
der beiden großen israelischen Parteien über den Umgang mit den
Palästinensern, und er diskutiert das Problem der israelischen
Atomwaffen.
Der zweite Teil zeigt die Bedeutung des Nahostkonflikts und der
israelischen Siedlungspolitik in den strategischen Erwägungen des
Kalten Krieges. Ohne anti-israelische Polemik zu betreiben oder
autoritäre Strukturen im arabischen Raum in Schutz zu nehmen,
steht Chomsky ganz auf der Seite der Palästinenser und ihrem Ruf
nach einem selbst bestimmten Leben im eigenen Staat. Auch werfen
seine weitsichtigen Analysen ein neues Licht auf den zweiten
Irakkrieg, der zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift noch nicht
abzusehen war.
Rezension
"'Keine Chance für Frieden' versammelt Noam Chomskys wichtigste
Gedanken zu diesem verstörenden und kontroversen Thema [der
Nahostkonflikt] und zeigt, wie amerikanische und israelische
Interessen einen Frieden mit den Palästinensern verhindert haben
und auch in Zukunft verhindern werden." (3sat/Bookmark)
Zum Autor
Noam Chomsky, geboren am 7. Dezember 1928, ist
seit 1961 als Professor am Massachusetts Institute of Technology,
MIT, tätig; seine Bücher über Linguistik, Philosophie und Politik
erschienen in allen wichtigen Sprachen der Erde. Noam Chomsky hat
seit den sechziger Jahren unsere Vorstellungen über Sprache und
Denken revolutioniert. Zugleich ist er einer der schärfsten
Kritiker der gegenwärtigen Weltordnung und des US-Imperialismus.
Verlagsinformation
Rezensionen
-
Zwischen Polemik und Propaganda (Frankfurter Rundschau,
16.11.2005)
-
FR: "klar wie schlüssig" / FAZ: "Polit-Gelabere"
(Perlentaucher, 05.09. + 16.11.2005)
-
Nahost: Begründete Hoffnung auf Frieden? (Neues Deutschland,
14.05.2005)
-
Steht am Ende nur Armageddon? (Das Parlament Nr. 15/2005 vom
11.04.2005) |
| |
|
Alan M. Dershowitz: Plädoyer
für Israel.
Warum die Anklagen gegen Israel aus Vorurteilen bestehen. Mit
einem Vorwort von Henryk M. Broder. Europa-Verlag, Hamburg 2005.
ISBN: 3-203-76026-6. |
|
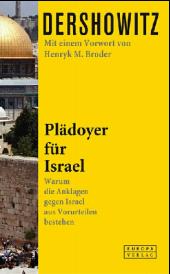
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Alan Dershowitz hat genug vom Mainstream gerade opportuner
Meinungen und den bedingungslosen Frieden predigenden Gutmenschen.
"Plädoyer für Israel" ist ein parteiisches und streitbares Buch
für den jüdischen Staat und die einzige Demokratie im Nahen Osten.
In seiner Verteidigungsschrift geht Dershowitz mit all jenen ins
Gericht, die glauben, Israel an anderen moralischen Maßstäben
messen zu müssen als bombende und Zivilisten tötende
Palästinenser. Er benennt die ungerechten Ankläger, stellt ihre
Thesen dar, diskutiert sie und stellt Ihnen seine Wirklichkeit
gegenüber. 32 der häufigsten Vorurteile hat Dershowitz gesammelt
und widerlegt sie in diesem Buch, das in den USA zum Bestseller
avanciert ist.
Besonders im Kontrast zu den Thesen Noam Chomskys entfaltet
Dershowitz' Plädoyer seine ganze radikale Kraft: Es ist in vielen
Punkten die Gegenposition zu Chomskys Visionen zum Krisenherd
Nahost. Wer über Israel diskutiert, sollte Dershowitz' Thesen
kennen – aber auch die seiner Gegner: Zeitgleich mit "Plädoyer für
Israel" veröffentlicht der Europa Verlag daher Noam Chomskys
Thesen für die Rechte der Palästinenser in diesem ewig schwelenden
Konflikt in "Keine Chance für
Frieden".
Henryk M. Broder in seinem Vorwort: "Die Beschäftigung mit dem
Nahostkonflikt weist obsessiv-pathologische Züge auf. Kein anderer
Konflikt beschäftigt die Welt so lange, so nachhaltig, so
lustvoll. Es ist eine Provinzposse, die auf einer Riesenbühne
gespielt wird."
Zu den Autoren
Alan M. Dershowitz wurde 1938 in Brooklyn, New
York geboren. Er ist Anwalt, Stafverteidiger und Professor an der
Harvard Law School. Dershowitz verteidigt in Strafverfahren
prominente Angeklagte, aber auch Anwaltskollegen und arbeitet für
die Hälfte seiner Mandanten auf einer Pro-Bono-Basis. Er war
Berater mehrerer Rechts-Kommissionen für US-Präsidenten und hat
für seinen Kampf für Bürger- und Menschenrechte zahlreiche
Auszeichnungen, Ehrenmitgliedschaften und Preise erhalten. Er ist
ein charismatischer Redner, international gefeiert, und hat in
dieser Eigenschaft die ganze Welt bereist. Zahlreiche
Veröffentlichungen zu juristischen und Menschenrechtsthemen, wie
u.a. "The Vanishing American Jew" und "Sexual McCarthyism:
Clinton, Starr, and the Emerging Constitutional Chrisis". Er lebt
in Cambridge, Massachusetts.
Henryk M. Broder wurde 1946 in Kattowitz/Katowice, Polen, geboren.
Er schreibt für den SPIEGEL und für SPIEGEL ONLINE. Broder lebt in
Berlin und Jerusalem, seine Internetseite findet sich unter
www.henryk-broder.com .
Verlagsinformation
Rezensionen
-
Zwischen Polemik und Propaganda (Frankfurter Rundschau,
16.11.2005)
-
FR: "geradezu empört" / FAZ: "insgesamt zufrieden"
(Perlentaucher, 05.09. + 16.11.2005)
-
Dershowitz: "Israel ist der Jude unter den Nationen"
(Deutschlandradio Kultur, 17.07.2005)
-
Reinigungskraft für vergiftete Atmosphäre (DIE WELT,
04.06.2005)
-
Der doppelte Standard (FREITAG Nr. 22/2005 vom 03.06.2005)
-
Steht am Ende nur Armageddon? (Das Parlament Nr. 15/2005 vom
11.04.2005) |
| |
|
8.
November 2005 |
|
|
|
Günter Huth: Der Schoppenfetzer
und das Riesling-Attentat.
Die skurrilen Kriminalfälle des Würzburger Weingenießers Erich
Rottmann. Peter-Hellmund-Verlag 2005. ISBN: 3-9808253-8-8. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Während einer Feier im alten Justizgebäude entdeckt Erich Rottmann
die Leiche eines Würzburger Stadtrats – und steht dadurch
plötzlich selbst unter Mordverdacht. Bei seinen Ermittlungen, die
ihn und seinen vierbeinigen Begleiter Öchsle auf die Spur
wirtschaftskrimineller Machenschaften in der Stadt und zugleich
auch in die unheilvolle deutsche Vergangenheit führen, gerät der
pensionierte Kriminalhauptkommissar in Lebensgefahr.
Zum Autor
Günter Huth wurde 1949 in Würzburg geboren und
lebt seitdem in seiner Geburtsstadt. Er kann sich nicht
vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben. Von Beruf ist er
Rechtspfleger (Fachjurist). Günter Huth ist verheiratet und hat
drei Kinder. Seit 1975 schreibt er in erster Linie Kinder- und
Jugendbücher sowie Sachbücher aus dem Hunde- und Jagdbereich (rund
40 Stück). Außerdem veröffentlichter er zahlreiche
Kurzerzählungen. In den letzten Jahren hat sich Günter Huth
vermehrt dem Genre Krimi zugewandt und in diesem Zusammenhang
bereits einige Kriminalerzählungen veröffentlicht. 2003 kam ihm
die Idee für einen Würzburger Regionalkrimi. Der Autor ist
Mitglied der Kriminalschriftstellervereinigung "Das Syndikat".
Verlagsinformation |
|
|
Rainer Leng (Hrsg.): Geschichte der
Stadt Heidingsfeld.
Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 100 SW- u. 32 Farbtafeln.
Schnell & Steiner-Verlag 2005. ISBN: 3-7954-1629-9. |
|
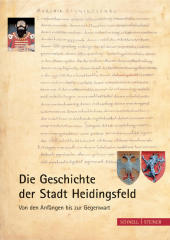
mehr Infos
bestellen
|
Erstmals wird die reiche Geschichte der Stadt Heidingsfeld
anschaulich in einem umfassend illustrierten Band dargeboten. Von
den ältesten Siedlungsspuren bis zum nicht immer spannungsfreien
Verhältnis zur nahen Bischofsstadt Würzburg in der Neuzeit reicht
der Bogen dieser fundierten Stadtgeschichte.
Mit der ersten urkundlichen Erwähnung in einer althochdeutschen
Markbeschreibung von 779 ist Heidingsfeld nur wenige Jahre jünger
als das nahe gelegene Würzburg. Zug um Zug wurde die städtische
Autonomie im Laufe des Mittelalters ausgebaut. Die Grafen von
Rothenburg und Hohenlohe sowie die staufischen Könige und Kaiser
versuchten die Stadt als Herrschaftssitz zu nutzen. So entstand
eine enge Verbindung zur Reichsgeschichte. Zuletzt verlieh der
böhmische König Wenzel 1367 ein Privileg, das Heidingsfeld auf den
besten Weg zur freien Reichsstadt brachte.
Die Bischöfe von Würzburg waren dagegen über zwei Jahrhunderte
bestrebt, die Gemeinde auf dem Weg der Pfandschaft in das
Territorium des Hochstifts zu integrieren. Dies gelang erst in der
frühen Neuzeit. Doch auch dann konnte die Stadt immer wieder
eigene Wege gehen. Ein Rathaus, das Stadtwappen mit Reichadler und
böhmischem Löwen und ein noch heute fast vollständiger Mauerring
künden vom Bewusstsein der Heidingsfelder Bürger für die
Sonderstellung ihrer Stadt selbst unter bischöflicher Herrschaft.
Erst 1930 erlosch die Selbständigkeit mit der Eingliederung nach
Würzburg. Dem historischen Wandel von Herrschaft, Politik und
Verwaltung ist ein umfangreicher Teil der Publikation gewidmet.
Zahlreiche Historiker, Volkskundler und Kunsthistoriker widmen
sich in weiteren Abschnitten den Themen - Heidingsfeld in Kriegs-
und Nachkriegszeit - Handel und Verkehr - Die
Religionsgemeinschaften: Katholiken, Protestanten und die Jüdische
Gemeinde - Schulwesen - Architektur in Sakral- und Profanbauten -
Kunstgeschichte und Künstlergeschichte - Brauchtum und
Wallfahrtswesen. Initiator der Veröffentlichung ist die
Bürgervereinigung Heidingsfeld.
Verlagsinformation |
|
|
Barbara Schock-Werner: Die
Bauten im Fürstbistum Würzburg unter Julius Echter von Mespelbrunn
(1573-1617).
Struktur, Organisation, Finanzierung und künstlerische Bewertung.
Habilitations-Schriften. Mit 96 Farb- und 118 SW-Abbildungen.
Schnell & Steiner-Verlag 2005. ISBN: 3-7954-1623-X. |
|
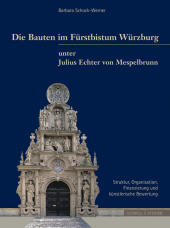
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Das Buch enthält die erste umfassende Darstellung der zahlreichen
Sakral- und Profanbauten, die auf Initiative des Würzburger
Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617)
entstanden. Ein besonderes Interesse gilt seinem persönlichen
Engagement in allen Bauangelegenheiten. Nicht nur der Umfang
seines Schaffens, auch die bisher weithin unterschätzte Qualität
der Bauten wird unter Berücksichtigung von Zeitquellen erschlossen
und in einem umfangreichen Katalogteil dokumentiert.
In diesem Buch wird die Bautätigkeit Julius Echters erstmals
detailliert geschildert und die sehr persönliche Prägung durch den
Fürstbischof und seine direkte Beteiligung herausgearbeitet. Die
Systematik der Bauorganisation, der Charakter der einzelnen
Bauaufgaben – einfache wie anspruchsvolle Kirchenbauten,
Rathäuser, Pfarrhäuser, Amtshäuser, Schlösser – und deren
Finanzierung sind ausführlich dargestellt.
Soweit heute noch möglich, rekonstruiert die Autorin auch
Ausmalung und Ausstattung. Zahlreiche Quellenzitate
vergegenwärtigen den historischen Kontext und die Intentionen des
Bauherrn. In dem umfangreichen Katalogteil werden alle noch
existierenden Bauten in Text und Bild vorgestellt. Darunter sind
so berühmte Bauten wie die Universitätskirche in Würzburg, aber
auch bislang weitgehend unbekannte Kleinode wie Altbessingen oder
Dipbach.
Die Kunsttopographie Unterfranken erfährt durch dieses Werk eine
wertvolle Ergänzung und bietet zugleich überregional bedeutsamen
Einblick in die Baugeschichte um 1600. Fürstbischof Julius Echter
von Mespelbrunn ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten in
der Geschichte Unterfrankens. Seine Bedeutung für die
Gegenreformation, für das Sozial- und Rechtswesen und die
wirtschaftliche Erneuerung Unterfrankens aber auch die durch ihn
forcierte Bautätigkeit standen wiederholt im Mittelpunkt
wissenschaftlicher Untersuchungen.
Zum Autor
Mit dem vorliegenden Band habilitierte sich Barbara Schock-Werner
an der Universität Würzburg. Seit 1999 ist die Autorin
Dombaumeisterin in Köln.
Verlagsinformation |
|
|