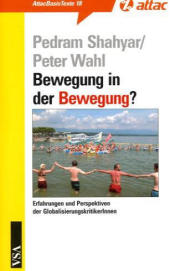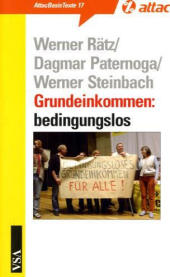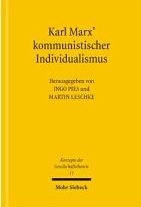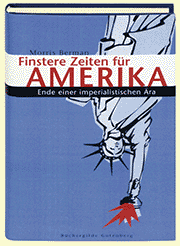|
21.
Oktober 2005 |
|
|
|
Mira Markovic: Erinnerungen einer
"Roten Hexe".
Vierzig Jahre Leidenschaft und Macht an der Seite Slobodan
Milosevics. Vorwort von Gerhard Zwerenz. Herausgegeben von
Giuseppe Zaccaria. Zambon-Verlag 2005. ISBN: 3-88975-081-8. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Mira Markovic, die immer wieder als die "rote Hexe", als "Lady
Macbeth" des Balkans bezeichnet wird, war eine der
einflussreichsten Frauen der Welt und die unbestrittene
Hauptdarstellerin der letzten zehn Jahre Ex-Jugoslawiens. Sie
verließ die politische Szene durch eine kühne Flucht. Dem Autor
gelang es, mit Mira Markovic einige lange Wochen zu verbringen, in
denen sie ihm ihr Leben schilderte: ihre Geburt, die Kindheit bei
ihren Großeltern, ihr aufgeklärtes bürgerliches Leben, ihr
Zusammentreffen mit Slobodan Milosevic und der Politik, die Jahre
an der Macht und ihr Leben an der Seite Milosevic.
Es handelt sich um ein glänzendes Beispiel für die Geschichte
einer Familie und politischer Ereignisse, die miteinander verwoben
und verflochten sind und die Grenzen zwischen Privatem und
Öffentlichem verwischen bzw. aufheben. Zaccaria beobachtete en
Detail den Zerfall des ehemaligen Jugoslawien während der Kriege
zwischen Kroatien und Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina,
dem langen Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina und den
Auseinandersetzungen um und im Kosovo. 1996 erhielt er den
Hemingway-Preis für "Noi criminali di guerra".
Das Buch behandelt zum ersten Mal im Westen die Schwierigkeiten
mit dem Haager Tribunal und beinhaltet dazugehörige Studien. Es
wird jetzt während des Prozesses als Beweisunterlage für die vom
Autor mitverfolgten politischen Ereignisse im Jahre 1997 benutzt.
Nach dem Kosovokrieg und seiner Festnahme gewährte Slobodan
Milosevic Zaccaria das einzige von ihm zugelassene Interview über
die Ereignisse der letzten 7 Jahre, einer Art politischem
Testament, das in La Stampa veröffentlicht wurde. Viele andere
Zeitungen druckten es nach und selbst CNN befasste sich damit
ausführlich.
Aus dem Vorwort
"Ich will nach Lektüre der Vorgeschichte und wiederholten Lektüre
der Gespräche mit Mira Markovic, Ihnen zukommen lassen, wie
wesentlich (ein so oft missbrauchtest Wort) dieses Buch mir
erscheint, in dem es alle die (vielleicht auch da und dort
berechtigten) Vorurteile in Fragen, Zögern, Sachlichkeiten
verwandelt. Vor allem ist die Arbeit des Journalisten Giuseppe
Zaccaria erstaunlich, indem es nämlich schlicht eine
unvoreingenommene, sozusagen normale ist, was heute im
Journalismus ganz und gar nicht mehr der Fall ist. Ein Buch mit
solcher Sachkenntnis, solchem Tiefblick, solchem Wirkenlassen der
Probleme ohne viel persönliche Besserwisserei, ist in Deutschland,
vor allem was die 'seriösen Medien' (die sich selber so
bezeichnen) betrifft, undenkbar geworden. Solche Bücher können in
der Tat die Augen öffnen, auch wenn man danach, was Serbien und
Jugoslawien angeht, umso ratloser ist. Aber das wäre schön und den
Lesern in Germany zu wünschen, ein Vorhangaufgehen.“ (Peter
Handke, Paris, am 2. Juni 2005)
Zum Herausgeber
Giuseppe Zaccaria, 53 Jahre alt, wurde in Bari geboren.
Sonderberichterstatter für die italienische Tageszeitung La Stampa.
Während der letzten 15 Jahre berichtete er über und erlebte
hautnah bedeutende internationale Ereignisse wie z. B. den Sturz
Ceaucescus in Rumänien, den ersten Golfkrieg und die Ereignisse im
Irak, den Antritt Nelson Mandelas als Präsident Südafrikas, die
Krise in Indonesien, die Ereignisse in Ost-Timor und den Zerfall
Jugoslawiens. 2000 erhielt er den Saint-Vincent Preis.
Verlagsinformation
|
|
|
Pedram Shayar/Peter Wahl: Bewegung
in Bewegung?
Erfahrungen und Perspektiven der GlobalisierungskritikerInnen.
AttacBasisTexte Bd. 18. VSA-Verlag 2005. ISBN: 3-89965-140-5. |
|
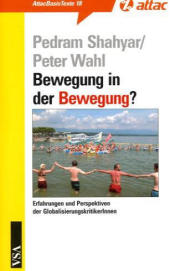
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
In diesem AttacBasisText gehen zwei Aktivisten dem Aufstieg der
neuen sozialen Bewegung der GlobalisierungskritikerInnen nach und
diskutieren die strategischen Herausforderungen für die Zukunft.
Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Attac Deutschland
untersuchen sie die Errungenschaften der Bewegung, insbesondere
ihren Beitrag zu Demokratisierung und Teilhabe. Sie argumentieren
für eine bewusste Bündnispolitik und hinterfragen das Verhältnis
von Bewegung und Parteien ebenso wie die Handlungsfähigkeit auf
europäischer Ebene.
Abschließend beleuchten sie hegemoniefähige Themen und
Alternativen für die weitere Arbeit. "Natürlich kann die Strategie
einer modernen sozialen Bewegung nicht mehr in geschlossenen
Zirkeln entstehen. Diese Zeiten sind – zum Glück – unwiderruflich
vorbei. Nur wenn die politischen Orientierungen und die konkreten
Schritte auch durch die Köpfe der Menschen gegangen sind, können
sie sich mit der Bewegung identifizieren, entsteht dauerhaft
Motivation."
Zu den Autoren
Pedram Shahyar ist Mitglied des Koordinierungskreises von Attac.
Peter Wahl ist Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation WEED
(Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung) und Mitglied des
Koordinierungskreises von Attac.
Verlagsinformation |
| |
|
Werner Rätz/Dagmar Patermoga/Werner
Steinbach: Grundeinkommen: bedingungslos.
AttacBasisTexte 17. VSA-Verlag 2005. ISBN: 3-89965-141-3. |
|
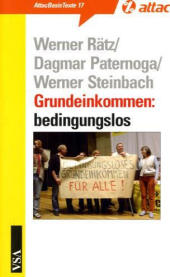
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Unter Linken besteht zwar ein breiter Konsens für ein Grundrecht
auf umfassende soziale Sicherung und Teilhabe am
gesellschaftlichen Reichtum, doch die Vorstellungen über seine
Ausgestaltung gehen weit auseinander. In diesem AttacBasisText
wird die Position für ein bedingungsloses, bedarfsunabhängiges
Grundeinkommen dargestellt.
"Die globalisierungskritische Bewegung und Attac vertreten den
Slogan 'Eine andere Welt ist möglich'. Diese andere Welt muss ein
gutes Leben aller ermöglichen. Deshalb umfasst
Globalisierungskritik immer auch die Suche nach gemeinsamen
Antworten auf die individuellen Unsicherheiten des Lebens. Ein
bedingungsloses Grundeinkommen für alle könnte eine solche sein."
Zu den AutorInnen
Werner Rätz (Koordinierungskreis von Attac für die
Informationsstelle Lateinamerika), Dagmar Paternoga und Werner
Steinbach arbeiten in der Attac-Kampagne "Genug für alle".
Verlagsinformation |
| |
|
Ingo Pies/Martin Leschke (Hrsg.):
Karl Marx' kommunistischer Individualismus.
Konzepte der Gesellschaftstheorie Bd.11. Mohr-Siebeck-Verlag 2005.
ISBN: 3-16-148702-8. |
|
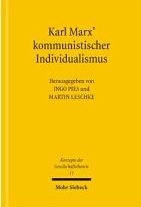
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Karl Marx ist durch und durch ein Autor des 19. Jahrhunderts. Doch
sein Werk hat erst im 20. Jahrhundert eine enorme Sprengkraft
entwickelt. Zwischen 1917 und 1989 beriefen sich zahlreiche
Versuche, totalitäre Regimes als kommunistisch auszuweisen, auf
Karl Marx. Folgt man der gängigen Sekundärliteratur, so erscheint
Marx als illiberaler Kollektivist. Dieses Urteil erweist sich
jedoch bei genauer Textlektüre als falsch. Zwar lehnte Marx den
zeitgenössischen Liberalismus ab, aber nicht, weil ihm die
individuelle Freiheit unwichtig gewesen wäre. Vielmehr bekämpft
Marx das Missverständnis, das darin besteht, die Freiheit des
Einzelnen als Freiheit von der Gesellschaft zu denken, als die
Freiheit einer Monade, als eine Freiheit, die durch Isolation von
anderen konstituiert wird. Marx hielt dagegen, dass es Freiheit
nur in der und durch die Gemeinschaft mit anderen Menschen gibt,
dass Freiheit sich nur im sozialen Prozess entfalten kann. Vor
diesem Hintergrund werden verschiedene Aspekte des Marxschen
Werkes diskutiert, u.a. das Entfremdungsproblem, Freiheit,
Gerechtigkeit und Ethik, die Anarchie des Marktes sowie der Wert
der Arbeit.
Vor dem Hintergrund dieser Sichtweise werden in dem vorliegenden
Band verschiedene Aspekte seines Werkes wie Entfremdung, (soziale)
Gerechtigkeit, Wert der Arbeit, Markt und Planung diskutiert. Wo
irrte Marx, und was können wir heute von ihm lernen? Mit Beiträgen
von: Ingo Pies, Reinhard Zintl, Gerhard Engel, Guy Kirsch, Harald
Bluhm, Thomas Döring, Michael Schmid, Walter Reese-Schäfer, Klaus
Beckmann; Martin Leschke, Birger B. Priddat, Bernd Hansjürgens,
Helmut Leipold, Michael Schramm, Matthias Meyer, Andreas Suchanek,
Hans G. Nutzinger.
Zu den Herausgebern
Prof. Dr. Ingo Pies ist Hochschuldozent am Lehrstuhl für
Wirtschaftsethik an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg. Pies arbeitet zugleich als Wissenschaftlicher
Direktor des Wittenberg-Zentrums für Globale Ethik e.V. in
Wittenberg.
PD Dr. Martin Leschke ist Hochschuldozent am Lehrstuhl für
Volkswirtschaftslehre, insbesondere für Geld und Währung, der
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster.
Verlagsinformation
|
|
|
Robert Kurz: Das Weltkapital.
Globalisierung und innere Schranken des modernen
warenproduzierenden Systems. Critica Diabolis Bd. 129. Bittermann
Edition Tiamat 2005. ISBN: 3-89320-085-1. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Unbeeindruckt von der Debatte um die Globalisierung geht die
Herausbildung eines transnationalen Weltkapitals jenseits der
alten Nationalökonomien weiter. Dabei zeigt sich, dass die
Erklärungsversuche der 90er Jahre zu kurz gegriffen haben. Die
Deutungs- und Bewältigungsmuster blieben pragmatisch und
moralisch; die Orientierung war rückwärts gewandt und ging über
den Begriffshorizont der traditionellen politischen Ökonomie nicht
hinaus.
Robert Kurz verlässt diesen Rahmen, um die neue Qualität der
kapitalistischen Entwicklung jenseits der veralteten
Interpretationsmuster zu untersuchen. Es erweist sich, dass mit
der 3. industriellen Revolution der im modernen
warenproduzierenden System strukturell angelegte Widerspruch von
Nationalismus und Universalismus reif geworden ist. Dabei handelt
es sich nicht um die Wiederkehr des Immergleichen, sondern um
einen historischen Entwicklungsprozess.
Im Unterschied zur bisherigen Geschichte bildet sich heute eine
durch globale Rationalisierungsketten organisierte
Betriebswirtschaft heraus, gesteuert von entsubstantialisierten
Finanzblasen. Da bedarf es nicht weniger als einer Umwälzung der
Gesellschaft über die warenproduzierende Moderne hinaus.
Aus dem Inhalt
- Die Mogelpackung der "zweiten Moderne"
- Auf dem Weg zur transnationalen Betriebswirtschaft
- Vom Fordismus zur globalen Finanzblasen-Ökonomie
- Die Tücken der verkürzten Kapitalismuskritik
Zum Autor
Robert Kurz, 1943 geboren, lebt als freier Publizist, Journalist
und Referent im Kultur- und Wirtschaftsbereich in Nürnberg. Er ist
Mitherausgeber der gesellschaftskritischen Theoriezeitschrift
Exit und
veröffentlichte bisher u. a. folgende Titel: "Der
Kollaps der Modernisierung" (1991), "Feierabend.
Zwölf Attacken gegen die Arbeit" (1999), "Weltordnungskrieg"
(2003).
Verlagsinformation
|
|
|
20.
Oktober 2005 |
|
|
|
Morris Berman: Finstere Zeiten für
Amerika.
Ende einer imperialistischen Ära. Edition Büchergilde 2005. ISBN:
3-936428-50-6.
|
|
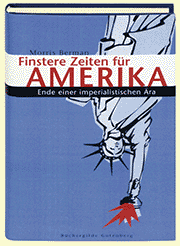
mehr Infos
bestellen
|
Zum
Buch
Um nichts weniger als den Niedergang der Vereinigten Staaten als
Großmacht geht es Morris Berman, der mit harter Kritik an den
gesellschaftlichen und politischen Zuständen in den USA nicht
spart. Die Situation vor und nach dem Anschlag auf das World Trade
Center am 11. September 2001, die Hintergründe, Ursachen und
Folgen dieses Ereignisses bilden die zentralen Bezugspunkte für
die fesselnde Argumentation des Autors.
Die Wurzel allen Übels sieht Berman im täglichen Leben der
Amerikaner, in ihren Wertvorstellungen, ihrem mangelnden
historischen Bewusstsein, ihren simplen Anschauungen in einer
komplexer gewordenen Welt. Dahinter verbergen sich vor allem
Übersättigung durch die Medien, ein eklatanter Bildungsmangel
sowie die Verrohung der amerikanischen Gesellschaft. Berman
verknüpft seine soziologischen Betrachtungen der amerikanischen
Lebensart, den "Mikrophänomenen", mit so genannten
"Makrophänomenen" wie zum Beispiel der Außenpolitik der USA und
zeigt anschaulich, wie sehr sich Makro- und Mikrokosmos
gegenseitig beeinflussen.
Berman schöpft aus einem beeindruckenden
Fundus historischen und aktuellen Wissens über sein Land wie über
die Verhältnisse in Europa oder auch China. Nach Ansicht des
Autors zeichnet sich jetzt bereits ab, dass die USA von Europa und
China überholt und auf kulturellem sowie ökonomischem Gebiet zu
einer Randfigur werden. Die Untersuchung kultureller,
wirtschaftlicher, militärischer und soziologischer Faktoren zeigt
überraschend schlüssige und beängstigende Ergebnisse, die uns in
dieser globalisierten Welt alle angehen.
Zum Autor
Morris Berman, geboren 1944, lebt in Washington D. C. Er ist
Kulturhistoriker und Sozialkritiker, Schriftsteller und hat –
bekannt geworden besonders durch seine innovativen Ideen – mehrere
Bücher über die Krise der westlichen Zivilisation veröffentlicht.
Berman unterrichtete an zahlreichen Universitäten in den USA und
Europa. Seit 2003 ist er Gastprofessor für Soziologie an der
Catholic University of America in Washington D.C. Sein letztes
Buch "Kultur vor dem Kollaps? Wegbereiter Amerika" erschien 2002
bei der Büchergilde Gutenberg.
Verlagsinformation |
|
|