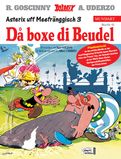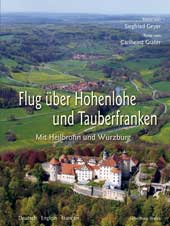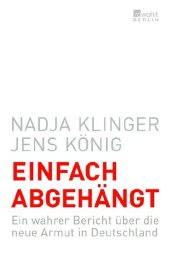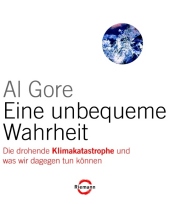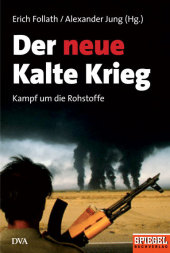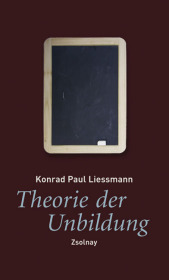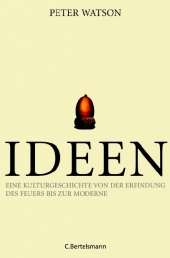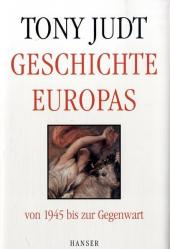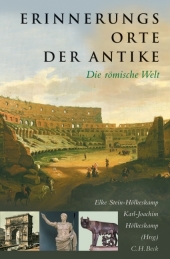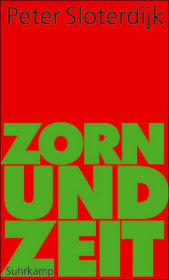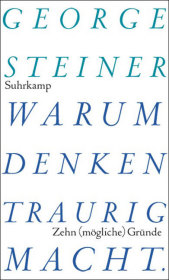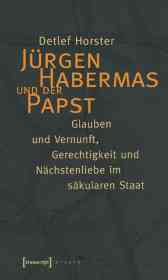|
12. Oktober 2006 |
|
|
|
Albert Uderzo/Rene Goscinny: Då
boxe di Beudel (Der Kampf
der Häuptlinge, Asterix Mundart, Bd.61 Mainfränkisch/Asterix uff
Meefränggisch Bd.3). Ehapa Comic Collection – Egmont Manga &
Anime 2006. ISBN: 3-7704-3055-7. |
|
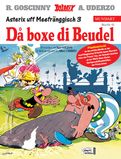
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Es is fuchzich vor Christus. In ganz Frångn führn die Besatzer des
Rechiment. In ganz Frångn?
Nää – ä glens Völkle in Unnerfrångn wärd zwar schon lång
underdrüggd vo der Kapidåle in Südn. Aber unbeuchsam wie se sin,
dun se alleweil emål aufbegehr. Un für die Besatzer is des Lebm
nit eifach in ihre Låcher Silvanum, Scheurebrum, Rieslania un
Müllrum-Thurgia...
Zu den Autoren
Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem
Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung
eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten
Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich
abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René
Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als
Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".
René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos
Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als
Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem
Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ
Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur
einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf
sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für
Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky
Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und
"Asterix" (mit Uderzo).
Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.
November 1977.
Verlagsinformation |
|
|
10. Oktober 2006 |
|
|
|
Siegfried Geyer/Carlheinz Gräter:
Flug über Hohenlohe und Tauberfranken.
Mit Heilbronn und Würzburg. Deutsch, English, Français. 176
Seiten, 189 Farbaufnahmen.
Einführungspreis bis 31. Januar
2007: 29,90 Euro, danach 32,90 Euro.
ISBN: 3-87407-708-X. |
|
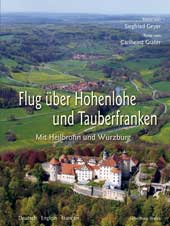
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Von Bad Wimpfen bis Schillingsfürst und Rothenburg ob der Tauber,
von Gaildorf und Schwäbisch Hall bis Wertheim und Würzburg: In
einmaligen Luftaufnahmen porträtiert der Fotograf Siegfried Geyer
die Region Hohenlohe-Franken. Die einzigartigen Fotos
dokumentieren, dass die Landschaft an Jagst, Kocher und Tauber
reich an schmucken Städtchen und Dörfern ist – an beeindruckenden
Schlössern und Burgen, an pittoresken Kirchen und Klöstern.
Dazwischen sieht man fast unberührte Winkel mit einsamen Gehöften,
Mühlen oder den typischen Holzbrücken. Doch auch die beiden, für
diese Region wichtigen Großstädte, Heilbronn und Würzburg, sind in
diesem Band mit brillanten Fotografien aus der Vogelperspektive
enthalten. Der Hohenlohe- und Franken-Kenner Carlheinz Gräter hat
die fantastischen Bilder detailreich und profund beschrieben. Alle
Texte sind dreisprachig abgedruckt.
Das Buch ist ein wunderbares Geschenk für alle Liebhaber der
Region Hohenlohe-Franken, für Besucher, Geschäftskunden und
Freunde im Ausland.
Zu Autor und Fotograf
Dr. Carlheinz Gräter, geboren 1937 in Bad Mergentheim, studierte
Geschichte und Literatur, arbeitete anschließend als
Zeitungsredakteur und ist seit 1972 freier Schriftsteller. Er lebt
heute in Würzburg. Für sein Werk, das mehr als 60
Buchveröffentlichungen umfasst, wurde er mit dem Kulturpreis des
Frankenbundes ausgezeichnet.
Siegfried Geyer, geboren 1954, ist in Heidenheim an der Brenz zu
Hause. Er ist ausgebildeter Fotograf und seit über 25 Jahren auf
Luftbilder spezialisiert.
Verlagsinformation |
|
|
9. Oktober 2006 |
|
|
|
Nadja Klinger/Jens König: Einfach
abgehängt.
Ein wahrer Bericht über die neue Armut in Deutschland.
Rowohlt-Verlag, Berlin 2006. ISBN: 3-87134-552-0. |
|
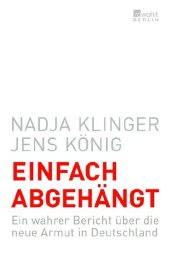
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Die neue Unterschicht – ein Land vergisst seine Armen: Was heißt
es, wenn man im Monat von 345 Euro leben muss? Oder wenn man von
30.000 Euro Schulden erdrückt wird? Wie tief fällt ein Ingenieur,
der aus einem scheinbar gesicherten Dasein in die Armut stürzt?
Wie schlägt sich eine Mutter durch, die höchstens 88 Cent für ein
Frühstück ausgeben kann? Oder die vierköpfige Familie, die von
Arbeitslosengeld II lebt?
Nadja Klinger und Jens König porträtieren Menschen, die von der
Gesellschaft abgehängt werden. Denn die Armut in Deutschland
breitet sich immer mehr aus, die Mittelschicht ist vom Abstieg
bedroht – und die Kluft zwischen Arm und Reich groß wie nie. So
hat sich fast unmerklich eine Gruppe gebildet, die beständig
wächst: die neue Unterschicht der Besitz- und Bildungslosen.
Zu ihr zählen Hartz-IV-Empfänger genauso wie gescheiterte
Architekten. Die einen sind tief gefallen, die anderen nie
aufgestiegen. Das Buch versammelt eindrucksvolle Porträts und
zugleich eine scharfsinnige Analyse über einen gesellschaftlichen
Skandal, der uns alle in Zukunft mehr interessieren wird, als wir
uns heute eingestehen.
Zu den AutorInnen
Nadja Klinger, geboren 1965 in Berlin, lebt dort als freie
Autorin. Sie schreibt vor allem Porträts und große Reportagen für
den Berliner Tagesspiegel, die taz und das Magazin. 1997 erschien
ihr Buch "Ich ziehe einen Kreis". Für ihre Reportage "Rennen auf
der Stelle" über die Situation einer Hartz-IV-Empfängerin, die
sich umschulen lassen will, ist sie gerade mit dem "Deutschen
Sozialpreis der Wohlfahrtsverbände" ausgezeichnet worden.
Jens König, geboren 1964, ist Journalist. Von 1989 bis 1994 stand
er als Chefredakteur der "Jungen Welt" vor. Heute leitet König das
Parlamentsbüro der Tageszeitung. 2005 erschien sein Buch "Gregor
Gysi. Eine Biographie" (Rowohlt Berlin).
Verlagsinformation |
|
|
Al Gore: Eine unbequeme Wahrheit.
Riemann-Verlag 2006. ISBN: 3-570-50078-0. |
|
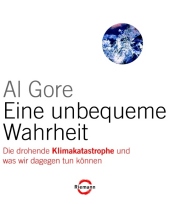
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Überall auf dem Globus bezeugen schwindende Gletscher, die
Ausdehnung der Wüsten und eine Zunahme der Wetteranomalien eine
nicht zu leugnende Wahrheit: Die Zyklen der Natur befinden sich in
einem Prozess tief greifender Veränderung. Unter dem Titel "An
Inconvenient Truth" lief in den USA ein sehr erfolgreicher
Dokumentarfilm über diese Umwälzungen mit Al Gore als
Hauptdarsteller. Das dazugehörige Buch mit einer Fülle
eindrucksvoller Fotos und Grafiken stürmte schon bald nach seinem
Erscheinen die US-Bestsellerlisten.
"Eine unbequeme Wahrheit" ist ein Weckruf in einer Zeit, in der
nicht nur in den USA bequeme Lügen die öffentliche Meinung
dominieren. Provokativ wie die Filme von Michael Moore, visuell
eindrucksvoll und aufrüttelnd wie Koyaanisquatsi, erschreckend und
dramatisch wie "The Day after Tomorrow" ist dieses neue Werk des
ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten. Ein Buch, das
Ihr Bild von dieser Welt verändern kann und Ihnen zeigt, wo Ihre
eigene Macht liegt, die Katastrophe abzuwenden.
Zum Autor
Albert Arnold "Al" Gore Jr., geboren 1948 in Washington D.C., ist
Mitglied der Demokratischen Partei. Von 1984 bis 1993 war er
Senator des US-Bundesstaates Tennessee, vom 20. Januar 1993 bis
zum 20. Januar 2001 war Gore 45. Vizepräsident unter Präsident
Bill Clinton. Im Jahre 2000 verlor er die US-Präsidentschaftswahl
gegen George W. Bush aufgrund des komplizierten US-amerikanischen
Wahlsystems, obwohl er rund 250.000 Stimmen mehr hatte als sein
republikanischer Gegenkandidat. Seit geraumer Zeit ist Al Gore als
Publizist aktiv.
Verlagsinformation |
|
|
Josef Joffe: Die Hypermacht.
Warum die USA die Welt beherrschen. Hanser-Verlag 2006. ISBN:
3-446-20744-9. |
|

mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Josef Joffe, Herausgeber der "Zeit" und einer der besten Kenner
Amerikas, schildert den Weg der USA zur Alleinherrschaft: in der
Politik, in der Wirtschaft und in der Kultur. Mit dem
Zusammenbruch der UdSSR im Dezember 1991 stiegen die USA zur
einzigen Supermacht der Erde auf. Welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für die USA, welche für den Rest der Welt? Dieses Buch
mutet beiden Seiten unangenehme Wahrheiten zu.
Leseprobe
Der Untergang der UdSSR bildet den Ausgangspunkt für dieses Buch.
Es will zum einen zeigen, welche Folgen der revolutionäre Wandel
der Weltpolitik von der "Bipolarität" zur "Unipolarität", von der
Dominanz à deux zur Vorherrschaft einer einzigen Weltmacht
gezeitigt hat. Wie wirkte sich diese Zäsur auf die Politik der
Vereinigten Staaten und die der restlichen Welt aus? Zum zweiten
versucht dieses Buch auszuloten, welche Rolle Amerika auf der neu
gestalteten Bühne übernehmen sollte – nun, da mit der bipolaren
Ordnung auch die simplen, aber starren Regeln des Kalten Krieges
verschwunden sind. [...]
Wie aber sieht das neue Drehbuch für das neue Drama aus, wie
sollte es aussehen eingedenk der Warnung der Geschichte, wonach
Alleinherrschaft erst die Versuchung, dann die Vergeltung gebiert?
Wie kann Amerika seine beispiellose Macht weise nutzen? Vor dieser
Frage steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nur Amerika
selber, sondern auch der Rest der Welt, der auf diesen rastlosen
Riesen blickt – einen Giganten, der zum Guten wie zum Schlechten
die weltpolitische Bühne bis weit in 21. Jahrhundert hinein
beherrschen wird. [...]
Ein halbes Jahrtausend lang entfalteten sich auf dieser Bühne
Aufstieg und Fall der Staaten. [...] Die klassische Struktur wurde
von mehreren Großmächten beherrscht, üblicherweise fünf in
wechselnder Gestalt, die miteinander um Sicherheit, Macht und
Vorteil wetteiferten. Nach unserem heutigen Sprachgebrauch
handelte es sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs um ein
"multipolares" System, das plötzlich von zwei alle anderen
überragenden Mächten abgelöst wurde – den Vereinigten Staaten und
der Sowjetunion.
Diese Entwicklung hatte, wenn auch nur schemenhaft, schon Alexis
de Tocqueville vorausgesehen, der 1835 sinnierte: "In unserer
heutigen Zeit gibt es zwei große Völker auf Erden, die von
verschiedenen Punkten aufbrechen und dennoch dem gleichen Ziele
zuzustreben scheinen; ich meine die Russen und die Amerikaner. […]
Ihr Ausgangspunkt ist verschieden, ihre Wege sind nicht die
gleichen; dennoch scheinen beide durch himmlische Vorsehung
berufen, eines Tages die Geschicke der halben Welt zu bestimmen."
Zum Autor
Josef Joffe, geboren 1944 im Ghetto Litzmannstadt in Lodz/Polen,
ist ein deutsch-jüdischer Journalist. Er wuchs in Berlin auf und
studierte neben anderen an der Harvard-Universität und erlangte
1975 den Ph.D. Seit April 2000 ist Joffe Mitglied im
Herausgeber-Gremium der Wochenzeitung „Die Zeit“. Von 2001 bis
2004 war er auch ihr Chefredakteur, gemeinsam mit Michael Naumann.
Davor war Joffe Leiter des Ressorts "Außenpolitik" bei der
Süddeutschen Zeitung. Als Dozent für internationale Politik lehrte
Joffe in München, an der Johns-Hopkins-Universität, in Harvard
sowie in Stanford.
Verlagsinformation |
|
|
Erich Follath/Alexander Jung
(Hrsg.): Der neue Kalte Krieg.
Kampf um die Rohstoffe. Mit Beiträgen von Beat Balzli, Jochen
Bölsche, Stephan Burgdorff u. a. Deutsche
Verlags-Anstalt/Spiegel-Buchverlag 2006. ISBN: 3-421-04255-1. |
|
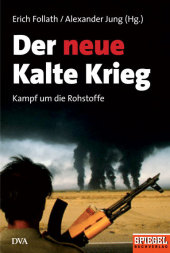
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Steigender Rohstoffbedarf trifft auf Rohstoffverknappung. Die
Folge: heftige Verteilungskämpfe. Dennis Meadows hat in "Die
Grenzen des Wachstums" bereits vor über 30 Jahren vorausgesagt,
dass die wichtigsten Ressourcen, auf denen die hoch entwickelte
Weltwirtschaft basiert, in absehbarer Zeit erschöpft sein werden.
Nun ist es für jedermann spürbar: Öl- und Gaspreise steigen vor
allem deshalb, weil der Hunger der Industrieländer und der
Aufsteiger wie China und Indien unersättlich ist, die Vorräte
jedoch rapide schwinden.
Ähnliches gilt für andere lebensnotwendige Rohstoffe. Mit
aggressiven Strategien versuchen sich die Wettbewerber um kostbare
Ressourcen Vorteile zu verschaffen. Welche weltpolitischen
Konflikte sich daraus entwickeln, welche Länder in Zukunft zu den
Gewinnern, welche zu den Verlierern gehören und welche Chancen
alternative Energien bieten, zeigen SPIEGEL-Journalisten in dieser
aktuellen Bestandsaufnahme, die den Blick in die Zukunft wagt: in
ein Zeitalter der Energiekonflikte, eines neuen Kalten Krieges.
Zu den Herausgebern
Erich Follath ist promovierter Politologe und Germanist. Er war "Stern"-Korrespondent
in Hongkong und New York, später Chefreporter mit dem
Spezialgebiet Nahost. Heute ist er Autor beim SPIEGEL.
Buchveröffentlichungen u.a. "Das Auge Davids" (über den
israelischen Geheimdienst) und "Bilder aus Hongkong".
Alexander Jung arbeitet als Redakteur beim Wochenmagazin DER
SPIEGEL.
Verlagsinformation |
|
|
Konrad P. Liessmann: Theorie der
Unbildung.
Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. Zsolnay-Verlag 2006. ISBN:
3-552-05382-4. |
|
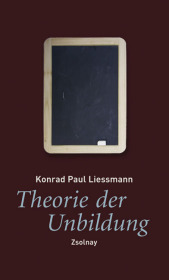
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Was weiß die Wissensgesellschaft? Wer wird Millionär? Wirklich
derjenige, der am meisten weiß? Wissen und Bildung sind, so heißt
es, die wichtigsten Ressourcen des rohstoffarmen Europa. Debatten
um mangelnde Qualität von Schulen und Studienbedingungen –
Stichwort Pisa! – haben dennoch heute die Titelseiten erobert. In
seinem hochaktuellen Buch entlarvt der Wiener Philosoph Konrad
Paul Liessmann vieles, was unter dem Titel Wissensgesellschaft
propagiert wird, als rhetorische Geste: Weniger um die Idee von
Bildung gehe es dabei, als um handfeste politische und ökonomische
Interessen. Eine fesselnde Streitschrift wider den Ungeist der
Zeit.
Leseprobe
Wer wird Millionär – oder: Alles, was man wissen muss
Die in Deutschland von einem Privatsender ausgestrahlte Quizshow
"Wer wird Millionär", die in Österreich unter dem Titel
"Millionenshow" vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet
wird, gehört seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten
Formaten dieser Art. Neben dem Erfolg von Dietrich Schwanitz’
Sachbuch-Bestseller "Bildung. Alles, was man wissen muss" und den
Harry-Potter-Romanen von Joanne K. Rowling gehören diese Shows für
viele Kulturoptimisten zu jenen Indizien, die zeigen, dass die
Bildungs- und Leselust der Menschen ungebrochen ist.
Dass sich immer wieder und immer noch Menschen finden, die sich –
durch das Studium von Lexika und einschlägigen Handbüchern mehr
oder weniger gut vorbereitet – vor einem Millionenpublikum einem
Wissenstest stellen, ist in der Tat bemerkenswert. Verantwortlich
dafür mag nicht nur die Aussicht auf den Gewinn sein, auch nicht
nur die Simulation einer Prüfungssituation, deren Beobachtung
immer schon mit beträchtlichem Lustgewinn verbunden war, sondern
auch die Sache selbst, um die es geht: das Wissen. Genau in diesem
Punkt demonstriert diese Show, kulturindustrielles Produkt par
excellence, einiges davon, wie es um das Wissen in der
Wissensgesellschaft bestellt ist.
Die Konstruktion der Show ist denkbar einfach. Einem Kandidaten,
der es nach verschiedenen Vorauswahlverfahren bis ins Zentrum des
Geschehens geschafft hat, werden bis zu fünfzehn Fragen gestellt,
deren Schwierigkeitsgrad mit dem für die richtigen Antworten
ausgesetzten Preisgeld steigt. Im Gegensatz zur herrschenden
Ideologie der Vernetzung wird in dieser Show einzig nach einem
punktuellen Wissen gefragt. Die aus Multiple-Choice-Verfahren
bekannten vorgegebenen Antworten, aus denen eine auszuwählen ist,
ermöglichen nicht nur eine rasche und unmittelbare Reaktion,
sondern zeigen auch in nuce, wo die Grenzen zwischen Raten,
Vermuten, Wissen und Bildung verlaufen.
Dort, wo Kandidaten ihre Wahl mit Formeln wie "Das kommt mir
bekannt vor" oder "Davon habe ich schon einmal gehört" begründen,
triumphiert das Bekannte über das Gewusste, dort, wo mit
Wahrscheinlichem oder Plausibilitäten gearbeitet wird, regieren
Ahnungen und dunkle Erinnerungen, und wenn jemand tatsächlich
etwas weiß, wird als Begründung für die Wahl der Antwort dann auch
folgerichtig gesagt: Das weiß ich.
Ein Hauch von Bildung schleicht sich schließlich dann ein, wenn es
einem Kandidaten gelingt, aufgrund seiner Kenntnisse etwa des
Lateinischen oder gar Griechischen die Bedeutung von ihm an sich
nicht geläufigen Fachausdrücken zu erschließen. Die Show, und das
mag ihre Attraktivität mit bedingen, simuliert so Bewegungen im
Wissensraum, die jeder kennt und nachvollziehen kann: Nur sehr
wenig haben wir verstanden, einiges wissen wir, manches kann
vermutet werden, das meiste ist uns aber nicht geläufig und kann
höchstens erraten werden.
Zum Autor
Konrad Paul Liessmann, geboren 1953 in Villach, studierte
Germanistik, Geschichte und Philosophie in Wien. Er arbeitet als
Professor (am Institut für Philosophie der Universität Wien),
Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Liessmann
veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und Essays
aus den Bereichen der Ästhetik, Kunst- und Kulturphilosophie,
Gesellschafts- und Medientheorie, Technikphilosophie sowie der
Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts.
Verlagsinformation |
|
|
Peter Watson: Ideen.
Eine Kulturgeschichte von der Entdeckung des Feuers bis zur
Moderne. Bertelsmann-Verlag, München 2006. ISBN: 3-570-00626-3. |
|
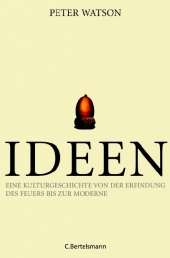
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Vom Abenteuer des Denkens, Entdeckens und Erfindens: Die große
Kulturgeschichte der Menschheit ist ein Leseschmöker und
Denkabenteuer, Fundgrube und Ideen-Kompendium. Peter Watson bietet
nach "Das Lächeln der Medusa" erneut Geistesgeschichte zum
Anfassen. Beginnt die Ideengeschichte der Menschheit, als die
Frühmenschen erstmals Feuer machen, vor ca. 1,8 Millionen Jahren?
Oder schon mit dem ersten Faustkeil vor etwa 2,5 Millionen Jahren?
Warum entwickelte sich vor 40.000 Jahren eine komplexe Sprache?
Wie kamen das Minus- und das Plus-Zeichen in die Vorstellungswelt,
und wie entstand das Bild vom Paradies?
Peter Watson lädt ein zu einer Expedition durch die abenteuerliche
Welt menschlicher Ideen. Vom ersten Feuer, dem ersten Werkzeug und
den ersten Worten über die Geburt der Götter, die ersten Gesetze
und die Entwicklung großer Zentren von Wissen und Weisheit bis hin
zu den umwälzenden Ideen der Moderne: das Größte und das Kleinste,
das Selbst-Bewusstsein des Individuums und die Entdeckung des
Unbewussten.
Dabei ordnet Watson die riesige Materialfülle nach drei zentralen
Ideen, die für ihn die Geschichte der Menschheit prägen: die
Seele, mehr als die Idee von einem Gott; Europa, mehr als das
Gebiet auf der Landkarte; und das Experiment als Motor aller
Entwicklung. Wie schon in seinem erfolgreichen Standardwerk "Das
Lächeln der Medusa" über die Ideen des 20. Jahrhunderts gelingt es
dem begnadeten Wissensvermittler, den Leser in den Kosmos des
Denkens und Erfindens zu locken.
Voller Staunen verfolgt man das Auftauchen und Verschwinden von
Ideen, Denkern und Kulturen, erkennt ungeahnte Zusammenhänge und
sieht schließlich die eigene Welt als Produkt eines gewaltigen
Prozesses aus Mut, Erfindungsgeist und Erkenntnislust.
Zum Autor
Peter Watson, geboren 1943, studierte an den Universitäten von
Durham, London und Rom. Er war stellvertretender Herausgeber von
"New Science", arbeitete vier Jahre lang für die "Sunday
Times", war Korrespondent in New York für die "Times" und
schrieb für den "Observer", die "New York Times", "Punch" und "Spectator".
Watson hat bisher dreizehn Bücher veröffentlicht und war an einigen
TV-Produktion zum Thema Kunst beteiligt. Seit 1989 ist er als
Lehrbeauftragter am McDonald Institute for Archaeological Research
der Universität Cambridge tätig.
Verlagsinformation |
|
|
Tony Judt: Geschichte Europas von
1945 bis zur Gegenwart.
Hanser-Verlag 2006. ISBN: 3-446-20777-5. |
|
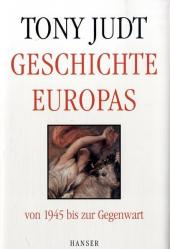
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Tony Judt legt die erste umfassende Geschichte des modernen Europa
vor. In den
vergangenen 60 Jahren hat sich der so genannte "alte Kontinent"
komplett verändert. Dem Weltkrieg folgte der Kalte Krieg, die
Revolutionen seit 1989 setzten fast überall die Demokratie durch
und schufen die Voraussetzung dafür, dass sich immer mehr
europäische Nationen der EU anschließen konnten.
Der Autor
arbeitet die großen Linien der Politik, der Gesellschaft, der
Kultur und des Alltags in Europa heraus. Und je weiter man sich in
die Lektüre dieser großartigen Erzählung vertieft, desto klarer
setzt sich eine Erkenntnis durch: dass die Zeiten, da uns unsere
nationale Geschichte genügen konnte, endgültig vorbei sind.
Leseprobe
Verlagsinformation |
|
|
Elke
Stein-Hölkeskamp/Karl-Joachim Hölkeskamp (Hrsg.): Erinnerungsorte
der Antike.
Die römische Welt. C.H. Beck-Verlag 2006. ISBN: 3-406-54682-X. |
|
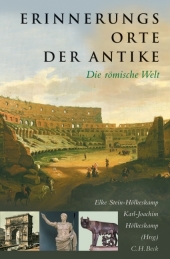
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Vom Lateinischen als Weltsprache bis zu Caesars Gallischem Krieg;
von Neros brennendem Rom bis zu den letzten Tagen von Pompeji, vom
Tod des Gladiators bis zur Christenverfolgung, von Augustus' Rom
aus Marmor bis zu Theodor Mommsens Römischer Geschichte: In
insgesamt 38 glänzend geschriebenen Beiträgen präsentieren
herausragende Autorinnen und Autoren die wichtigsten Erinnerungsorte der römischen Geschichte. Aus kleinsten dörflichen
Anfängen hervorgegangen, entwickelte sich die Stadt am Tiber zur
gewaltigen Metropole, ja, zur Herrin der antiken Welt.
So gewaltig Raum und Zeit römischer Herrschaft waren, so
einzigartig und wirkungsmächtig erscheint das kulturelle und
materielle Erbe, das Rom uns hinterlassen hat. Die Autorinnen und
Autoren der "Erinnerungsorte" laden ein, die wichtigsten Weg- und
Wendemarken der Geistes- und Religionsgeschichte, der Ereignis-
und Politikgeschichte, der Kultur- und Rechtsgeschichte und nicht
zuletzt der Archäologie des römischen Erdkreises kennen- und in
ihrer überzeitlichen Bedeutung verstehen zu lernen.
So ist ein Buch entstanden, das nichts mit nostalgischer
Beschwörung von Altbekanntem zu tun hat, sondern ein Buch der Neu-
und Wiederentdeckungen und vor allem ein überzeugendes Beispiel
lebendiger Erinnerungskultur, kurz: ein faszinierendes, spannend
zu lesendes Geschichts- und Geschichtenbuch zur römischen Antike.
Zu den HerausgeberInnen
PD Dr. Elke Stein-Hölkeskamp lehrt am Seminar für Alte Geschichte
der Universität Münster.
Professor Dr. Karl-Joachim Hölkeskamp hat den Lehrstuhl für Alte
Geschichte am Institut für Altertumskunde der Universität Köln
inne.
Verlagsinformation |
|
|
Peter Sloterdijk: Zorn und
Zeit.
Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN:
3-518-41840-8. |
|
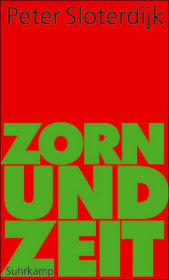
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Unverwechselbares Kennzeichen des Denkens und Schreibens von Peter
Sloterdijk ist die Einbettung aktuellster Fragen in ihre lange
Geschichte. Dadurch gelangt er zu Neubestimmungen der
gegenwärtigen "condition humaine", kann sie durch eine bisher
unbekannte Perspektive sichtbar machen und unerwartete oder
ungewollte Zusammenhänge nachweisen. In seinem neuen Essay geht er
auf den Zorn ein, dessen Folgen sich als Kampf, Gewalt, Aggression
äußern.
Am Anfang des ersten Satzes der europäischen Überlieferung, die
mit der Ilias beginnt, steht das Wort "Zorn". Er gilt dort als
unheilbringend – und wird deshalb hoch geschätzt, auch weil er
Helden hervorbringt. Wie kommt es, dass Zorn schon relativ bald
danach in der Polis nur in eng umgrenzten Situationen zugelassen
wird? Wie kommt es in späteren kulturellen Traditionen zur
Herausbildung des "heiligen Zorns" und damit zugleich eines ersten
Begriffs von Gerechtigkeit? Wie ist eine kommunistische Weltbank
des Zorns denkbar?
Wie kam es dazu, dass die Gesellschaften mit Gerechtigkeit als
Grundwert den Zorn in allen Kontexten ausgeschlossen haben? Und
wie ist seiner Wiederkehr zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu
begegnen? Peter Sloterdijk formuliert eine Antwort: "Große Politik
geschieht allein im Modus von Balanceübungen. Die Balance üben
heißt keinem notwendigen Kampf ausweichen, keinen überflüssigen
provozieren. Es heißt auch, den Wettlauf mit der Umweltzerstörung
und der allgemeinen Demoralisierung nicht verloren geben."
Zum Autor
Peter Sloterdijk, 1947 in Karlsruhe geboren, ist dort seit 1992
Professor für Philosophie und Medientheorie an der Hochschule für
Gestaltung und seit 2001deren Direktor. Seit 2002 leitet er
zusammen mit Rüdiger Safranski die ZDF-Sendung "Im Glashaus – Das
Philosophische Quartett". 1993 erhielt er den den
Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik, 2001 den
Christian-Kellerer-Preis für die Zukunft philosophischer Gedanken
und 2005 den Sigmund-Freud-Preis.
Verlagsinformation |
|
|
George Steiner: Warum Denken
traurig macht.
Zehn (mögliche) Gründe. Mit einem Nachwort von Durs Grünbein.
Suhrkamp-Verlag 2006. ISBN: 3-518-41841-6. |
|
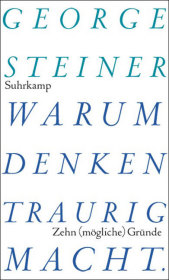
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
Anwesend waren Traurigkeit, tristitia oder tristesse in George
Steiners Prosa seit jeher: als Gedanke, Thema und Gestimmtheit.
Nun aber stellt er sie, von Schelling ausgehend, in den
Mittelpunkt einer Meditation über Glanz und Elend der Reflexion.
Grundiert ist alles Denken durch Schwermut, die in jedem Gedanken
vernehmbar bleibt und sich fortpflanzt – so die von Steiner
gewählte kosmische Analogie – wie das Hintergrundrauschen als Echo
des "Urknalls ". Zweiflerisch ist dieses Denken und durchdrungen
vom Gefühl seiner Vergeblichkeit.
Es ist unberechenbar und heillos individuell, verschwenderisch und
kreisschlüssig, eingeschränkt in den Grenzen der Sprache,
axiomatisch, neurophysiologisch determiniert. Es ist, als "Großes
Denken", weit entfernt von Mehrheitsentscheidungen und allgemeiner
Anerkennung. Es ist aussichtslos, führt schließlich auf nichts.
Und doch ist es die einzig menschenwürdige Anstrengung. George
Steiners Schrift ist eine Variation in zehn Sätzen auf ein Thema
von Schelling, das Produkt einer persönlichen Ästhetik, ein Stück
Gedankenmusik, ein logisches Gedicht.
Zum Autor
Goerge Steiner, geboren 1929 in Paris, hat seit 1994 den
Lord-Weidenfeld-Lehrstuhl für Komparatistik an der Universität
Oxford inne. U.a. von ihm erschienen sind: "Martin Heidegger"
(1989), "Von realer Gegenwart" (1990) und "Der Garten des
Archimedes" (1997).
Verlagsinformation |
|
|
Detlef Horster: Jürgen Habermas
und der Papst.
Glauben und Vernunft, Gerechtigkeit und Nächstenliebe im säkularen
Staat. X-texte zu Kultur und Gesellschaft. transcript-Verlag 2006.
ISBN: 3-89942-411-5. |
|
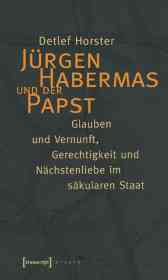
mehr Infos
bestellen
|
Zum Buch
In der Gegenwartsgesellschaft dringe die Sprache des Marktes in
alle Poren des Sozialen. Selbst unsere rationale Moral mit ihren
reziproken Rechten und Pflichten sei dem merkantilen
Vertragsprinzip nachgebildet. Darum bringt Habermas das
Moralprinzip Nächstenliebe ins Spiel, das auch zentraler
Gegenstand der ersten Enzyklika des neuen Pontifex ist, die
weltweit hohe Aufmerksamkeit erregt.
Habermas und der spätere Papst waren sich bei ihrem
Zusammentreffen 2004 in ihrer Gesellschaftsanalyse einig und auch
darin, dass Gerechtigkeit hergestellt und darüber hinaus die
Nächstenliebe angemahnt werden müsse. Unterschiedlich sehen beide
allerdings die Rolle der Religion im säkularen Staat. Detlef
Horster setzt sich in seinem Essay kritisch mit den beiden
Positionen auseinander und fragt von einem sozialphilosophischen
Standpunkt aus nach den Möglichkeiten und Grenzen religiöser
Impulse für die Moral der Gegenwart.
Zum Autor
Detlef Horster, geboren 1942, ist Professor für Sozialphilosophie
an der Universität Hannover. Er studierte Philosophie,
Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft und Soziologie in Köln und
Frankfurt am Main. 1976 promovierte er im Fach Soziologie.
Zahlreiche Veröffentlichungen u.a. auch Einführungen zu Ernst
Bloch und Jürgen Habermas vor.
Verlagsinformation |
|
|