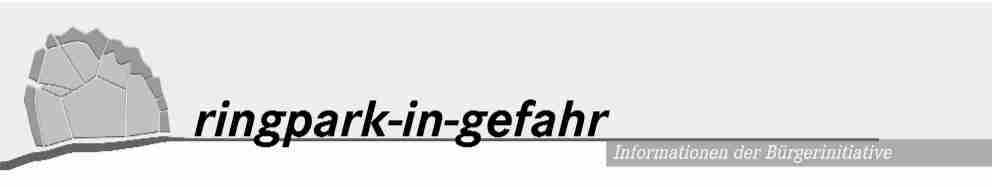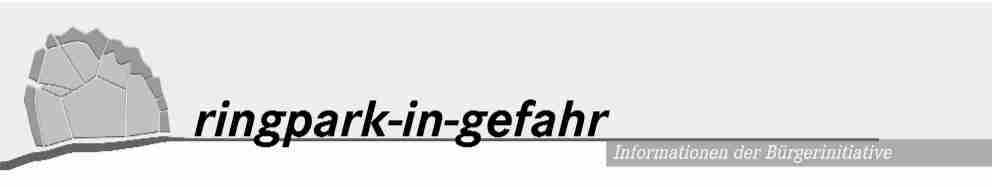|
Leuchtturm kultureller Art (Foto: dpa)
An einer entlegenen Stelle seines
Passagenwerkes äußert Walter Benjamin den Gedanken einer Umkehrung von
individueller und kollektiver Wahrnehmung. Dem Individuum sind seine
Organempfindungen, Gefühle der Krankheit oder Gesundheit innerlich, aber
Phänomene wie Mode, Architektur, Stadt oder Wetter äußerlich. Doch vom
Standpunkt des Kollektivs betrachtet, kehre sich das Verhältnis um:
Dann, so Benjamin, lassen sich Mode, Stadt und andere gesellschaftliche
Formbildungen als innere Vorgänge wie Verdauung oder Atmung verstehen,
so dass man durch Städte wie durch die Eingeweide des Kollektivs gehen
kann. Wer aber ist das Kollektivsubjekt, das die Stadt heute formt,
baut, bewohnt, entwickelt?
Diese Frage ist so ohne weiteres nicht zu beantworten. Zwar nimmt das
Gewicht privater Initiativen und Investitionen unübersehbar zu; aber das
wäre zunächst einmal wertfrei zu sehen. Generell gilt, dass Stadt einem
Funktions- und Bedeutungswandel unterliegt, dass sie weder dynamischen
noch normativen Gesetzen folgt. Gewiss, im sich verschärfenden
Städtewettbewerb wird Branding als Strategie immer wichtiger. Doch im
Bestreben, ihr Marken-Image zu verbessern, konzentrieren sich viele
Städte mehr auf die Werte und Emotionen, die die Kunden und Bürger mit
dem Produkt verbinden, als auf deren Qualität selbst.
Allenthalben rekurrieren die Kommunen heute auf das gleiche Leitbild:
die "europäische Stadt". Dies sei die Stadt, in der unsere Gesellschaft
wieder heimisch werden, die alle Bedürfnisse gleichermaßen befriedigen
könne. Sie gewährleiste Zukunft aus Herkunft und damit Identität. Den
diesbezüglich bekanntesten Versuch stellt das Planwerk Innenstadt in
Berlin dar. Standen anfangs der 90er Jahre stadträumlich begrenzte
Gebiete wie Potsdamer Platz oder Alexanderplatz im Fokus, sollte nun
nicht weniger als die gesamte City ins Bild rücken. Vom
Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg bis zur Oberbaumbrücke in Kreuzberg
reichte der Versuch, einen Masterplan über die Stadtteile und Teilstädte
zu legen. Gerade wegen dieses impliziten Leitbild-Anspruchs entzündete
sich darüber eine erbitterte Kontroverse, die sich mittlerweile –
mangels Umsetzung – beruhigt, nicht aber überholt hat.
Stadtentwicklung:
Spätestens seit der Wende
unterliegen die deutschen Metropolen einem Funktions- und
Bedeutungswandel. Im ersten Teil unseres urbanistischen Updates geht es
um Planungsstrategien in Berlin und Hamburg; im zweiten um diejenigen in
Leipzig und München.
Der Autor ist Leiter der Abteilung Bauen, Wohnen,
Architektur des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (Bonn/Berlin). chth
Was modellhaft sein kann und was nur
Mythos ist, muss aber eingehender sortiert werden, will man Städtebau
nicht bloß in emotionalen Retro-Orientierung betreiben. Denn die
überlieferte Siedlungsform als Idealbild der Stadt zu beschwören, wäre
tendenziell ideologisch, weil Erwartungen an die Auswirkungen bestimmter
baulich-räumlicher Dispositionen geknüpft werden, ohne dass es dafür
schlüssige Belege gäbe.
Theoretisch hat sich zwar die Auffassung durchgesetzt, dass Städte nicht
mehr mit dem Kompass geplant werden können. Womit die Ausrichtung auf
konstante physikalische Bedingungen, die Festlegung einer mehr oder
weniger unwandelbaren Stadtstruktur desavouiert ist. Dessen ungeachtet
aber strebt Stadtplanung (noch) immer danach, prognostizierten
Entwicklungen mit neuen, möglichst weitsichtig angelegten Mauern
gleichsam vorzubauen.
Beispiel Hamburg: Die Stadt war seit je auf die Alster ausgerichtet, den
seit dem Mittelalter aufgestauten Binnensee am Nordrand der Altstadt.
Der Zollkanal trennte die an der Elbe gelegenen Gebiete des Freihafens
von der Wohnstadt. Doch erst die Nachkriegsentwicklung, insbesondere die
autobahnähnliche Ost-West-Straße, versetzte den Hafen in einen urbanen
Dornröschenschlaf, indem sie ihn vom Stadtkörper abschnürte.
Weiterhin Wachstum in Hamburg
Diese Grunddisposition soll nun
gleichsam umgedreht, Hafengegend und Elbufer neu und bildträchtig
urbanisiert, damit die Stadt wieder in die Gruppe der dynamischen
Metropolen gehievt werden. Flankierend postulierte Hamburgs Erster
Bürgermeister Ole von Beust das Motto der "wachsenden Stadt": Schluss
mit Zersiedelung und Stadtflucht - die Hansestadt will endlich eine
Alternative im Inneren der Stadt bieten. "Nördliches Elbufer" und
"Sprung über die Elbe"- so heißen die Entwicklungsschritte, die sich mit
einer "Stadterweiterung nach innen" beschäftigen.
Am prominentesten ist dabei die HafenCity: Indem der Siegeszug der
Container den Gütertransport zur See revolutionierte, machte er die
meist innenstadtnahen Hafengebiete von Amsterdam bis New York
überflüssig. Verglichen etwa mit der Canary Wharf in London begann man
an der Elbe spät mit der Revitalisierung der wassernahen Flächen. Seit
2001 wird massiv gebaut: an einem lebendigen Stadtteil mit maritimem
Flair, nutzungsgemischter Blockstruktur, sorgfältig und ausgewogen
geplant. So zumindest stellt es sich die HafenCity Hamburg GmbH vor, die
als Entwicklungsträger eine 100%ige städtische Tochter ist. Dass mit der
neuen finanzkräftigen Klientel die noch bestehenden alten Nutzungen
verdrängt werden, ist evident. Dies betrifft nicht nur die
Speicherstadt, den etwa 1,5 Kilometer langen spektakulären
Warenlagerkomplex auf der Brookinsel.
Mit teuren Grundstücksverkäufen hat die Stadt von vorn herein den Takt
angegeben für die künftigen Preise. Die Hafencity zielt auf eine
Hochglanzwirklichkeit, die international vermarktbar sein und
anschlussfähig machen soll an prosperierende Städte wie Barcelona oder
Sydney. Zwar wird sie ein abgeschotteter Hort der Wohlhabenden kaum
sein, schon deshalb nicht, weil wunderbare Wasserplätze, weil
geschwungene Stege und Grünzungen ein attraktives Ziel bilden.
Gleichwohl liegt die Frage nahe, warum die Hansestadt sich ausgerechnet
von großen Baugesten und noch größeren Investoren eine unverwechselbare
Identität für das neue Quartier erhofft, und wieso sie nicht das Wohnen
für Familien genauso bezuschusst wie ein Urban Entertainment Center.
Urbanität als Management-Ideologie
Urbanität scheint zu einer
zeitgenössischen Management-Ideologie geworden zu sein. Freilich müsste
man da nachhaken: Was hilft, eingedenk der Erfahrungen der letzten
Jahrzehnte, eine Flächennutzungsplanung, die die so komplexe wie
einheitliche Wirklichkeit der Stadt von Anfang an zerhackt und nicht
mehr will, als ein Nebeneinander sich weitgehend feindlich
gegenüberstehender Sachlagen und Funktionen zu organisieren? Haben denn
die Kommunen, angesichts ihrer haushälterischen Miseren, überhaupt noch
die Kraft, um sich als ausgleichender Moderator unterschiedlicher
Interessen zu begreifen - anstatt allein als Zulieferer der Investoren? Und wer oder was entwickelt dann die Stadt? Muss man nicht, wenn man
schon den Staat leichtfertig aus seiner Funktion als aktiver Städtebauer
entlässt, vor allem überlegen, wie man die übrigen Mitspieler dazu
bringt, städtisch denken und handeln zu können? Die Frage, wem die Stadt
gehört und wem sie gehorcht ( den Bürgern, der Politik, den Investoren),
wird im kommunalpolitischen Diskurs offenbar nicht gestellt.
[ document info ]
Copyright © Frankfurter Rundschau online 2005
Dokument erstellt am 28.12.2005 um 15:52:05 Uhr
Erscheinungsdatum 29.12.2005 |