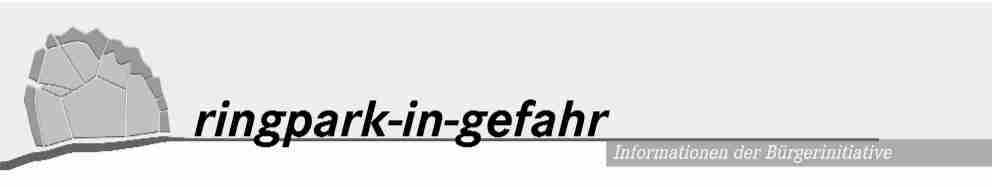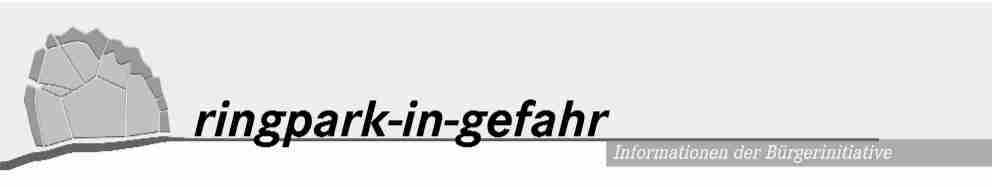|
Dass Architektur "in zerstreuter
Gewöhnung" und nicht in konzentrierter Aufmerksamkeit aufgenommen wird,
ist eine so schöne wie zutreffende Beobachtung Walter Benjamins. Ob sie
denn auch auf die Stadt als Lebenswelt gemünzt werden kann? Zumindest
scheint das menschliche Sensorium für die vergleichsweise
labyrinthischen Verhältnisse seiner künstlichen Umwelt nicht ohne
weiteres konditioniert. Als organisiertes Gemeinwesen jedoch muss sie
sich immer wieder neu in Form bringen, um sich der Identifikation durch
seine Bewohner zu versichern.
In München jedenfalls kann von "zerstreuter Gewöhnung" die Rede kaum
sein. Sie sei "die einzig ernst zu nehmende Stadt in Deutschland –
zumindest was das Stadtbild angeht". Dem Verdikt des Schweizer
Museumsleiters Christoph Vitali werden wohl, und nicht nur insgeheim,
viele Touristen beipflichten. Wohlsituiertes Klientel und liebliche
Plätze, hoher Freizeitwert und breite Straßenzüge, vitale City und
großzügige Parks, erkennbar historisch und doch geprägt von High-Tech:
So in etwa mag das Image lauten. Kritischen Geistern indes wird dies all
zu sehr nach interessensgelenkter Meinung klingen. Fraglos aber erweist
sich die kommunale Planungskultur, vor allem die zunächst belächelte
Entscheidung, historische Strukturen weitgehend wiederherzustellen,
längst als Qualität, die andernorts Neid und Nachahmung auslöst. So
fragwürdig und populistisch der Entscheid gegen weitere Hochhäuser im
letzten Jahr auch zustande gekommen sein mag, so wenig ist es verfehlt,
hier von Anteilnahme einer Bürgergesellschaft zu sprechen. Mit dem Petuelpark, der über einem Verkehrstunnel angelegt wurde, ist durch ein
Konzept des Künstlers Stephan Huber eine auf die Milieu-Unterschiede des
Orts abgestimmte, vergnügliche Kunst im öffentlichen Raum entstanden:
Ein Bürgerpark, der auch das nicht zuletzt durch die Verkehrsschneise
mitverursachte soziale Gefälle zwischen den Stadtteilen überbrücken
sollte.
"Kompakt, grün und urban": Mit diesem so eingängigen wie simplen Slogan
wird heute recht wirkungsvoll in Szene gesetzt, was an Potential
vorhanden ist. Wobei man sehen muss, dass München mit seinem überhitzten
Immobilienmarkt eine Ausnahmestellung innehat – und dennoch um eine
nachhaltige Stadtentwicklung bestrebt ist. Neubaugebiete wie die
Parkstadt Schwabing oder die Theresienhöhe, die auf einen Masterplan von
Otto Steidle zurückgeht, denken das gewachsene München weiter; die
Messestadt Riem hingegen versteht sich eher als eine Art Leuchtzeichen
der Stadterweiterung. Ein zentraler Qualitätsbaustein bei all diesen
großmaßstäblichen Projekten ist die Mischung aller Einkommensgruppen,
von geförderten und nicht geförderten Miet- und Eigentumswohnungen, bis
hin zu genossenschaftlichen Wohnformen. Prinzipiell regelt sich dies in
München über die "sozialgerechte Bodenordnung" und die
Selbstverpflichtung der Stadt bei der Verwendung eigenen Grund und
Bodens.
Der Städtebau – dies scheint schon im Begriff selbst angelegt – ist es
gewöhnt, Stadt durch bauliche Eingriffe zu gestalten: Infrastrukturen,
Stadtteile, Gebäude. Vielfach jedoch vollzieht sich eine städtische
Transformation, die sich in radikaler Weise zunächst ohne nennenswerte
Veränderung des physischen Raums in so genannten sozialen Brennpunkten
oder den Zonen der Schrumpfung vollzieht. Dies wirft zum einen das
Problem auf, ob das Verhältnis zwischen Raum und Nutzung nicht neu zu
denken ist. Und zum anderen die Frage, ob es neben dem klassischen
baulichen Eingriff nicht andere Formen der Intervention gibt, um die
Entwicklung zu beeinflussen.
Stadtumbau Ost: Leipziger Impulse
Namentlich Leipzig hat diesbezüglich
in den letzten Jahren Antworten zu formulieren versucht – und
entscheidende Impulse gesetzt. Offener und offensiver als andere Städte
vergleichbarer Größenordnung hat sich die Messestadt selbst in eine
Laborsituation begeben. Wie es mit dem Stadtumbau im Osten weitergeht,
unter welchen Rahmenbedingungen sich die Sanierung der Strukturen
vollzieht, wie der Gesellschaftsumbau gelingt, das wird sich in der
Stadt mit ihrem einzigartigen gründerzeitlichen Gebäudebestand
exemplarisch erweisen. Und es lässt sich in den ehemaligen
Buntgarnwerken in Plagwitz, im Sanierungsgebiet Gohlis, auf dem früheren
Eilenburger Bahnhof oder im Musikerviertel schon erahnen. Denn Leipzig
mit seinen Leerstellen, seinen verlassenen Fabrikstraßen und sozialen
Verwerfungen ist eine Stadt, in der die Zwischenräume zwischen den
Inseln kommerzieller Normalität so weit klaffen, dass sie nicht wie
sonst in Westeuropa aus der Wahrnehmung ausgeblendet werden können. Das
bietet die Chance der Langsamkeit und des Nachdenkens über eine
urbanistische Haltung, die nostalgische Architekturkopien und
kulissenhafte Historisierung nicht nötig hat.
Mit Instrumenten wie den " Gestattungsverträgen" hat Leipzig eine
temporär angemessene Strategie zur Bewältigung des Umbruchs vorgelegt,
indem überlieferte Baurechte nicht vorschnell außer Kraft gesetzt,
sondern eben nur den konkreten Bedingungen angemessene
"Zwischennutzungen" autorisiert werden. Es ist dies eine offene Option
auf die Zukunft, die zumindest nichts "verbaut". Und mit dem – viel
zitierten und ebenso oft missverstandenen – Postulat von der
"perforierten Stadt" hat es auch Eingang gefunden in die städtebauliche
Theoriebildung. In Sachsens größter Stadt ist aus der Not eine Tugend
gemacht, ein Paradigmenwechsel zumindest eingeleitet worden. Und in der
Bürgerschaft scheint die Einsicht in dessen Notwendigkeit verbreiteter
als andernorts, ohne dass indes der Anspruch auf kommunale Teilhabe
aufgegeben wurde. Denn an den als wahllos empfundenen Abrissen hatte
sich Kritik von Einwohnern und Denkmalschützern entzündet, so dass
jüngst von der Stadt ein Sicherungsprogramm zur Rettung von
"städtebaulich herausragenden Eckgebäuden" an Hauptstraßen vorgelegt
wurde: Bürgersinn artikuliert sich im Stadtbild.
Immer wieder – zurück auf Null
Stadtentwicklung: Seit der Wende
unterliegen die deutschen Metropolen einem Funktions- und
Bedeutungswandel. Nach einem Überblick über die Planungsstrategien in
Berlin und Hamburg (29.12.05) geht es abschließend um die Entwicklung
in München und Leipzig. Der Autor ist Leiter der Abteilung Bauen,
Wohnen, Architektur des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
(Bonn/Berlin). chth
Der Philosoph Spinoza hatte im 17.
Jahrhundert scharfsinnig festgestellt, dass die Eingebungen der
Propheten diese selbst nie auch nur ein bisschen schlauer gemacht
hätten: Sich selbst kaum zuzuhören und jedes Mal wieder bei Null
anzufangen, scheint auch das Schicksal der Stadtentwicklung zu sein.
Tatsächlich aber ist Stadt gestaltbarer als vielfach – vorschnell und zu
resignativ – angenommen. Nicht nur Architekten und Planer, auch Bürger
sollten sich (wieder) als das begreifen, was sie auch sind: nämlich
Subjekte und Akteure im Prozess der Stadtbildung.
Die Rolle der Subjektivität, so beschrieb es der Politikwissenschaftler
Adalbert Evers, bestehe bezogen auf die Stadt in der Herstellung dessen,
was man den "konkreten Ort" nennen könne. Dafür muss man die Couch
verlassen und auf der Straße das Städtische wahrnehmen.
[ document info ]
Copyright © Frankfurter Rundschau online 2006
Dokument erstellt am 02.01.2006 um 16:20:14 Uhr
Erscheinungsdatum 03.01.2006
|