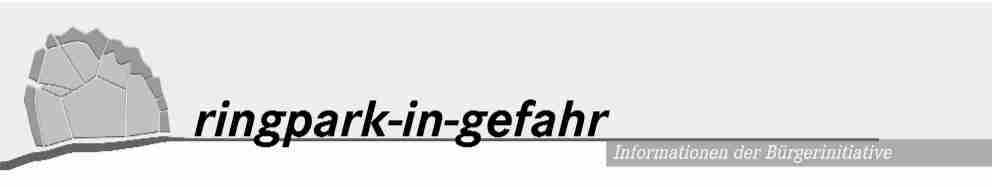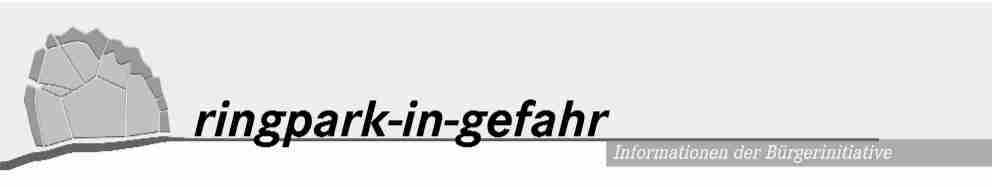|

Der Loreleyfelsen bei St. Goarshausen ist die Hauptattraktion
des Mittelrheintales
(Foto: dpa) |
|
|
von Holger Kreitling
Wenn man heute Postkarten aus den
sechziger und siebziger Jahren in die Hand nimmt, erscheint der dort zu
beobachtende Stolz auf moderne Bauwerke befremdlich. Gerne schiebt sich
ein Haus ins Bild, wenn im Hintergrund schöne Natur zu sehen ist. Oder
eine neue Brücke ziert die Ansicht vom Baudenkmal. Die deutsche
Gesellschaft sonnte sich im Fortschritt, Beton wirkte wie ein Martini.
Städte prunkten mit Architektur, die heute nur Kopfschütteln auslöst,
weshalb diese Retrochic-Postkarten nunmehr in Kitschläden zu kaufen
sind. Bildnisse aus der hohen Zeit des Camp.
Den Mentalitätswechsel muß man im Auge
haben, um den überall entbrannten Streit um die Wahrung von
Baudenkmälern zu verstehen. Interessanterweise geht es nie um die
Zerstörung oder Beschädigung der Denkmäler, sondern immer um die Blicke
und Sichtachsen. Beim Bau der Hochhäuser in der Nähe des Kölner Doms,
bei der Waldschlößchenbrücke in Dresden, beim Streit um Windräder rund
um die Wartburg in Eisenach. Nachdem die Unesco, die über all die
Stätten des Weltkulturerbes wacht und wachen muß, in Potsdam Alarm
geschlagen hat, wurde ein geplantes Einkaufszentrum, das die Sicht von
Sanssouci aus behindert hätte, gestoppt. Die barocke Potsdamer
Schlösserlandschaft prunkte einst mit rund 200 Blickachsen. Nur noch
wenige sind erhalten.
Am Mittelrhein bei St. Goar wünschen
sich Unternehmen und Landräte eine neue Brücke, weil es auf der Strecke
von 130 Kilometern keine gibt. Aber der Blick auf die Kulturlandschaft
des Mittelrheins wäre gestört. Es ist ein bißchen wie im Diktum des
Epiktet: Nicht die Dinge beschädigen die Menschen, sondern die
Ansichten.
Die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones
hat gerade ordentlich versnobt erklärt, ihr Hobby sei es, Aussichten zu
sammeln. Deshalb kaufte sie sich Herrenhäuser, Fincas, Wohnungen sowie
eine kleine Burg, um von dort ungestört nach draußen zu sehen. Diese
Blicke sind der reine Luxus. Sie liegt mit ihrer Leidenschaft im Trend.
Was die Unesco in Paris sonst tut, egal ob mit Roten Listen unterstützt
oder nicht, ist der Bevölkerung eigentlich herzlich egal. Doch
Hochhäuser vor dem Kölner Dom empören die Kulturnation, nicht bloß wegen
der verbauten Dom-Ansicht, auch wegen der Hochhäuser.
Die Wahrung des unverstellten Blicks
ist Ausdruck des gewandelten Stadtverständnisses. Was Städteplaner und
Investoren vorlegen, wird heute enorm kritisch betrachtet, und man darf
sicher sein, daß hysterienahe Kampagnen von empörten Bürgern in Gang
gesetzt werden, die sich auf ein meist diffuses Stadt- oder
Landschaftsempfinden berufen, das aus der Romantik des frühen 19.
Jahrhunderts stammt. Beim Blick auf den Rhein wirkt Heines "Loreley"
stärker denn je. Der touristische Blick etwa von Japanern auf liebliche
Städte wie Heidelberg wird gerne von Einheimischen belächelt. Aber in
den letzten Jahren ist es gerade der touristische, von Bildung eher
befreite Blick, den die Eventkultur auch hierzulande erfolgreich
befördert.
Die schöne Aussicht wird zum Bollwerk,
das gegen die bedenkenlosen Hasardeure der Ökonomie verteidigt wird. Und
doch sitzen Gegner und Befürworter im gleichen Boot. Wenn vom "Canaletto-Blick"
auf die Elbauen in Dresden die Rede ist, der durch ein
"Brücken-Monstrum" zerstört würde, stellt sich bürgerliches
Kulturempfinden gegen bürgerliche Wirtschaftsordnung. Die Zerrissenheit
des wertkonservativen Lagers manifestiert sich deutlich. Nur der
Aufstand gegen Windräder in der Landschaft, dieser ästhetische Herpes
und die tatsächlich schlimmste Hinterlassenschaft von Rot-Grün, eint die
bürgerliche Mitte; damit lassen sich im Namen der Schönheit gleich
ideologische Grabenkriege gegen die Linke mitführen.
Im Kampf für den Blick kommt ein
zunehmendes Unbehagen an sozialem und kulturellem Wandel zum Ausdruck.
Aussichten sind visuelle Ruhepole in einem rasant sich verändernden
Umfeld. Während die öffentliche Bild-Wahrnehmung sich ständig
beschleunigt und mit Rasanz prunkt, in Fernsehen und im Kino, in der
Werbung im Stadtbild, sind Aussichten unbeweglich und mit Tradition und
Geschichte verhaftet. Der Rhein fließt gemächlich, und die Elbe auch. Um
die Wartburg kreisen die schwarzen Vögel und sonst bitteschön gar
nichts.
Die architektonische Blickachse als
Augenwohl ist im Barock am exzessivsten eingesetzt worden. Aber gerade
das Barock erfand auch das trompe-l'oeil, die Augentäuschung. Manche
Ruine ist als Ruine erbaut worden, und am Ende der Blickachsen in
barocken Parkanlagen steht häufig die Attrappe. Wer dahinter blickt,
schaut auf lachhaft leere Kulisse. Die Sehnsucht nach unverstellten,
bewahrten Ansichten ist grundiert vom Wunsch, daß die alte Zeit
zurückkehrt, weil sie besser war. Die alte Bundesrepublik mit ihrem
Sozialsystem und ihrer Sorglosigkeit aber gibt es nur mit Bausünden.
Artikel erschienen am Fr, 6. Januar 2006
© WELT.de 1995 - 2006 |